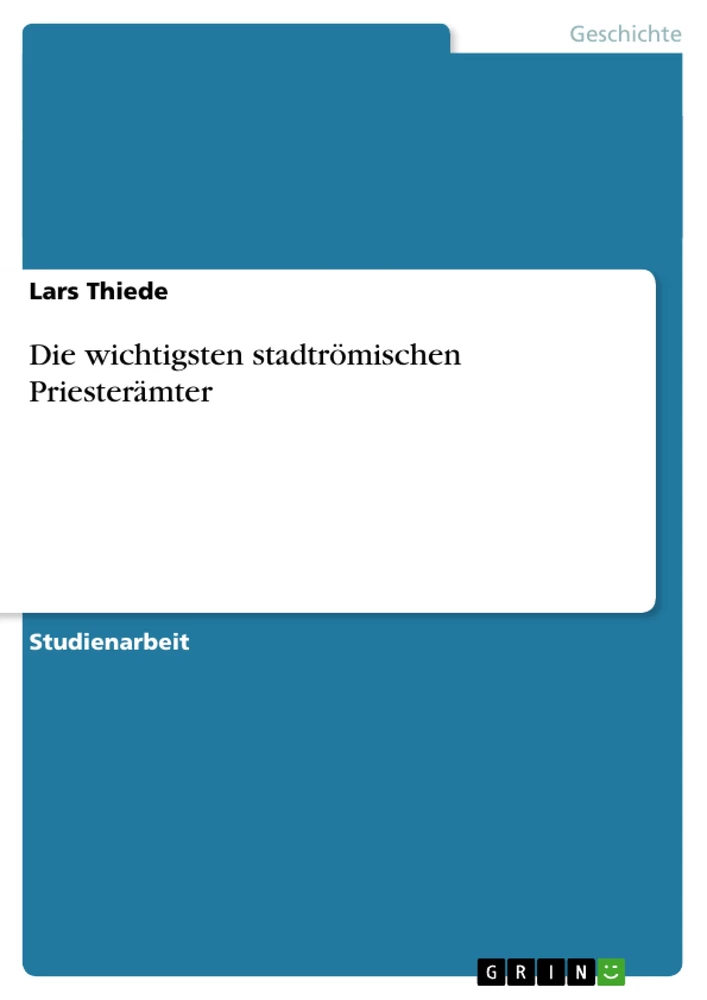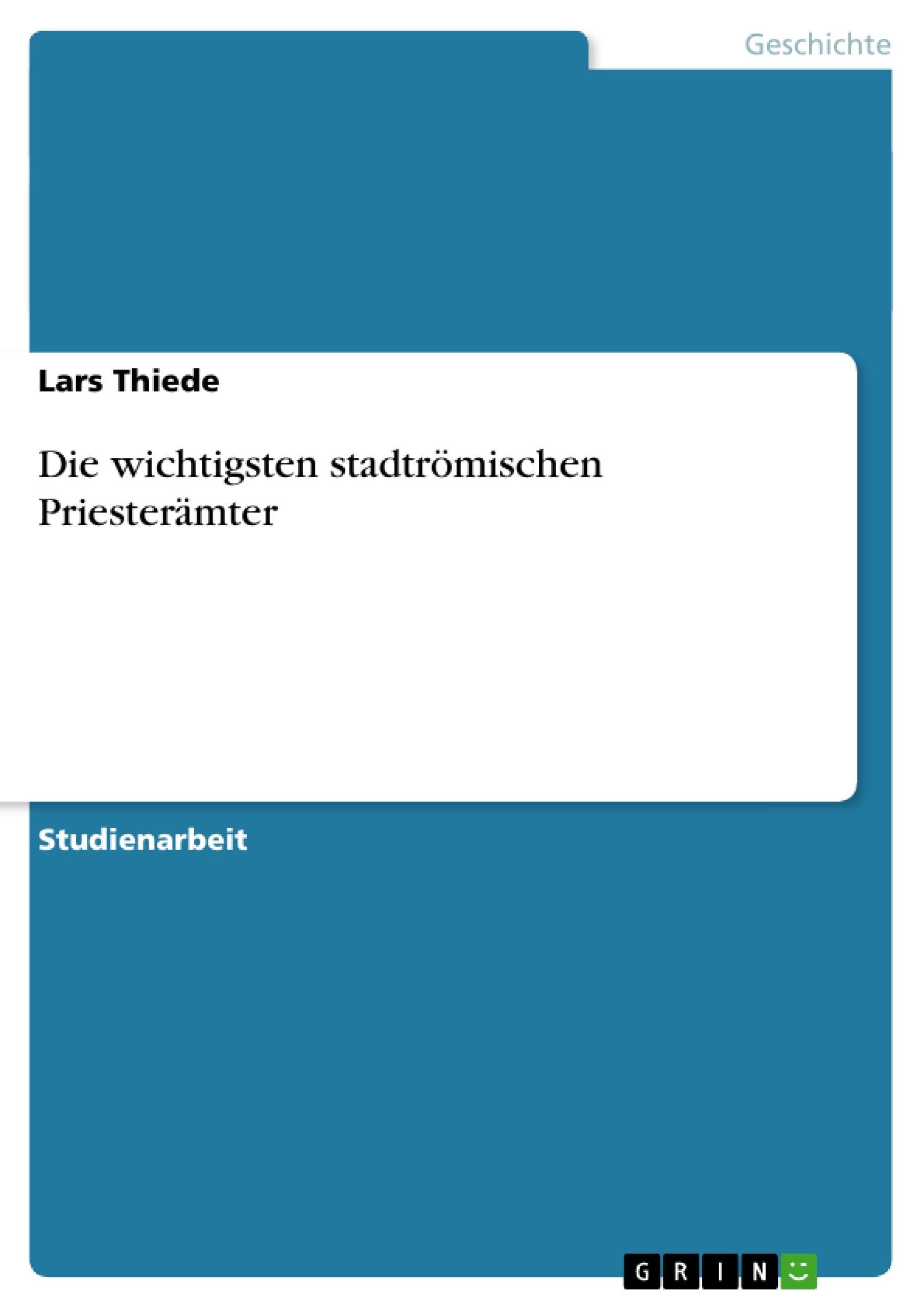In einer Welt, in der das Schicksal Roms in den Händen von Göttern und ihren irdischen Stellvertretern lag, entführt dieses Buch in das geheimnisvolle Reich der römischen Priesterschaften. Jenseits von Cäsar und Legionen wirkten im antiken Rom mächtige religiöse Institutionen, die das politische und gesellschaftliche Leben tiefgreifend beeinflussten. Tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte der Collegia Sacerdotum, der einflussreichen Priesterkollegien wie der Pontifices, Auguren, Quindecimviri und Epulones, deren Rituale und Entscheidungen das Schicksal des Reiches lenkten. Ergründen Sie die Aufgaben und Privilegien der Priester, von der Deutung göttlicher Vorzeichen bis zur Überwachung der öffentlichen Kulte. Entdecken Sie die verborgenen Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse innerhalb der Priesterschaft, von den mächtigen Pontifices Maximi bis zu den geheimnisvollen Vestalinnen, deren ewiges Feuer das Herz Roms symbolisierte. Verfolgen Sie die Entwicklung der Priesterämter von ihren bescheidenen Anfängen in der bäuerlichen Gesellschaft bis zu ihrer zentralen Rolle im politischen Machtspiel der Republik. Lernen Sie die priesterlichen Sodalitäten kennen, wie die Fetiales, Arvales Fratres und Curionen, deren Kulte und Traditionen tief in der römischen Geschichte verwurzelt waren. Erfahren Sie mehr über die etruskischen Haruspices, deren Kunst der Leberschau und Blitzdeutung Einblicke in die Zukunft versprach. Dieses Buch bietet einen umfassenden und detailreichen Einblick in die Welt der römischen Religion und Priesterschaft, ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für die Geschichte und Kultur des antiken Roms interessieren. Es beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Religion, Politik und Gesellschaft und zeigt, wie die Priesterschaften das Leben der Römer prägten. Mit Zitaten von Livius, Cicero, Gellius und Varro wird ein authentisches Bild der damaligen Zeit gezeichnet. Die detaillierte Analyse der Aufgabenbereiche, der mystischen Bedeutung und der Kulthandlungen der einzelnen Priesterschaften ermöglicht ein tiefes Verständnis der römischen Religion und ihrer Bedeutung für die römische Gesellschaft. Dieses Buch ist somit eine essentielle Lektüre für jeden, der die römische Geschichte und Kultur wirklich verstehen will.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Entstehung der Priesterschaften
2.1. Stellung der Priesterschaften
3. Collegia Sacerdotum
3.1. Auguren
3.2. Collegium Pontificum
3.2.1. Pontifices
3.2.2. Rex Sacrorum
3.2.3. Flamines
3.2.4. Vestalinnen
3.3. Quindecimviri (XVviri, Xviri, IIviri) Sacris Faciundis
3.4. Epulones (Septemviri)
4. Priesterliche Sodalitäten
4.1. Fetiales
4.2. Arvales Fratres
4.3. Curionen
5. Haruspices
6. Fazit
7. Quellenverzeichnis
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Dieser Text wird sich mit den wichtigsten Priesterämtern beschäftigen, die in vorkaiserlicher Zeit in Rom existent waren. Aufgrund des polytheistischen Charakters der römischen Religion und der Tatsache, daß alle Teilbereiche des römischen Lebens von kultischen Handlungen begleitet wurden, gab es eine Vielzahl von Priesterkollegien.
In diesem Text sollen elf der wichtigsten Priesterschaften behandelt wer- den. Die Tatsache, daß es aber weit aus mehr Priesterschaften gab, machte eine Auswahl nötig. Die Auswahlkriterien waren neben der Be- deutsamkeit der einzelnen Priesterkollegien die Literaturlage, sowie der Versuch den sehr breiten Aufgabenbereich der gesamten römischen Priester darzustellen.
Die wesentlichen Gesichtspunkte bei der Betrachtung der Priesterschaften werden zum einen deren Zusammensetzung, Mitgliederanzahl und Auf- nahmeverfahren sein. Zum anderen werden Aufgabenbereich, mystische Bedeutung, sowie einige beispielhafte Kulthandlungen Teil der Darstellung sein. Außerdem soll versucht werden Hierarchien, Abhängigkeits- und Zu- sammengehörigkeitsverhältnisse der Priesterkollegien untereinander darzulegen. Als Quellen über Priesterschaften in republikanischer Zeit sind vor allem Livius, Cicero und Gellius, sowie Varro für die Herkunft der Namen der verschiedenen Priesterämter von Bedeutung.
2. Entstehung der Priesterschaften
Das gesamte römische Leben ist eng mit Religion verknüpft gewesen. Wesentliche Bestandteile der römischen Religion waren die Beobachtung und Beachtung von göttlichen Vorzeichen, sowie der Erhalt göttlichen Wohlwollens durch Opfer oder bestimmte Kulthandlungen.1 In diesem Zusammenhang zeigt sich dann auch besonders, daß die Rö- mer stets ein sehr formalisiertes Verhältnis zu Göttern und Kulthandlungen hatten. So mußten immer wieder die gleichen Handlungen zu den gleichen Gelegenheiten oder Daten vorgenommen werden. Vor allem in der Früh- zeit der Republik wurden die Kulthandlungen privat von den jeweils zu- ständigen Mitgliedern der bäuerlichen Hausgemeinschaft, besonders dem Pater Familias, übernommen. In späterer Zeit wurden diese Kulthandlun- gen dann verstärkt Priesterkollegien übertragen, welche die Handlungen stellvertretend für die gesamte Gemeinde oder Stadt öffentlich vornah- men.2
Anhand dieser Entwicklung lassen sich die Entstehungen der meisten Priesterkollegien nachvollziehen, die in diesem Text behandelt werden. Bei einigen Priesterschaften ist ihre Herkunft aus diesem Hintergrund be- sonders auffällig (Arvales Fratres, Curionen, Vestalinnen), während ande- re Priesterschaften (Haruspices, Quindecimviri Sacris Faciundis, Epulo- nes) aus einem vollkommen anderen historischen Zusammenhang ent- standen sind.
2.1. Stellung der Priesterschaften
Allen Priesterkollegien war gemeinsam, daß sie nicht in den Cursus Hono- rum eingebunden waren, obwohl manche Kollegien durchaus als Teil der Staatsverwaltung gelten konnten. Diese Trennung zwischen Magistratur und Priesterämtern war vorgenommen worden, um eine zu großeMach- tanhäufung zu verhindern und zu gewährleisten, daß die regelmäßige
Durchführung der Gottesdienste nicht durch Abwesenheit der Priester aus Rom, wie sie bei Magistratsämtern oft notwendig war, gefährdet wurde.3
Vorbedingungen für die Bekleidung eines Priesteramtes waren eine freie Geburt und körperliche Unversehrtheit. Außerdem mußte derjenige römi- scher Bürger und nicht vorbestraft sein. Anders als bei Magistraturen war der Erhalt eines Priesteramtes aber nicht an die vorheriger Ausübung be- stimmter Ämter oder ein Mindestalter gebunden. Weitere Unterschiede bestanden darin, daß Priesterämter in der Regel lebenslänglich waren und die Aufnahme in fast allen Kollegien per Kooptation durch die bestehen- den Mitglieder erfolgte, wobei jedes Mitglied einen Kandidaten für das zu besetzende Amt vorschlug.
Eine Gemeinsamkeit aller Priesterämter war die Gewährung gewisser Pri- vilegien. Diese waren die Befreiung vom Militärdienst, von der Übernahme einer Vormundschaft und von der Bestellung zum Schiedsrichter.4 Außer- dem hatten Priester das Recht, Mitteilungen an die Bevölkerung zu veröf- fentlichen, Festessen auf Staatskosten zu veranstalten, bei Feierlichkeiten einen Ehrenplatz zu erhalten und die Toga Praetexta zu tragen.
Eine weitere Unterstützung von Seiten des Staates bestand in der Bereit- stellung von Sklaven für Opferdienste, Finanzverwaltung und Protokollfüh- rung. Vor allem die Hilfestellung bei Opferdiensten wurde ursprünglich von Familienmitgliedern, besonders von den noch nicht erwachsenen Kindern übernommen. Im Verlauf der Zeit wurden dann aber auch Kinder anderer Familien und schließlich Sklaven mit diesen Aufgaben betraut.5
3. Collegia Sacerdotum
Als Collegia Sacerdotum wurden z. B. Pontifices, Auguren, Quindecimviri und Epulones bezeichnet. Diese vier Kollegien wurden als die wichtigsten und ehrenvollsten angesehen, so daß es verboten war, gleichzeitig Mit- glied in zwei der Kollegien zu sein. Ein weiterer Unterschied zu anderen
Kollegien bestand in einer Volkswahl, die nach den Nominierungen durch Kollegiumsmitglieder, aber noch vor der dann nur noch formalen Kooptation durchgeführt wurde. Die Bedeutung von Pontifices und Auguren wird auch an der Tatsache deutlich, daß nur diese beiden Priesterämter in den Kolonien eingerichtet wurden.6
3.1. Auguren
Das Kollegium der Auguren wurde der Legende nach von Romulus7 oder Numa gegründet und bestand erst aus drei, dann aus vier oder sechs, dann aus neun und später aus 15 Mitgliedern.8 Die Priesterschaft hatte keinen Vorsitzenden, so daß die Priester ihre Meinung bei den gemein- samen Versammlungen an den Nonen jeden Monats in der Reihenfolge des Alters äußerten.9
Die Aufgabe der Auguren war strenggenommen nicht die von Priestern, da sie weder Göttern opferten noch irgendwelche Kulthandlungen durch- führten. Vielmehr holten sie göttliche Vorzeichen von Jupiter für bevorste- hende Vorhaben, wie z. B. eine Versammlung, Schlacht, Wahl, etc. ein.10 Zusätzlich unterstützten und überwachten sie Magistratsbeamte bei deren Tätigkeit.11
Diese Vorzeichen wurden anhand von Blitz und Donner, dem Flug und dem Gekrächze der Vögel, dem Hunger der heiligen Hühner, Tierspuren oder drohenden Vorahnungen erhalten.12 Aufgrund dieser, die sich in er- betene und unerbetene einteilten, gaben sie Auskunft darüber, ob Jupiter einem Vorhaben wohlgesinnt gegenüberstand.13 Die relative Beliebigkeit der Vorzeichen und die großen politischen Einflußmöglichkeiten durch die Überwachung von Magistratsbeamten und Versammlungen machte die Auguren zu einem politischen Machtinstrument. Dieses und die Konkur-renz durch die Haruspices höhlte die Tätigkeit der Auguren inhaltlich voll- kommen aus.14
3.2. Collegium Pontificum
Das Collegium Pontificum bestand aus vier Collegia Sacerdotum: Pontifi- ces, Rex Sacrorum, Flamines und Vestalinnen. Formal stand der Rex Sacrorum an der Spitze gefolgt von den Flamines Maiores, dem Pontifex Maximus als Vertreter der Vestalinnen und den Flamines Minores. Auf- grund dieser klaren Hierarchie war es verboten, gleichzeitig Mitglied in zwei der Kollegien zu sein.15
Obwohl der Pontifex Maximus in der formalen Rangfolge des Collegium Pontificum nur an fünfter Stelle stand, hatte er innerhalb der Priesterschaft den Vorsitz, der mit größeren Machtbefugnissen als in jedem anderen Priesterkollegium verbunden war. Diese äußerten sich im Disciplinarrecht, welches er gegenüber den anderen Mitgliedern seiner Priesterschaft hatte und in seinem Alleinvertretungsanspruch gegenüber Senat und Volk. So war er der einzige Priester, der Volksversammlungen einberufen durfte.16 Gewählt wurde der Pontifex Maximus vom Volk durch nur 17 anstatt der sonst üblichen 35 Tribus, wobei sich im Normalfall nur sehr vornehme Männer, die schon den Rang eines Konsul erreicht hatten, zur Wahl stell- ten.17 18
Aufgabe des Pontifex Maximus war die Oberaufsicht über die anderen Pontifices und deren Aufgabenbereiche, die Überwachung und Bestrafung der Vestalinnen und die Kontrolle der Flamines.19
3.2.1. Pontifices
Die Pontifices bestanden zuerst aus neun, später aus 15 Mitgliedern, wo- bei jeweils die Hälfte Plebeier sein mußten. Die Aufgabenbereiche der Pontifices waren vielfältig und bargen große politische Einflußmöglichkei- ten.20 21 So waren sie die letztendlich entscheidende Instanz für alle Fra- gen des sakralen Rechts und überwachten die korrekte Ausführung aller öffentlichen und privaten Sakralhandlungen. Diese Kontrolle mußte auf- grund einer Vielzahl von Verfahrensvorschriften sehr pedantisch erfolgen und bei dem geringsten Fehler mußte die gesamte Handlung wiederholt werden.22 23 Ihre größte Einflußmöglichkeit lag im Erstellen von Gutachten, die sie auf Anfrage des Magistrats oder Senats anhand ihrer umfangrei- chen Archive über sakrale Angelegenheiten anfertigten, wobei sie einen relativ großen Ermessensspielraum besaßen.24
Weiterhin hatten sie die Aufsicht über den Kalender, legten die Dies Fasti und Nefasti fest, waren für die Verifikation von Vorzeichen als göttlichen Prodigia und deren Sühnung, sowie das Familienrecht zuständig. Ein wei- terer Bereich war die Aufsicht über die Kulte der Vesta, der Penaten, der Kapitolinischen Trias, sowie aller Kulte ohne eigene Priesterschaft, wobei sie auch als Opferpriester in Erscheinung traten. Zusätzlich war ihre An- wesenheit bei gewissen Sakralhandlungen und Begehungen erforder- lich.25
3.2.2. Rex Sacrorum
Der Rex Sacrorum mußte ein Patrizier sein, wurde vom Pontifex Maximus ernannt26 und war diesem unterstellt. Er war der sakrale Nachfolger des Königs und übernahm zusammen mit dem Pontifex Maximus dessen kulti- sche Aufgaben. Formal stand er in der Rangfolge der Priester an erster Stelle und hatte damit auch bei vom Pontifex Maximus einberufenen Volksversammlungen den Ehrenvorsitz inne.27 Neben seinem Amt durfte der Rex Sacrorum aber keine anderen Ämter bekleiden und war so von jeder politischen oder militärischen Machtposition ausgenommen.28 Die- ses sollte zum einen sicherstellen, daß er ausreichend Zeit zur Erledigung seiner Pflichten zur Verfügung hatte, zum anderen wollte man durch die- ses Verbot einer Wiederherstellung des Königtums entgegenwirken.29 30 Der Rex Sacrorum war ein Januspriester und mußte die Sühneopfer ver- richten, die vorher der König ausgeführt hatte. Außerdem mußte er an je- den Nonen die Feiertage des jeweiligen Monats in einer Zeremonie auf dem Kapitol verkünden. Ähnlich wie beim Flamen Dialis spielte auch beim Rex Sacrorum seine Familie eine Rolle. So mußte seine Ehe und die sei- ner Eltern auf bestimmte Art geschlossen worden sein und seine Frau, die Regina Sacrorum, mußte gewisse Kulthandlungen übernehmen.31
3.2.3. Flamines
Das Kollegium der Flamines wurde der Legende nach von Numa gegrün- det und umfaßte 15 Priester, wobei jeder einzelne für die Verehrung einer bestimmten Gottheit zuständig war. Sie wurden in drei Flamines Maiores für die Götter Jupiter (Flamen Dialis), Mars (Flamen Martialis) und Quiri- nus (Flamen Quirinalis), sowie zwölf Flamines Minores für zwölf weitere Gottheiten, von denen allerdings nur zehn bekannt sind, eingeteilt. Nur die Flamines Maiores mußten Patrizier sein, während die Flamines Minores auch Plebeier sein konnten.32
Während über die Flamines Minores wenig bekannt ist, weiß man über die Flamines Maiores, daß sie bei verschiedenen Sakralhandlungen an be- stimmten Daten opfern mußten. Eine Sonderstellung unter den Flamines Maiores nahm der Flamen Dialis ein, der scheinbar als Träger magischer
Energien und als eine Art Vermittler zwischen Göttern und Menschen angesehen wurde.33
Aufgrund dessen gab es für sein Leben eine Vielzahl von Vorschriften und Restriktionen, die seine magischen Energien schützen sollten. Diese strengen Vorschriften führten allerdings auch dazu, daß das Amt sehr unbeliebt und darum auch nicht immer besetzt war.34
Fast jeder Lebensbereich des Flamen Dialis wurde von Vorschriften geregelt, um eine rituelle Verunreinigung zu verhindern. Er mußte ständig die Toga Praetexta und einen speziellen Hut aus der Haut eines Opfertieres tragen.35 Er durfte kein Pferd, Heer oder einen Menschen in Ketten sehen, keinen Ring oder Knoten an sich haben und an Feiertagen nicht einmal sehen, wie jemand arbeitete.36
Efeu, Bohnen, Mehl, Hefe, Ziege, Hund oder rohes Fleisch durfte er weder sehen, noch nennen oder berühren.37 Außerdem durfte er nicht schwören, sein Bett nicht länger als zwei Nächte verlassen und mußte jeden Kontakt mit dem Tod zugeordneten Dingen und Orten vermeiden.38 Andere Vor- schriften betrafen seine abgeschnittenen Haare und Fingernägel, damit diese niemand für einen gegen ihn gerichteten Schadenszauber verwen- den konnte.39
Auch die Familie des Flamen Dialis war, wie beim Rex Sacrorum, in den Kult mit einbezogen. Seine Ehe und die seiner Eltern mußte auf eine bestimmte Art geschlossen worden sein. Außerdem mußte seine Frau, die Flaminica, ebenfalls eine rituelle Rolle bei manchen Opferhandlungen ausüben, gewisse Kleidungs- und Frisurvorschriften beachten und durfte sich nicht von ihm scheiden lassen.40
3.2.4. Vestalinnen
Die Vestalinnen waren die Stellvertreterinnen der Haus- oder Königstöch- ter, was an ihren Aufgaben und ihrem Alter bei der rituellen Ergreifung deutlich wird. Bei ihnen handelte es sich um sechs adelige Töchter, die im Alter von sechs bis zehn Jahren in einer rituellen Handlung ergriffen wur- den41 und danach ihren Dienst 30 Jahre lang im Atrium Vestae versa- hen.42
Dieser Dienst teilte sich in die Ausbildung als Novizin, den Dienst im Kult der Vesta selber und die Ausbildung anderer Novizinnen auf, wobei jeder Abschnitt eine Dauer von zehn Jahren hatte. Nach dieser Zeit durften die Vestalinnen ins Privatleben zurückkehren, wovon allerdings die wenigsten Gebrauch machten.
Eine der sechs Vestalinnen wurde nach heute unbekannten Kriterien zur Virgo Vestalis Maxima bestimmt, welche die Priesterinnen bei ihren Auf- gaben führte. Diese Aufgaben bestanden in der rituellen Verrichtung der Tätigkeiten einer Haustochter. Das heilige Stadtfeuer mußte permanent unterhalten und im Falle seines Erlöschens auf antiquierte Weise wieder entzündet werden. Wasser mußte in altertümlichen Gefäßen in die Stadt geschafft und dreimal im Jahr mußten mit aus Speltähren bestehender, selbstzubereiteter Nahrung rituelle Volksspeisungen vorgenommen wer- den.43
Außerdem waren die Vestalinnen neben der Teilnahme an verschiedenen Ritualen zur Keuschheit verpflichtet.44 Verletzten sie diese, war der Ponti- fex Maximus, der die Rolle des Familienvaters ausübte, verpflichtet, sie und ihren Verführer zu töten. Diese Patria Potestas beinhaltete auch das Recht, junge Adelstöchter für ihren Dienst im Tempel rituell zu ergreifen und die Vestalinnen im Falle von Pflichtverletzungen zu züchtigen.45
3.3. Quindecimviri (XVviri, Xviri, IIviri) Sacris Faciundis
Das Kollegium der Quindecimviri entstand erst in später Zeit als die ande- ren Collegia Sacerdotum und bestand zuerst aus zwei, dann aus zehn und später aus 15 Priestern, was auch die verschiedenen in der Literatur vor- kommenden Namen erklärt. Die Priesterschaft mußte paritätisch aus Pat- riziern und Plebeiern bestehen.46 An ihrer Spitze standen zwei Magistri, von denen ebenfalls einer ein Patrizier und einer ein Plebeier sein muß- te.47 48
Die Quindecimviri waren zwar Apollopriester, ihre Hauptaufgabe war je- doch Einsicht in die Sibyllnischen Bücher zu nehmen, welche im Keller des Jupitertempels auf dem Kapitol aufbewahrt wurden, wenn ein Senats- beschluß dieses verlangte.49 50 Die Sibyllnischen Bücher waren geheim und wurden nur aufgrund eines Senatsbeschlußes von den Quindecimviri persönlich eingesehen.51
Sie erhielten Ritualvorschriften griechischer Herkunft, in welchen aufgeführt war, was im Falle von bestimmten Vorzeichen als Sühnung notwendig war.52 53 Diese Handlungen empfahl dann einer der Priester dem Senat mündlich oder schriftlich, wobei sich der Senat allerdings nicht an diese Empfehlungen halten mußte.54
Eine weitere Aufgabe der Quindecimviri bestand in der Aufsicht und Betreuung aller in Rom anerkannten ausländischen Kulte, wobei sie allerdings für diese Kulte nicht selber opfern mußten, da diese meist ihre eigenen Priester mit nach Rom gebracht hatten. Hauptsächlich waren dieses Kulte griechischer Herkunft, wobei ihr besonderes Augenmerk auf dem Kult der Magna Mater ruhte, dessen Priester sich in ihrem Amt von den Quindecimviri offiziell bestätigen lassen mußten.55
3.4. Epulones (Septemviri)
Die Epulones wurden erst im Jahr 196 v. Chr. eingesetzt und waren damit das am spätesten eingerichtete der vier großen Priesterkollegien. Ihre An- zahl betrug zuerst drei56 und wurde später auf sieben erhöht, warum sie in der Literatur auch teilweise als Septemviri bezeichnet werden.57 Ihre Aufgabe war es die Pontifices zu entlasten, indem sie die Durchfüh- rung gewisser Circusspiele, Festzüge und den damit verbundenen Sakral- handlungen übernahmen. Obwohl die Epulones zu den vier bedeutenden Collegia Sacerdotum zählten, blieben sie immer vom Collegium Pontificum abhängig, da dieses ihnen gegenüber im Falle eines Fehlers weisungsbe- fugt war und sie bei Nichtverfügbarkeit auch vertreten konnte.58
4. Priesterliche Sodalitäten
Es gab eine ganze Reihe priesterlicher Sodalitäten, die jeweils Kulthandlungen zu bestimmten Anlässen und Daten oder für bestimmte Gottheiten vornahmen. Diese Sodalitäten waren meistens sehr alt und elitär, jeweils selbständig organisiert und unabhängig von den Collegia Sacerdotum oder dem Collegium Pontificum. Wie bei diesen wurden die Priester aber auf Lebenszeit durch Kooptation, allerdings ohne Volkswahl, eingesetzt.59
4.1. Fetiales
Das Priesterkollegium der Fetiales bestand aus 20 Mitgliedern, deren Aufgabe es war den sakralen Rechtsverkehr zwischen Völkern zu regeln.60 Dabei traten meist zwei Priester zusammen auf und übernahmen die Funktion von Unterhändlern oder Diplomaten.61
Bei völkerrechtlichen Verhandlungen pflückte einer der Fetiales ein Bund heiliger Kräuter, welches er dann einem anderen Mitglied des Kollegiums übergab und ihn so zum Verhandlungsführer machte.62 Kam es zwischen den Verhandlungsführern der beiden Völker zu einem Vertragsschluß, so erschlugen die Fetiales der beiden Völker zusammen ein Ferkel und forderten Jupiter auf, ein eidbrüchiges Volk in gleicher Weise zu schlagen. Falls Forderungen gegen ein anderes Volk erhoben wurden, überbrachten die Fetiales diese im Namen des römischen Volkes dem ersten Mitglied des anderen Volkes, welches sie trafen. Wurden diese binnen 30 oder 33 Tagen nicht erfüllt, kam es zu einer Kriegserklärung durch die Fetiales.63 Diese erfolgte durch einen der Fetiales, der eine heilige Lanze in das gegnerische Gebiet warf. Als die Entfernungen zu gegnerischen Gebieten später immer mehr zunahmen, wurde ein bestimmtes Stück Land neben dem Bellonatempel per Definition zu Feindesland erklärt.64
4.2. Arvales Fratres
Eine der dem bäuerlichen Leben am nächsten stehende Priesterschaft dürfte die der Arvales Fratres gewesen sein, die jedoch in damaliger Zeit nur eine geringe Bedeutung hatte. Die 12 Mitglieder des Priesterkollegi- ums stammten nichtsdestoweniger aus vornehmen Familien und hatten später sogar senatorischen Rang. Die Mitglieder der Priesterschaft wähl- ten aus ihrer Mitte jährlich jeweils einen Magister und einen Flamen, wobei Wiederwahlen möglich waren.65
Der Legende nach wurde die Bruderschaft der Arvales Fratres von den zwölf Söhnen der Amme des Romulus gegründet.66 Tatsächlich stammt der Kult jedoch mindestens aus dem vierten Jahrhundert v. Chr., womit auch das Verbot, Eisen oder mit einer Töpferscheibe hergestellte Töpfe zu benutzen, zusammenhängen dürfte. Mystischer Aufgabenbereich des Kul- tes war der Dank für erhaltene und Fürbitten für bevorstehende Ernten,67 sowie konkret die Ausübung des damit verbundenen Kultes der Dea Dia, der Göttin des auf den Feldern ausreifenden Getreides.68 Entsprechend war der Hauptsitz des Kultes der Hain der Dea Dia in der Nähe von Rom, der von den Mitgliedern der Priesterschaft betreut wurde. Hier wurde auch jeweils Ende Mai ein dreitägiges Fest zu Ehren der Dea Dia veranstaltet. Hauptbestandteile des Festes waren die Opferung eines Lammes, das Aufsagen eines bestimmten, sehr alten Gedichtes, sowie kultische Darstellungen des Reifeprozesses von Getreideähren. Danach fanden im dem dem Hain zugehörigen Circus Spiele mit Wagenrennen statt. Neben dieser Hauptaufgabe nahmen die Priester über das Jahr hin- weg Sühneopfer vor, die Aufgrund der im Hain durchgeführten Arbeiten notwendig wurden.69
4.3. Curionen
Eine ebenfalls sehr alte Priesterschaft war die der Curionen. Ein Curio war der Vorsteher einer Curie, von denen es 30 gab und die der Legende nach von Romulus eingeteilt worden waren.70 Ihre militärische und politische Funktion war mit der Zeit in Vergessenheit geraten, so daß nur noch die religiösen Aufgaben blieben.71 72
Geführt wurden die Curionen von einem Curio Maximus.73 Dieser mußte männlich, mindestens 50 Jahre alt, körperlich unversehrt und äußerst wohlhabend sein. Die Curionen verehrten die Göttin Juno, sowie eine zu- sätzliche jeweils differierende Gottheit. Die damit verbundenen Opferze- remonien und Gastmähler fanden im Versammlungsraum des jeweiligen Curiengebäudes statt. Durchgeführt wurden die Opferzeremonien von dem dafür gewählten Flamen Curialis der entsprechenden Curie.
Wichtigstes Fest der Curien waren die Fornacalia, die von jeder Curie je- weils für sich Mitte Februar gefeiert wurden. Bei allen Zeremonien war es vorgeschrieben, daß neben den Curionen, welche die Sippenvorsteher repräsentierten, Frauen und Kinder anwesend waren, um so eine Art Fa- milienatmosphäre zu schaffen.74
5. Haruspices
Das Kollegium der Haruspices, dem ein Haruspex Primus oder Maximus vorstand, wurde im dritten Jahrhundert v. Chr. gegründet und bestand aus 60 Priestern, welche alle etruskischer Herkunft sein mußten. Aufgrund dessen blieb die Priesterschaft, im Vergleich zu anderen Kollegien, die gesamte Zeit ihres Bestehens über relativ unabhängig und wurde nie zu den Collegia Sacerdotum gerechnet. Der Aufnahmemodus der Priester- schaft ist nicht genau bekannt. Sicher ist allerdings, daß eine Art Erbfolge innerhalb bestimmter etruskischer Familien eine Rolle spielte.75
Die Haruspices waren keine Opferpriester. Ihr Aufgabenbereich war ne- ben der Auskunft über die Verfahrensweise mit vom Blitz getroffenen Menschen oder Dingen die Disciplina Etrusca.76 77 Diese bestand aus Le- berschau und Blitzdeutung, wobei Vorzeichen zu geplanten Vorhaben an- hand der Leber eines Opfertieres oder des Himmels gewonnen wurden. Leber bzw. Himmel waren dabei in verschiedene Bereiche aufgeteilt, wel- che bestimmten Göttern zugeordnet wurden. Im Unterschied zu Auguren oder Quindecimviri gaben die Haruspices aber nicht nur Auskünfte über notwendige Sühneopfer, sondern prophezeiten auch Ereignisse in der Zu- kunft.78
Der Haruspex formulierte nach einer Anforderung durch den Senat an- hand von gewonnenen Vorzeichen eine Empfehlung für deren Sühnung oder eine Vermutung über ihre Bedeutung. Diese Empfehlung trug er dann dem Senat vor, ohne daß dieser jedoch daran gebunden war. Mit den eventuell danach durchzuführenden Sühneriten hatten die Haruspices nichts zu tun. Diese wurden von anderen Priestern übernommen.
Eine weitere Möglichkeit des Einsatzes der Haruspices war die permanen- te Unterstützung eines hohen Staatsbeamten, den sie vor wichtigen Entscheidungen durch ihre Vorzeichendeutung berieten.79 Obwohl sie in frü- herer Zeit einen nur geringen Einfluß hatten, wurden die Haruspices später dem Kollegium der Auguren oft vorgezogen, da ihre Methode der Vorzeichengewinnung einfacher als die der Auguren war. Neben den 60 offiziellen Haruspices gab es zusätzlich eine Vielzahl inoffizieller Priester,80 welche die Leberschau für Privatpersonen vornahmen.81
6. Fazit
Abschließend läßt sich sagen, daß es zwischen den einzelnen Priesterkol- legien große Unterschiede in Bezug auf Aufbau, Aufgabenbereich und Einflußmöglichkeit gab. Außerdem entstanden die verschiedenen Pries- terschaften aus sehr unterschiedlichen historischen Zusammenhängen und haben innerhalb des Zeitraums ihres Bestehens, was ihre Bedeut- samkeit und Betätigungsfelder angeht, teilweise gravierende Veränderun- gen erfahren. Hinzu kommt, daß die formalen Hierarchien oft nicht mit den tatsächlichen Abhängigkeitsverhältnissen übereinstimmten.
Dieses machte es zusammen mit den zum Teil sehr komplexen Strukturen der Priesterschaften schwierig eine logische Gliederung aufzubauen, zumal vor allem innerhalb der Collegia Sacerdotum die Beziehungen zwischen den einzelnen Kollegien sehr vielschichtig waren und so eine eindeutige Strukturierung erschweren.
7. Quellenverzeichnis
Marcus Tullius Cicero, Über die Wahrsagung, Christoph Schäubling (Hrsg.), München, 1991.
The Attic Nights of Aulus Gellius, John C. Rolfe (Hrsg.), London, 1946.
Titus Livius, Römische Geschichte, Hans J. Hillen (Hrsg.), München, Zürich, Düsseldorf, 1974-1994.
Caius Plinius Secundus d. Ä., Naturkunde, Roderich König (Hrsg.), Buch 18, Zürich, 1995.
Varro on the Latin language, Roland G. Kent (Hrsg.), Bd. 1, London, 1938.
8. Literaturverzeichnis
Brique, Dominique: Augures, NP, Bd. 2, 1997, Sp. 279-281.
Eisenhut, Werner: Arvales fratres, KP, Bd. 1, 1979, Sp. 629-631. Eisenhut, Werner: Fetiales, KP, Bd. 2, 1979, Sp. 541-542. Eisenhut, Werner: Flamines, KP, Bd. 2, 1979, Sp. 560-562. Eisenhut, Werner: Haruspices, KP, Bd. 2, 1979, Sp. 945-947.
Gigon, Olof: Altrömische Kultur, Handbuch der Weltgeschichte, A. Randa (Hrsg.), Bd. 1, Freiburg i. Br., 1962, 3. Aufl.
Latte, Kurt: Römische Religionsgeschichte, München, 1967, 2. Aufl.
Le Bonniec, H.: Auguren, LAW, Bd. 1, 1991, Sp. 398-399.
Le Bonniec, H.: Fratres Arvales, LAW, Bd. 1, 1991, Sp. 997-998.
Le Bonniec, H.: Pontifices, LAW, Bd. 2, 1991, Sp. 2409-2410.
Le Bonniec, H.: Septemviri epulones, LAW, Bd. 3, 1991, Sp. 2780.
Linke, Bernhard: Curiae, NP, Bd. 3, 1997, Sp. 238-239.
Muth, Robert: Einführung in die griechische und römische Religion, Darmstadt, 1998, 2. Aufl.
Prescendi, Francesca: Fetiales, NP, Bd. 4, 1998, Sp. 496-497. Prescendi, Francesca: Flamines, NP, Bd. 4, 1998, Sp. 537-538.
Radke, Gerhard: Quindecimviri sacris faciundis, KP, Bd. 4, 1979, Sp. 1304-1306.
Radke, Gerhard: Rex sacrorum, KP, Bd. 4, 1979, Sp. 1387-1389.
Rosenberg, Arthur: Rex sacrorum, RE, Reihe 2, Halbbd. 1, 1972, Sp. 721- 726.
Scheid, John: Arvales fratres, NP, Bd. 2, 1997, Sp. 67-69.
Wissowa, Georg: Religion und Kultus der Römer, München, 1902. Ziegler, Konrat: Pontifex, KP, Bd. 4, 1979, Sp. 1046-1048.
[...]
1 O. Gigon., Altrömische Kultur, Handbuch der Weltgeschichte, A. Randa (Hrsg.), Bd. 1, Freiburg i. Br., 1962, 3. Aufl., Sp. 511.
2 R. Muth, Einführung in die griechische und römische Religion, Darmstadt, 1998, 2. Aufl., S. 289.
3 G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, München, 1902, S. 410f.
4 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, München, 1967, 2. Aufl., S. 18ff. u 394.
5 G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, a.a.O., S. 425ff. 5
6 G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, a.a.O., S. 414ff.
7 Cic. div. 1, 2, 30, 107.
8 Liv. 10, 6, 6ff.
9 H. Le Bonniec, Auguren, LAW, Bd. 1, 1991, Sp. 398-399.
10 Liv. 1, 36, 4ff.
11 D. Brique, Augures, NP, Bd. 2, 1997, Sp. 279-281.
12 Liv. 1, 18, 6ff.
13 D. Brique, Augures, a.a.O.
14 G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, a.a.O., S. 454ff.
15 Ebd., S. 432ff.
16 R. Muth, Einführung in die griechische und römische Religion, a.a.O., S. 293.
17 K. Ziegler, Pontifex, KP, Bd. 4, 1979, Sp. 1046-1048.
18 Liv. 25, 5, 2.
19 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, a.a.O., S. 402. 7
20 Liv. 40, 42, 10.
21 Varro ling. 5, 83.
22 K. Ziegler, Pontifex, a.a.O.
23 Liv. 41, 16, 2.
24 G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, a.a.O., S. 441ff.
25 H. Le Bonniec, Pontifices, LAW, Bd. 2, 1991, Sp. 2409-2410.
26 Liv. 27, 36, 5.
27 Gell. 10, 15, 21.
28 Liv. 40, 42, 8ff.
29 R. Muth, Einführung in die griechische und römische Religion, a.a.O., S. 295.
30 Liv. 2, 2, 1f.
31 A. Rosenberg, Rex sacrorum, RE, Reihe 2, Halbbd. 1, 1972, Sp. 721-726.
32 W. Eisenhut, Flamines, KP, Bd. 2, 1979, Sp. 560-562.
33 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, a.a.O., S. 402f.
34 W. Eisenhut, Flamines, KP, a.a.O.
35 Varro ling. 5, 84.
36 F. Prescendi, Flamines, NP, Bd. 4, 1998, Sp. 537-538.
37 Plin. nat. 18, 119.
38 Gell. 1, 10, 15.
39 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, a.a.O., S. 402f.
40 F. Prescendi, Flamines, a.a.O.
41 Gell. 1, 12.
42 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, a.a.O., S. 108ff.
43 R. Muth, Einführung in die griechische und römische Religion, a.a.O., S. 255ff.
44 Liv. 1, 20, 3.
45 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, a.a.O., S. 110 u. 402. 11
46 Liv. 6, 37, 12.
47 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, a.a.O., S. 397f.
48 Liv. 10, 8, 2ff.
49 Liv. 22, 9, 8ff.
50 Liv. 36, 37, 3f.
51 G. Radke, Quindecimviri sacris faciundis, KP, Bd. 4, 1979, Sp. 1304-1306.
52 Liv. 10, 47, 7.
53 Liv. 37, 3, 5.
54 G. Radke, Quindecimviri sacris faciundis, a.a.O.
55 G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, a.a.O., S. 461ff. 12
56 Liv. 33, 42, 1.
57 H. Le Bonniec, Septemviri epulones, LAW, Bd. 3, 1991, Sp. 2780.
58 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, a.a.O., S. 398f.
59 R. Muth, Einführung in die griechische und römische Religion, a.a.O., S. 300.
60 Varro ling. 5, 86.
61 W. Eisenhut, Fetiales, KP, Bd. 2, 1979, Sp. 541-542. 13
62 Liv. 1, 24, 4ff.
63 Liv. 1, 32, 6ff.
64 F. Prescendi, Fetiales, NP, Bd. 4, 1998, Sp. 496-497.
65 W. Eisenhut, Arvales fratres, KP, Bd. 1, 1979, Sp. 629-631.
66 H. Le Bonniec, Fratres Arvales, LAW, Bd. 1, 1991, Sp. 997-998.
67 Varro ling. 5, 85.
68 W. Eisenhut, Arvales fratres, a.a.O.
69 J. Scheid, Arvales fratres, NP, Bd. 2, 1997, Sp. 67-69.
70 Liv. 1, 13, 6.
71 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, a.a.O., S. 399f.
72 Varro ling. 5, 83.
73 Liv. 27, 8, 1.
74 B. Linke, Curiae, NP, Bd. 3, 1997, Sp. 238-239.
75 K. Latte, Römische Religionsgeschichte, a.a.O., S. 396f.
76 Cic. div. 1, 92.
77 Liv. 27, 37, 6ff.
78 G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, a.a.O., S. 470f.
79 Cic. div. 2, 51f.
80 Cic. div. 1, 132.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments über römische Priesterschaften?
Dieses Dokument ist eine umfassende Darstellung der wichtigsten Priesterämter im vorkaiserlichen Rom. Es behandelt die Entstehung, Organisation, Aufgaben und Bedeutung verschiedener Priesterkollegien und priesterlicher Sodalitäten.
Welche Priesterschaften werden in diesem Text behandelt?
Der Text behandelt unter anderem Auguren, Pontifices (mit Pontifex Maximus, Rex Sacrorum, Flamines und Vestalinnen), Quindecimviri Sacris Faciundis, Epulones, Fetiales, Arvales Fratres und Curionen. Es wird auch auf die Haruspices eingegangen.
Wie waren die Priesterschaften organisiert?
Es gab Collegia Sacerdotum (Priesterkollegien) und priesterliche Sodalitäten. Collegia Sacerdotum wie Pontifices und Auguren galten als wichtiger und ehrenvoller. Die Sodalitäten waren meist älter, elitärer und unabhängig von den Kollegien. Die Aufnahme erfolgte in der Regel durch Kooptation, also durch Wahl der bestehenden Mitglieder.
Welche Rolle spielten die Auguren?
Die Auguren interpretierten göttliche Vorzeichen, um Auskunft über die Wohlgesinntheit Jupiters gegenüber bevorstehenden Vorhaben zu geben. Sie nutzten Blitz und Donner, Vogelflug, das Verhalten heiliger Hühner und andere Zeichen, um ihre Vorhersagen zu treffen. Ihre Tätigkeit konnte ein politisches Machtinstrument sein.
Was war die Aufgabe des Collegium Pontificum?
Das Collegium Pontificum umfasste Pontifices, Rex Sacrorum, Flamines und Vestalinnen. Der Pontifex Maximus hatte den Vorsitz und die Oberaufsicht über die anderen Mitglieder und deren Aufgaben. Die Pontifices überwachten die korrekte Ausführung sakraler Handlungen und erstellten Gutachten zu sakralen Angelegenheiten.
Wer war der Rex Sacrorum?
Der Rex Sacrorum war der sakrale Nachfolger des Königs und übernahm dessen kultische Aufgaben. Er stand formal an der Spitze der Priesterhierarchie, war aber von politischer oder militärischer Macht ausgeschlossen, um eine Wiederherstellung des Königtums zu verhindern.
Welche Funktion hatten die Flamines?
Die Flamines waren Priester, die für die Verehrung bestimmter Gottheiten zuständig waren. Es gab Flamines Maiores für die Götter Jupiter, Mars und Quirinus und Flamines Minores für weitere Gottheiten. Der Flamen Dialis (Jupiterpriester) nahm eine Sonderstellung ein und unterlag strengen rituellen Vorschriften.
Was waren die Aufgaben der Vestalinnen?
Die Vestalinnen waren sechs adelige Töchter, die 30 Jahre lang im Tempel der Vesta dienten. Sie hielten das heilige Stadtfeuer am Brennen und führten rituelle Handlungen durch. Sie waren zur Keuschheit verpflichtet.
Wer waren die Quindecimviri Sacris Faciundis?
Die Quindecimviri waren eine Priesterschaft, die in die Sibyllinischen Bücher Einsicht nahm, um Ritualvorschriften für die Sühnung bestimmter Vorzeichen zu erhalten. Sie hatten auch die Aufsicht über ausländische Kulte in Rom.
Was taten die Epulones?
Die Epulones wurden eingesetzt, um die Pontifices zu entlasten, indem sie die Durchführung gewisser Circusspiele, Festzüge und die damit verbundenen Sakralhandlungen übernahmen.
Welche Rolle spielten die Fetiales?
Die Fetiales regelten den sakralen Rechtsverkehr zwischen Völkern. Sie traten als Unterhändler und Diplomaten auf und waren für Kriegserklärungen zuständig.
Was waren die Arvales Fratres?
Die Arvales Fratres waren eine Priesterschaft, die dem bäuerlichen Leben nahestand. Sie waren für den Kult der Dea Dia zuständig, der Göttin des auf den Feldern ausreifenden Getreides, und führten Rituale für eine gute Ernte durch.
Wer waren die Curionen?
Die Curionen waren Vorsteher von Curien, alten politischen und militärischen Einheiten. Sie verehrten die Göttin Juno und führten Opferzeremonien durch.
Was war die Aufgabe der Haruspices?
Die Haruspices waren etruskische Priester, die die Disciplina Etrusca praktizierten. Sie deuteten Vorzeichen anhand der Leber von Opfertiereren oder des Himmels und prophezeiten zukünftige Ereignisse.
- Arbeit zitieren
- Lars Thiede (Autor:in), 1999, Die wichtigsten stadtrömischen Priesterämter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104934