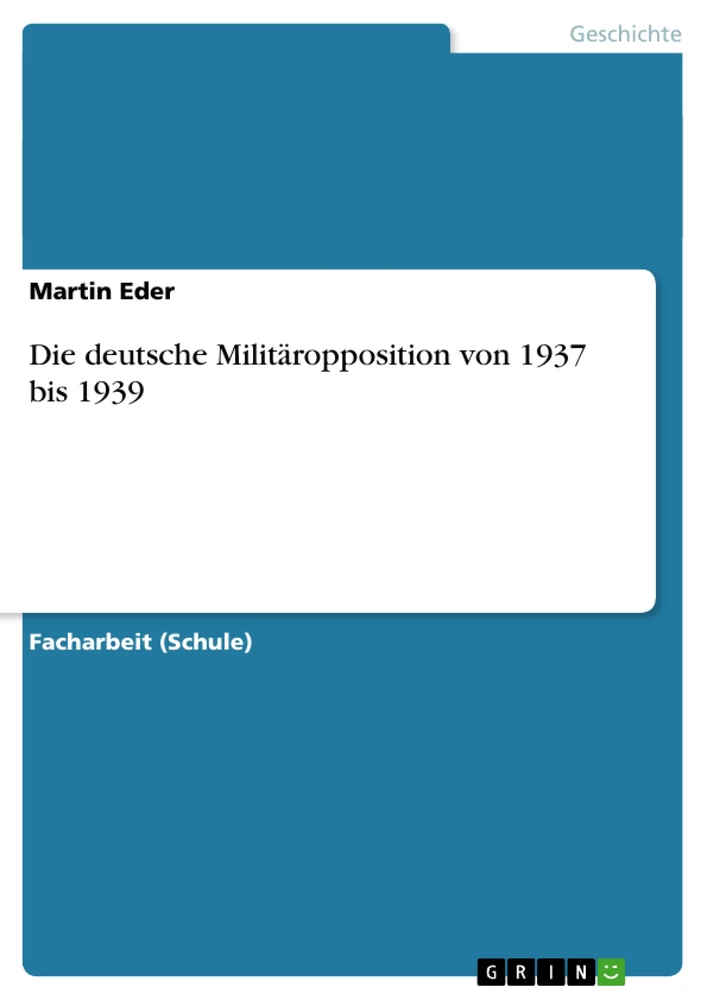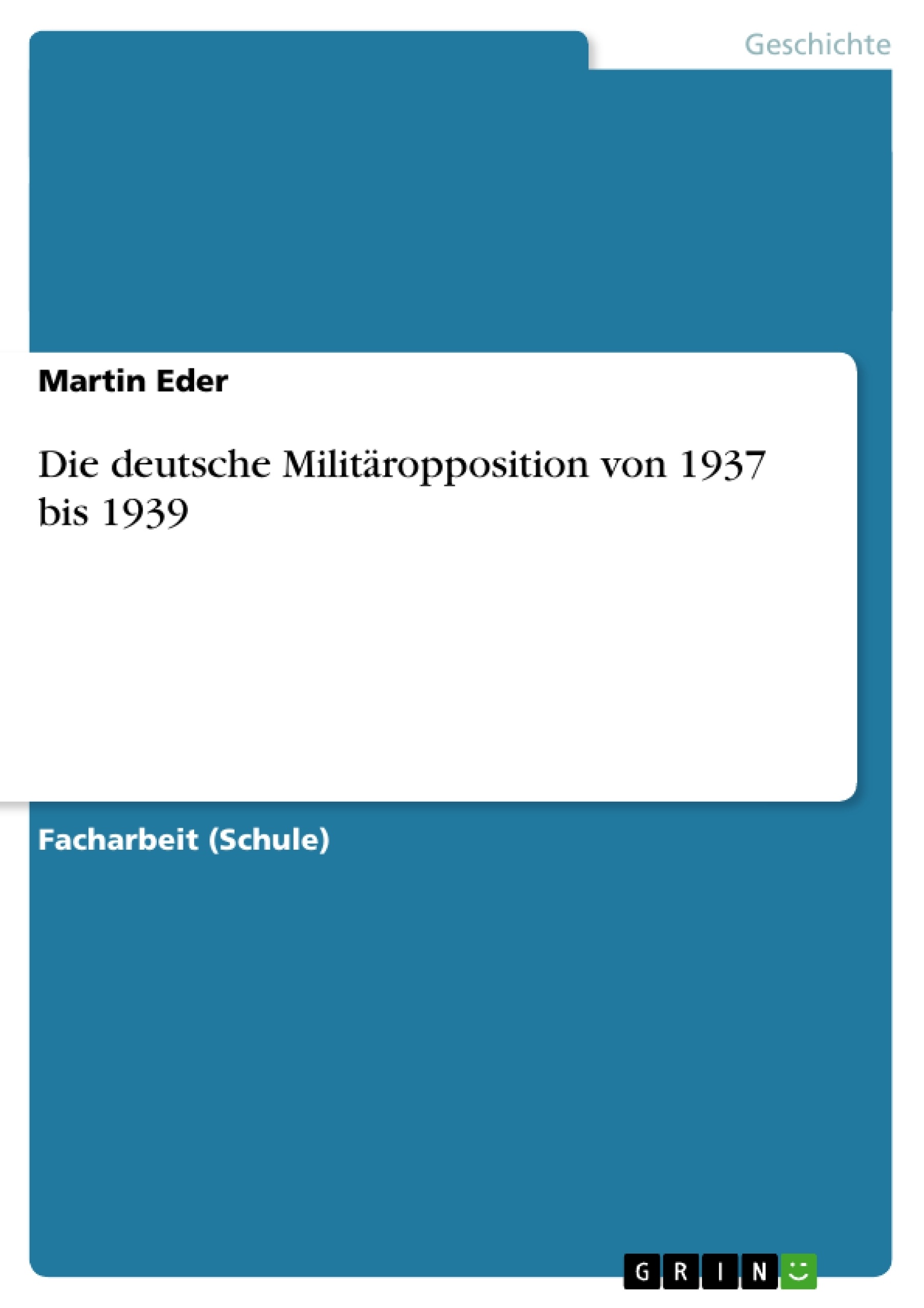Gliederung
1. Widerstand gegen Hitler
a) Hintergründe
b) Träger des Widerstandes
c) Beginn des Widerstandes
2. „Hoßbach-Protokoll“
3. „Blomberg-Fritsch-Krise“
4. Krise im Herbst 1938
a) Hitlers Angriffsplan gegen die Tschechoslowakei
b) Verbindungen zu England
c) „Aktionsplan Halder-Witzlweben-Oster“
5. Polenfeldzug
a) Denkschrift an Keitel
b) „Aktionsplan Hammerstein“
6. Haltung der Marine
7. Schlussbemerkung
1. Widerstand gegen Hitler
1 a) Hintergründe
Wenn von der Widerstandsbewegung gegen das Hitler-Regime die Rede ist, denkt man sofort an den 20. Juli 1944. Der Aufstandsversuch vom 20. Juli 1944 ist sicher die wichtigste und hervorstechendste Aktion der deutschen Widerstandsbewegung gewesen, aber ihre Geschichte erschöpft sich bei weitem nicht in dieser Tat und ihrer Vorgeschichte. Im weitesten Sinne genommen stellt die deutsche Widerstandsbewegung eine Summe von Einzel- und Gruppenaktionen gegen dass totalitäre Regime dar, an denen im ganzen Tausende, wenn nicht Zehntausende von Menschen beteiligt gewesen sind. Sicher ist die Opposition gegen Hitler nicht das gewesen, was man eine Massenbewegung nennt. Sie war aber ebenso wenig Angelegenheit einiger weniger unzufriedener Frondeure und Putschisten in Armee, Staat und Partei.
Widerstand gegen das Regime konnte sich in sehr verschiedenen Formen äußern. Neben der geistig-theoretischen Seite, die das Regime selbst geistig in Frage stellte durch die Radikalität seines politischen Denkens, gab es die politisch-militärische Opposition gegen Hitler, die sich die Beseitigung des Regimes zum Ziele gesetzt hatte. Diese politisch-militärische Opposition kam zustande, als hohe Offiziere schon sehr bald eine Weltkriegskatastrophe und damit das Ende Deutschlands voraussahen, wenn Hitlers zugleich dilettantische und verbrecherische Kriegspläne verwirklicht würden.
1 b) Träger des Widerstandes
Schon früh besteht bei den zivilen Gegnern die Einsicht, dass dem Regime Hitlers nur durch die Wehrmacht, den bewaffneten Arm des Staates, beizukommen ist. Als sich angesichts der Kriegsvorbereitungen Hitlers in militärischen Kreisen Widerstand bemerkbar machte, war der Kontakt bald hergestellt. Schon bald war der zivile und militärische Widerstand vereinigt, dieser um General Ludwig Beck, jener um Carl Friederich Goerdeler, dem ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister, zentriert. Diese beiden Männer kann man als die Häupter der Opposition bezeichnen. Aber auch die Generäle Halder, v. Witzleben, v. Stülpnagel und Hoepner, der Oberst Hans Oster und viele andere stellten sich der Widerstandsbewegung zur Verfügung.
„In dieser Hinsicht gründete sich unsere Hoffnung auf den Generaloberst Freiherrn von Fritsch, den Chef der Heeresleitung. Er war Antinazi. Gleich ihm waren Generaloberst Beck, damals Chef des Generalstabes des Heeres, und General Thomas, der Chef der Wehrwirtschaft, entschlossene Gegner Hitlers. Beide standen im Kontakt mit Hitlergegnern aus zivilen Kreisen, insbesondere mit dem früheren Leipziger Oberbürgermeister Dr. Goerdeler.“ [1]
1 c) Beginn des Widerstandes
Will man einen Beginn der Militäropposition feststellen, so kann man mit großer Wahrscheinlichkeit die Feststellung treffen, dass sie zum ersten mal sichtbar wird in der sachlichen Meinungsverschiedenheit zwischen dem Diktator und den leitenden Militärs anlässlich der Besetzung der entmilitarisierten Westzone. Die großen innen- und außenpolitischen Erfolge, die Hitler wider alles und auch sein eigenes Erwarten in so überraschendem Ausmaß errungen hatte, bestärkten sein Sendungsbewusstsein und Machtgefühl umso mehr, als er gerade in der Außenpolitik seine Erfolge vielfach gegen den Rat und die Bedenken der Fachleute davongetragen hatte. Umgekehrt aber wurden die Bedenken gerade seiner militärischen Ratgeber dadurch in keiner Weise beseitigt. Auf diese Weise verschärfte sich die Spannung zwischen dem erfolgreichen Diktator und den besorgten Generälen. Die Kluft zwischen ihnen wurde durch die überraschenden Erfolge nicht verkleinert, sondern vergrößert. „Es war die Kluft zwischen dem hasardierenden Abenteurer und den verantwortungsbewussten und nüchtern denkenden Generlstäblern.“ [2]
2. „Hoßbach-Protokoll“
Im Herbst 1937 hielt Hitler den Zeitpunkt für gekommen, das Schwergewicht seiner Dynamik von der Innen- auf die Außenpolitik zu verlegen. Die Sitzung, die am 5. November 1937 in der Reichskanzlei stattfand und als „Hoßbach-Protokoll“ bekannt wurde, sollte ursprünglich Rüstungsfragen gelten. Statt dessen legte Hitler den „Spitzen“ der Wehrmacht - Reichskriegsminister von Blomberg, Chef der Heeresleitung von Fritsch, Oberbefehlshaber der Marine Raeder, Oberbefehlshaber der Luftwaffe Göring - und dem Reichsaußenminister von Neurath seine Beurteilung der politischen Lage und seine Zukunftspläne dar, die er selbst als seine testamentarische Hinterlassenschaft im Falle seines Ablebens bezeichnete. Hitler stieß aber mit seinen Ausführungen über die Notwendigkeit eines baldigen Krieges zur Sicherung des deutschen Lebensraumes auf den Widerspruch des Reichskriegsministers, des Chefs der Heeresleitung und des Außenministers. Generaloberst von Fritsch forderte eine weitere Unterredung mit Hitler, die am 9. November stattfand. Erneut brachte der Oberbefehlshaber des Heeres seine Einwände gegen Hitlers Kriegspläne zur Sprache. Als Außenminister von Neurath ebenfalls noch einmal vorzusprechen suchte, um Hitler gegenüber seine Bedenken zu wiederholen, verschob dieser, aufs höchste gereizt, die Audienz bis Mitte Januar 1938. Wenige Wochen später zog Hitler die Konsequenzen durch grundlegende Veränderungen in der militärischen und außenpolitischen Führung. „Er entließ die widerspenstigen Berater und suchte sich als ihre Nachfolger gefügigere Werkzeuge aus.“ [3]
3. „Blomberg-Fritsch-Krise“
Hitler glaubte, die sachlichen Meinungsverschiedenheiten durch Personalwechsel ausschalten zu können. Die Reaktion auf sein Vorgehen aber steigerte die sachlichen Differenzen zur Opposition führender Militärs. Ein deutliches Beispiel dafür ist die sogenannte „Fritsch- Krise“, die sich im Winter 1937/38 ereignete.
Die „Fritsch-Krise“ begann wahrscheinlich schon 1937 mit dem Besuch der deutschen Herbstmanöver durch Mussolini, der Hitler zum Bewusstsein brachte, wie sehr es seine Autorität verstärken würde, wenn er, ähnlich wie der Duce, selbst Oberbefehlshaber der Wehrmacht würde. Hitler legte jetzt zum ersten Mal offen seine Kriegspläne zur Eroberung der Tschechoslowakei und Österreichs vor den Spitzen der Wehrmacht und dem Außenminister Baron Neurath in jener Besprechung vom 5. November 1937, die durch das sogenannte „Hoßbach-Protokoll“ bekannt geworden ist, dar. Bei den fünf Zuhörern zeigte sich aber keine Spur von Kriegsbegeisterung, nur Göring stimmte vorbehaltlos zu. Fritsch und vor allem Blomberg erhoben ernste Bedenken, und so gab es zwischen ihnen und Göring eine sehr scharfe Auseinandersetzung.
Im Januar 1938 gab es dann um General Blomberg einen Heiratsskandal, der ihn als Wehrminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht unmöglich machte.
Es war allerdings Görings Absicht, Blomberg zu stürzen, um sich an seine Stelle zu setzen. Gleichzeitig wurden alte, bereits beiseite gelegte Polizeiakten hervorgezogen und gegen Fritsch verwendet, wobei ihm vorgeworfen wurde, dass er homosexuelle Verfehlungen begangen habe. Diese Aktion wird in den Geschichtsbüchern ebenfalls als „gemeine Intrige nationalsozialistischer Hintermänner, in erster Linie wohl Göring selbst“ [4] geschildert.
Hitler hat die Gelegenheit benutzt, sich nicht nur Blombergs, sondern auch des unbequemen Fritsch sehr rasch - noch vor dem Kriegsgerichtsurteil - zu entledigen. „Er selbst hat damals angedeutet, dass ihn beide auch durch ihre militärische Haltung enttäuscht hätten: beide hatten sich ja am 5. November seinen kriegerischen Plänen unzugänglich gezeigt, Fritsch hatte sich überdies in Fragen des Einsatzes der Panzerwaffe als sehr konservativ erwiesen und einem allzu raschen Tempo der Aufrüstung widerstrebt.“ [5] Die Hauptsache war für Hitler doch, dass er seine abenteuerlichen Kriegspläne unbehindert durch Bedenken der Fachleute nun durchführen konnte. Und so griff er mit Freuden jetzt die von Blomberg selbst, wohl aus Haß gegenüber seinen Kameraden, ihm vorgeschlagenen Lösung der Kommandofrage auf: er übernahm selbst die militärische Führung der Wehrmacht, wobei er nur von Keitel als Chef des Oberkommandos gestützt wurde. „Keitel war aber ein Durchschnittskopf und ein kompromissbereiter, ja charakterloser, Mensch, der bald zu völliger Hörigkeit absinken sollte.“ [6]
4. Krise im Herbst 1938
4.a) Hitlers Angriffsplan gegen die Tschechoslowakei
Auf diesen Vorfall hin verdichtete sich Hitlers Angriffsplan gegen die Tschechoslowakei, der Ende Mai 1938 in der Weisung „Grün“ als unabänderlicher Entschluß festgelegt wurde. Im selben Maße wuchsen aber auch die Gewissensbedenken des Generalstabschefs Beck gegenüber einer Katastrophenpolitik. In drei tiefgreifenden Denkschriften hat der Generalstabschef gegenüber dem Oberbefehlshaber des Heeres, von Brauchitsch, dem Nachfolger von Fritsch, seinen Widerspruch entwickelt und ihn durch mündliche Vorträge ergänzt. In Ausführungen vom 16. Juli finden sich die seitdem oft zitierten Worte von der „Grenze“ des soldatischen Gehorsams: „Es ist ein Mangel an Größe und an Erkenntnis der Aufgabe, wenn ein Soldat in höchster Stellung in solchen Zeiten seine Pflichten und Aufgaben nur in dem begrenzten Rahmen seiner militärischen Aufträge sieht, ohne sich der höchsten Verantwortung vor dem gesamten Volk bewusst zu werden. Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnlich Handlungen.“ [7]
Der Widerstand, der bei Beck so zu Worte kam, sollte sich indessen nicht auf die Kritik vom Standpunkt des Sachverständigen oder auf rein militärischen Widerstand beschränken, die von Beck zunächst als solidarische Verweigerung der Mitwirkung am Kriegsplan seitens der höheren Führung geplant war. Schon die Vortragsnotiz vom 16. Juli rechnete darüber hinaus mit „innenpolitischen Spannungen“. Am 29. Juli hieß es dann deutlicher: „Das Heer müsse sich nicht nur auf einen möglichen Krieg, sondern auch auf eine innere Auseinandersetzung, die sich nur in Berlin abzuspielen braucht, vorzubereiten. Es seien entsprechende Aufträge zu erteilen, wobei von Witzleben, der kommandierende General in Berlin, und der Polizei- präsident, Graf Helldorf, genannt wurden“ [8]
Diesen Vortrag vom 29. Juli 1938 hat man mit Recht als ersten Keim für eine Staatsstreichplanung bezeichnet, die von Becks Nachfolger Halder fortgesetzt worden ist. Insbesondere die Berater des Generalstabschefs im Nachrichten- und Abwehrdienst waren der Ansicht, wenn das deutsche Volk über die immer deutlicher werdende, verhängnisvolle Perspektive einer Aggressionspolitik aufgeklärt würde, so würde der „Zauber“ weichen, den die Folge der außenpolitischen Errungenschaften Hitlers - von der Erlangung der Wehrfreiheit über die Rheinlandbesetzung bis zum Anschluß hin - auf viele ausgeübt hatte. Wenn die Politik des Regimes sich als unzweifelhaft auf den Krieg lossteuernd erwies, dann würde es leicht sein, sie zu stürzen. Die verschiedenen Gruppen von Verschwörern, die sich seit 1937 einander genähert hatten, waren sich in diesen Folgerungen einig. Sie beschlossen, nicht nur alles zu tun, um einen europäischen Krieg zu verhindern. Darüber hinaus sahen sie in der Bedrohung des Friedens eine einmalig günstige Gelegenheit, sich eine breite Front der Unterstützung für einen Staatsstreich zu sichern.
Es besteht kein Zweifel, dass ihre Analyse der öffentlichen Meinung zutraf. Das Volk auf der Straße, das nach einem Wunschbild und ohne Kenntnis der inneren Zusammenhänge urteilte, feierte den britischen Premierminister als den „Friedensbringer in unserer Zeit“ [9] genauso begeistert, wie es die englische Öffentlichkeit tat.
Es ereigneten sich noch andere auffallende Dinge. Als Hitler am 27. September, im Sinne einer drohenden Geste, aber wohl auch um die Stimmung zu erproben oder zu heben, eine der neuen Panzerdivisionen durch Berlin marschieren ließ, wurde diese Demonstration ,mit eisigem Schweigen beantwortet. Ähnlich erging es Hitler selbst, als er sich auf dem Balkon der Reichskanzlei dem Volk zeigte. Die gewohnte Huldigung blieb aus. Auf dem Höhepunkt der internationalen Spannung waren deutliche Anzeichen für eine schwere Vertrauenskrise des Regimes erkennbar.
Ob das von den Verschwörern in vollem Umfang vorausgesehen wurde, steht dahin.
Jedenfalls rechneten sie mit einem Rückschlag, der entweder zum Nachgeben und damit zum Gesichtsverlust des Diktators führen, oder, wenn er auf dem Weg zur Katastrophe fortschreiten würde, es möglich machen würde, ihn als Kriegstreiber vor Gericht zu stellen. Neben den schon von Beck genannten und für die Machtlage in Berlin entscheidenden Persönlichkeiten - von Witzleben und Graf Helldorf, und auch noch dessen Stellvertreter Graf Fritz Dietloff von der Schulenburg - hatte man den Stadtkommandanten von Potsdam, Graf Brockdorff-Ahlefeldt, für die Verschwörung gewonnen. Zudem stand in Thüringen eine Panzerdivision unter General Hoepner bereit, die einen möglichen Versuch zum Entsatz Berlins von seiten der Münchener Leibstandarte auffangen sollte.
Man kann nicht sagen, dass die Pläne vom technischen Standpunkt aus mangelhaft waren, oder dass nicht genug Kräfte zur Verfügung standen, um den Putsch durchzuführen. Die Schwäche des Plans lag vielmehr in der Annahme, die westlichen Demokratien würden sich Hitlers Vorgehen gegen die Tschechoslowakei widersetzen und dadurch die drohende Gefahr eines allgemeinen Krieges sichtbar machen. Es wurde jedoch alles Mögliche getan, um wenigstens England zu einer solchen Handlung zu bewegen.
4 b) Verbindungen zu England
Dies führt zur politischen Seite dieser Aktion. Goerdeler, der es im Sommer 1937 in England nicht an Warnungen hatte fehlen lassen, war in diesem Stadium unbeteiligt. Er befand sich von August bis Oktober 1938 auf Reisen. Die im August einsetzende außenpolitische Initiative ging teils von der Abwehr, teils vom Widerstandskreis in der Wilhelmstraße aus und hat zu Schritten sehr ungewöhnlicher Art geführt.
Ein gewisses Vorspiel mag man darin erblicken, dass der Rittmeister a.D. von Koerber im Laufe des August mehrmals mit dem Militärattachè der britischen Botschaft in Berlin in Verbindung trat und unter Andeutung monarchistischer Restaurationspläne erklärte, der Umsturz müsse zwar von innen geschehen, könnte aber von außen unterstützt werden. “Diese reichlich naiv erscheinende Anregung einer Unterstützung von außen wird in ihrem konkreten Bezug deutlicher und gewinnt ihre eigentliche politische Dimension durch den Auftrag, den der früher bereits erwähnte preußische Junker Ewald von Kleist übernahm und im August 1939 ausführte. Schon 1932 hatte er eine Schrift geschrieben `Der Nationalsozialismus - Eine Gefahr`. Aus Protest gegen das Eindringen der `Deutschen Christen` in die Schmenzinger Gemeinde war er 1935 der Bekennenden Kirche beigetreten. Von Anfang an entschlossen zum Widerstand scheute er sich nicht, sein Leben einzusetzen.“ [10]
Wenn Kleist die ihm vorschwebende Mission nach London übernehmen wollte, dann hieß es für ihn in der Tat, den Kopf in die Schlinge zu stecken. Kleist besprach seinen Plan mit dem Berliner Korrespondenten des London Chronicle Jan Colvin, der bereit war, den Besuch durch einen Brief an Lord Lloyd vorzubereiten. Kleists Plan wurde von den Männern der Abwehr, Canaris und Oster, zu denen er durch seinen Schwager Zutritt hatte, lebhaft begrüßt. Kleist wurde durch Canaris auch Beck zugeführt., der daraufhin gesagt haben soll: „Bringen sie mir den sicheren Beweis, dass England kämpfen wird, wenn wir die Tschechoslowakei angreifen, und ich werde diesem Regime ein Ende bereiten.“ [11]
Nachdem die Abwehr technisch die Wege zur Reise nach England wie auch für die Rückkehr geebnet hatte, und der britische Botschafter in Berlin informiert worden war, traf Kleist am 18. August in London ein. Außer mit Lord Lloyd, dem zweiten Mann der Konservativen, hatte er Unterredungen mit Vansittard und Churchill. Er machte rückhaltlos klar, dass Hitlers Kriegsplan gefasst sei und nach dem 27. September ausgeführt werden würde. Die Generäle, die gegen einen solchen Kurs stünden, bedürften indessen der Ermutigung von außen. Kleist regte daher eine feste Erklärung Englands und einen Appell an die Opposition an. Wenn der Krieg vermieden werden könne, würde dies das Vorspiel zum Ende des Regimes sein. Churchill gegenüber ging er weiter und betonte, dass, wenn die Generäle auf Frieden bestünden, eine neue Regierung innerhalb von 48 Stunden gebildet werden würde. Churchill schrieb einen Brief an Kleist, in dem er die Folgen eines allgemeinen Blutbades vorausschilderte, wenn die Deutschen zum Angriff schreiten würden, und - allerdings nur als Führer der Opposition - versicherte er, dass England mit Frankreich marschieren werde. Der Premierminister Neville Chamberlain aber gab keine der gewünschten Erklärungen ab. Als nächstes schritt Staatssekretär von Weizsäcker, der auf Drängen oppositioneller Elemente hin von Bülows Nachfolge angenommen hatte, mit dem Herannahen des kritischen Termins, d.h. der Eröffnung des Nürnberger Parteitages am 5. September, im Einvernehmen mit Beck zu einer höchst ungewöhnlichen Maßnahme. Eine Cousine Erich Kordts - Legationsrat im Ministerbüro Ribbentrop - wurde mit einer Botschaft, deren Wortlaut sie auswendig gelernt hatte, an seinen Bruder Theo, der damals Geschäftsträger in London war, geschickt. Nach einer Fühlungnahme mit Sir Horace Wilson, dem nächsten Berater Chamberlains, bat Theo Kordt, vom Außenminister geheim empfangen zu werden. In der Nacht des 7. September betrat er Downing Street 10 durch den Garteneingang. Er legte Lord Halifax eine von Staatssekretär von Weizsäcker formulierte Erklärung vor. Sie wurde ausdrücklich im Namen „politischer und militärischer Kreise in Berlin, die mit allen Mitteln einen Krieg verhindern wollen“ [12], abgegeben. Die Erklärung betonte die Notwendigkeit einer eindeutigen Stellungnahme der britischen Regierung gegen Hitlers Kriegstreiberei. “Lasse man seiner Gewaltpolitik freie Bahn, so werde der Weg für eine Rückkehr zu den Begriffen von Anstand und Ehre unter europäischen Nationen endgültig versperrt. Es sei wahrscheinlich, dass eine offene britische Erklärung den Krieg verhindern werde, und eine solche diplomatische Niederlage könne das nationalsozialistische Regime nicht überleben.“ [13]
Weizsäckers Botschaft endete in einer klaren Zusage, in der die Führer der Armee bereit sind, gegen Hitlers Politik mit Waffengewalt aufzutreten, wenn die erbetenen Erklärung gegeben würde. Der britische Außenminister erwiderte, er würde den Premierminister und ein oder zwei Kollegen unterrichteten, und er versprach, die Angelegenheit aufs vertraulichste zu behandeln.
4 c) „Aktionsplan Halder-Witzleben-Oster“
Während man in Berlin auf entsprechende Schritte wartete - nur eine öffentliche Warnung hätte dem Zweck der Aktion entsprochen -, waren unter den Militärs die verschiedensten Pläne für eine Aktion im Gange. Ein Rückschlag erfolgte naturgemäß, als Chamberlain sich entschloß, nach Berchtesgaden zu fliegen. Aber in den kritischen Tagen von Godesberg, als die erhöhten Forderungen Hitlers zu einem Stillstand in den Verhandlungen führten, schien noch einmal die Aussicht zu bestehen, die früher gefassten Pläne wieder aufzunehmen.
Beck war inzwischen nach einer Auseinandersetzung mit Hitler entlassen, nachdem ihm Hitler eine bewaffnete Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der Tschechenkrise offen dargelegt hatte. „Beck erwiderte: `Dieser Standpunkt ist für mich als Chef des Generalstabes unannehmbar. Die Verantwortung für Befehle, deren Inhalt ich nicht billigen kann, übernehme ich nicht.´ Beck ging nach dieser Unterredung nach Hause und demissionierte. Hitler versuchte ihn zu halten, indem er auf das Demissionsgesuch nicht antwortete. Aber Beck beharrte auf seiner Entlassung und betrat seine Diensträume im Reichskriegs- ministerium nicht mehr. So erzwang er seine Verabschiedung gegen Hitlers Willen.“ [14] Die Entlassung Becks wurde absichtlich für einige Zeit geheim gehalten. Aber auch sein Nachfolger Halder, der am 27. August sein Amt antrat, verschloß sich der Einsicht nicht, dass Hitler und sein Regime beseitigt werden müsste, ehe es zu einem bewaffneten Konflikt mit der Tschechoslowakei kam. Der „Aktionsplan Halder-Witzleben- Oster“ [15] rechnete mit den schon früher als bereitstehend erwähnten Kräften. Er zielte auf eine Besetzung der Reichskanzlei, der zentralen Nachrichtenanlagen und der Hauptstütz- punkte der SS und der Gestapo, auf die Gefangennahme Hitlers und möglicherweise auf seine Verwahrung als Geisteskranker, wenn ein entsprechendes Gutachten einer Ärztekommission unter Vorsitz des Berliner Psychiaters Bonhoeffer ergangen sei. Mitte September 1938 fand eine Besprechung in der Wohnung Osters, der eigentlich zentralen Figur, statt. An ihr nahm neben Witzleben unter anderen auch ein früherer Stahlhelmführer, Friedrich-Wilhelm Heinz, teil. Er sollte mit einem Stoßtrupp, der tatsächlich auch aufgestellt wurde, Witzleben in die Reichskanzlei begleiten.
Heinz war aber auch zu drastischerem Handeln bereit. Er wollte, im Einverständnis mit Oster, es gar nicht erst zur Verhaftung Hitlers kommen lassen, sondern ihn gleich während des zu erwartenden Tumults erschießen. Auch Erich Kordt war in die Verschwörung eingeweiht. Er beschaffte Oster einen Grundriß der Reichskanzlei und stellte fest, dass keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen waren. Auch stellte er sich zur Verfügung, die Doppeltür hinter den Posten zu öffnen, da er auch Zugang zu dem Gebäude hatte. Die Aktion sollte am Morgen des 29. September erfolgen. Am Mittag des 28. September traf aber plötzlich die Nachricht ein, dass Chamberlain und Daladier, der französische Ministerpräsident, die Einladung zur Zusammenkunft in München angenommen hatten. Das Ergebnis war, dass daraufhin die Grundlage des Plans zusammenbrach.
Es ist nicht feststellbar, dass allein schon der erste Schritt, der geplante Staatsstreich, Erfolg gehabt hätte. Es handelte sich hier allerdings um eine im allgemeinen Sinn verheißungsvolle und eine mehr als militärische Perspektive.
Die Aktionen vom Herbst 1938 zielten primär auf eine Verhinderung des Krieges und waren von der Hoffnung getragen, dass mit einer entschlossenen Haltung Englands nicht nur dieses Ziel erreicht werden könnte, sondern zugleich sich die Möglichkeit für den Sturz des Regimes ergeben würde. Man kann durchaus sagen, dass unter den Voraussetzungen der bis dahin verfolgten Beschwichtigungspolitik Chamberlains und auf die bloße Zusage eines Bündnisses mit der deutschen Opposition hin das, was die deutschen Emissionäre von der britischen Politik erwarteten, für diese unzumutbar war.
Der britische Außenminister sagte einige Tage nach dem Münchener Abkommen vom 30. September 1938 zu Theo Kordt: „Wir sind nicht imstande gewesen, so freimütig zu Ihnen zu sein, wie sie es zu uns waren. Zu der Zeit, als Sie uns ihre Botschaft übermittelten, erwogen wir bereits die Entsendung Chamberlains nach Deutschland.“ [16]
Da man nun Sorge hatte, dass man vielleicht Leute ins Vertrauen gezogen hatte, die unter dem Eindruck der Erfolge des Regimes zu einer Gefahr werden konnten, lockerte sich nun die Verbindung zwischen Militärs und Zivilisten. Die gemeinsame Front zerbröckelte, und selbst entschiedene Gegner des Diktators sahen vorerst keine Möglichkeit mehr, den so sichtlich von Erfolg begünstigten Mann auszuschalten. Sie waren zwar nicht bekehrt, aber sie flüchteten sich in eine achselzuckende Resignation.
Generaloberst Halder sagte in dieser Zeit zu dem ihm nahestehenden Ministerialrat Dr. Walter Conrad: „Das Ziel bleibt unverändert, aber das fast märchenhafte Glück, das Hitler auf außenpolitischen Gebiet bisher entfaltet hat, lässt irgendwelche Aktionen zur Zeit nicht möglich erscheinen. Offiziere und Soldaten sind vollkommen im Banne der Erfolgspsychose. Daß das Ausland keine Konsequenzen gezogen hat, sondern im Gegenteil alles hinnimmt, hat die persönliche Stellung Hitlers in der Wehrmacht ungeheuer gestärkt.“ [17] Die deutsche Opposition hatte mit einer harten und eindeutig ablehnenden Haltung der Westmächte gegenüber Hitler gerechnet, und es ist verständlich, dass sie sich jetzt im Stich gelassen fühlte. Der neue Erfolg Hitlers rief nämlich nicht nur etwa nur im deutschen Volke, sondern auch in der Wehrmacht großen Eindruck hervor. Ohne einen Schuß war der Panzergürtel der tschechischen Maginotlinie in deutsche Hand gefallen, und mit der unblutigen Besetzung des Sudetenlandes war zugleich das französisch-tschechische und das russisch-tschechische Militärbündnis sowohl ideologisch als auch praktisch entwertet worden. Die Generäle hatten sich geirrt. Hitler hatte gegenüber der pessimistischen Beurteilung der Lage durch Beck und Halder wieder einmal bewiesen, dass „er es eben doch besser verstand“. [18]
Nach dem Befehl Hitlers vom 21. Oktober 1938, nach dem es möglich sein müsse, jederzeit die Rest-Tschechei zerschlagen zu können, sobald sie eine deutsch-feindliche Politik betrieb, wurde auch von einigen Generälen die Möglichkeit eines Staatsstreiches erwogen. Aber die Gelegenheit dazu hatte man verpasst. Denn inzwischen hatte sich Hitlers Misstrauen gegen das Oberkommando des Heeres ebenso gesteigert, wie seine Achtung vor der Urteilskraft seiner Berater gesunken war. Durch die Einführung einer Zeittafel war es ihm möglich geworden, sich jederzeit einen genauen Überblick über den Standort und die Bewegungen der einzelnen Divisionen zu verschaffen. Es war daher sehr schwierig geworden, die für einen Putsch notwendigen militärischen Kräfte heranzuziehen, ohne dass dies auffiel. Es fehlte auch der „Führer“, der die Truppen mitreißen sollte, da General von Witzleben im Herbst 1938 die Heeresgruppe West übernommen hatte, und sein Nachfolger im Wehrkreis Berlin, General Curt Haase, als nicht „verschwörungsfähig“ galt.
In diesen Monaten zwischen dem Münchener Abkommen und dem Einmarsch in Prag trat immer deutlicher das Bestreben Hitlers in Erscheinung, die Generäle noch schärfer in die Grenzen ihrer militärischen Fachgebiete zu verweisen und sie, die bisher verantwortliche Mitarbeiter gewesen waren oder sein wollten, endgültig auf die Position bloßer ausführender Organe herabzudrücken.
5. Polenfeldzug
5 a) Denkschrift an Keitel
Bald darauf verdüsterte sich erneut die politische Lage in Europa. Nachdem Hitler die tschechische Regierung unter Druck gesetzt hatte, konnte er am 15. März 1939 in Prag einmarschieren und die Rest-Tschechei zum deutschen „Protektorat Böhmen und Mähren“ erklären. Nach Becks Auffassung war die Aktion gegen die Tschechei der Ausdruck einer „rücksichtslosen Gewaltpolitik, die zwangsläufig eines Tages unter für Deutschland noch viel schlimmeren Verhältnissen den völligen Bruch mit den Westmächten und damit einen großen europäischen, ja wahrscheinlich einen Weltkrieg größten Umfanges, herbeiführen würde.“ [19]
In der letzten Märzwoche 1939 erklärte Hitler den Oberbefehlshabern der Wehrmachtteile, die Lösung der polnischen Frage erscheine ihm in absehbarer Zeit unvermeidlich. Er befehle daher, eine etwaige Auseinandersetzung mit Polen bis zum 1. September 1939 vorzubereiten. Wie reagierte nun die Führungsspitze des Heeres zu dieser eindeutigen Ankündigung eines Angriffs- und Eroberungskrieges?
Wieder lag der Gedanke an einen Staatsstreich nahe, aber die Voraussetzungen hatten sich inzwischen geändert. Die Gründe dafür, dass niemand sich ernstlich mit dem Gedanken einer Aktion befasste, sind teils in der Anerkennung der bisherigen Erfolge Hitlers, teils im Bann des Eides, teils in der Hoffnung, es werde auch diesmal wieder gut gehen, zu suchen. Nicht zuletzt hat wohl auch die Überzeugung von der praktischen Unmöglichkeit eines Putsches im Sommer 1939 eine gewisse Rolle bei den Erwägungen der Opposition gespielt. Es gab aber auch Generäle, die nicht resignierten, und nach wie vor im Interesse des Friedens tätig waren. Generaloberst Halder veranlasste, weil er keine Gelegenheit zum direkten Gespräch mit Hitler hatte, den Oberbefehlshaber des Heeres und den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Hitler eindringlich zu warnen, ein deutsch-polnischer Konflikt würde unweigerlich England und
Frankreich auf die Seite Polens bringen und damit für Deutschland die Lage des Zweifrontenkrieges schaffen.
“Ein gesellschaftliches Zusammentreffen mit dem englischen Botschafter gab mir dann Gelegenheit, ihn zu bitten, England möge seine Entschlossenheit, Polen beizustehen, Deutschland gegenüber so eindeutig auszusprechen, dass auch Hitler davon überzeugt werde. Sir Neville Henderson versprach seine Unterstützung. Das Ergebnis war ein Brief Chamberlains an Hitler, der freilich auf diesen keine Wirkung hatte.“ [20]
Hitler machte Andeutungen über den bevorstehenden Abschluß eines Nichtangriffspaktes mit der Sowjetunion in der Hoffnung, mit dieser Nachricht noch etwa vorhandene Bedenken der Generäle zu zerstreuen. Dies gelang ihm allerdings nicht restlos. Selbst jetzt fehlte es nicht an Vorstellungen ernstlich besorgter Soldaten. Admiral Canaris sah den Hauptgrund, warum Hitler vor keinen Konsequenzen zurückschreckte, in dessen Überzeugung, dass Groß- britannien seine Verpflichtung gegenüber Polen nicht erfüllen werde. Er versuchte daher, dem Chef des OKW klarzumachen, dass England, falls Deutschland einen Angriffsakt begehen sollte, alle in seinen Kräften stehenden Schritte unternehmen würde, um Deutschlands Niederlage herbeizuführen. Aber diese Warnungen übten auf Keitel nicht die geringste Wirkung aus. Fast zur selben Zeit übergab General Thomas, Chef des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes, Keitel eine von ihm mit Unterstützung von Beck, Goerdeler, Popitz, Hassell, Oster und Schacht ausgearbeitet Denkschrift, in der die Gefahren des Krieges dargelegt waren. Aber auch Thomas wurde von Keitel mit einigen oberflächlichen Bemerkungen abgespeist, was jenen allerdings nicht hinderte, wenige Tage vor dem schicksalhaften 1. Sep- tember noch einmal dem Chef des OKW deutlich seine Bedenken zu äußern. Keitel erklärte ihm, dass es gar nicht zu einem Weltkrieg kommen würde, „... denn die Franzosen seien zu pazifistisch und die Engländer zu dekadent, um Polen zu Hilfe zu kommen Sie haben sich von den Pazifisten, die die Größe des Führers nicht anerkennen wollen, anstecken lassen.“ [21]
Am 25. August 1939 um 15.02 Uhr erließ Hitler den Befehl zum Einmarsch in Polen für den 25. August früh. Doch um 16.30 Uhr erhielt er die Nachricht von der bevorstehenden Unterzeichnung des englisch-polnischen Beistandspaktes. Um 17.54 Uhr ließ Mussolini mitteilen, dass sein Land zu seinem Bedauern nicht kriegsbereit sei. Jetzt widerrief Hitler seinen Angriffsbefehl, und es gelang der Heeresleitung gerade noch, die im Gange befindlichen Vormarschbewegungen anzuhalten. Selbst die größten Skeptiker unter den Militärs, Admiral Canaris und Oberst Oster, glaubten jetzt, dass der Friede gesichert sei. In Wirklichkeit konnten sie nur noch auf eine Verhütung des Krieges hoffen, aber nicht mehr damit rechnen.
Zu einer entscheidenden Einwirkung von militärischer Seite auf Hitler ist es nach dem 25. August nicht mehr gekommen. Hitler hielt sich in jenen Tagen fast völlig isoliert. Er sah ausser Ribbentrop nur Himmler und Göring.
5 b) „Aktionsplan Hammerstein“
Als Hitler den Krieg dann wirklich entfesselte, war die internationale Lage für einen Staats- streich viel ungünstiger, vor allem wegen der Verständigung Hitlers mit der Sowjetunion. Auch die persönlichen und technischen Voraussetzungen waren nicht mehr gegeben: Witzleben war versetzt, und der Angriffstermin wurde bis zuletzt geheimgehalten, so dass keine Möglichkeit mehr bestand, aus dem Aufmarsch heraus Truppen für einen Staatsstreich abzuziehen. Als der Krieg zur Tatsache geworden war, bemühte sich die deutsche Opposition, seine Ausdehnung zu verhindern, d.h. Hitler von dem Angriff auf den Westen abzuhalten. Die psychologischen Voraussetzungen waren aber nach dem überwältigenden Sieg in Polen äußerst schwierig. Die opponierenden Generäle hatten große Angst davor, im Falle eines Putsches nicht als Retter vor einem unsinnigen Krieg dazustehen, sondern als Saboteure und Verräter.
Während jetzt die Generäle zögerten, nahm die britische Regierung eine sehr positive Haltung gegenüber den Vorhaben der deutschen Opposition ein. England war geneigt, auf die Opposition zu setzen und einer Oppositionsregierung äußerst günstige Friedensbedingungen einzuräumen. So hätte Deutschland z.B. alle von Hitler annektierten wirklich deutsch- sprechende Gebiete behalten dürfen, während die Tschechoslowakei und Polen als unab- hängige Staaten wiederhergestellt werden sollten. Aber aus diesen Plänen wurde nichts. In den ersten Septembertagen planten einige Offiziere erneut einen Staatsstreich. General- oberst von Hammerstein, ein entschlossener Gegner Hitlers, der 1934 auf Veranlassung Hitlers verabschiedet worden war, weil er einige Beziehungen zu den Gewerkschaften unterhielt, erhielt den Oberbefehl über eine Armee am Rhein. Hitler sollte nun veranlasst werden, dieser Armee einen Besuch abzustatten, um während des Feldzuges gegen Polen die militärische Stärke des Dritten Reiches auch am Rhein zu dokumentieren. Generaloberst von Hammerstein war entschlossen, Hitler bei diesem Besuch festzunehmen und zu stürzen. General von Schlabrendorff sollte die Engländer über den bevorstehenden Plan Hammersteins informieren. Einige Tage später aber sagte Hitler, der ein Gefühl für persönliche Gefahren gehabt zu haben schien, den schon in Aussicht genommenen Besuch bei der Armee Hammersteins wieder ab und verfügte, dass Hammerstein den Oberbefehl über seine Armee abgeben müsse, worauf dieser erneut in den Ruhestand trat. „Die Enttäuschung über das Misslingen unseres Planes dürfte bei den unterrichteten englischen Kreisen ebenso groß gewesen sein, wie bei uns.“ [22]
6. Haltung der Marine zum Widerstand
Der militärische Widerstand wurde hauptsächlich vom Heer getragen. Der Oberbefehlshaber der Luftwaffe Göring war ein enger Freund und Vertrauter Hitlers. Von ihm und seiner Waffengattung war kein Widerstand gegen Hitler zu erwarten. Wie verhielt sich aber nun die Marine zum Widerstand gegen Hitler?
Die ersten Zweifel an Hitler kamen dem Oberbefehlshaber der Marine Raeder im Frühjahr 1938 anläßlich der „Blomberg-Fritsch-Krise“. Die Vorstellungen des Seeoffiziers Heye, gemeinsam mit dem Heer energische Schritte gegen Hitler zu unternehmen, lehnte er jedoch ab, während er sich ein halbes Jahr später, nach der „Kristallnacht“ vom 9./10. November 1938, auf die empörten Meldungen einer Reihe führender Offiziere der Marine wenigstens über „die Unmoral der Handlungen und die eingetretenen Schädigung des deutschen Ansehens“ [23] bei Hitler beschwerte. Raeder ließ sich aber von Hitler mit einer billigen Ausrede abspeisen. Aber schon wenige Tage danach reagierte Raeder heftig, als Hitler während eines Vortrages vor ihm plötzlich stark die bisherige Baupolitik der Marine, und zwar namentlich die Pläne der beiden - später „Bismarck“ und „Tirpitz“ getauften - Schlachtschiffe, kritisierte. In diesem Augenblick bat der Oberbefehlshaber der Marine in relativ scharfer Form um seine Entlassung. Von da an häuften sich die Auseinandersetzungen, die jedes Mal Raeders Ressort betrafen, so dass er, nachdem er sein erstes Abschiedsgesuch auf Drängen Hitlers widerrufen hatte, trotz äußerer Ehrungen sein Amt zum 1. Oktober 1939 erneut zur Verfügung stellte.
Der inzwischen ausbrechende Krieg stimmte Raeder jedoch sofort um, obwohl er gerade jetzt allen Grund zur Enttäuschung und zum Zweifel an Hitler gehabt hätte. Wenn er jetzt ausgeschieden wäre, wäre das seinem rein „soldatischen“ Denken als Desertion erschienen. „Wenn die Marine schon, unfertig wie sie war, nicht mehr tun konnte, als kämpfend und in Ehren unterzugehen, so wollte ich ebenso selbstverständlich auf meinem Posten beleiben, wie dies von jedem Kommandanten eines Schiffes verlangt wurde.“ [24]
Er bedachte zu wenig, dass wesentlich mehr auf dem Spiel stand als seine persönliche Ehre oder die der Marine. Dies zeigt auch seine Verständnislosigkeit für das Verhalten von Beck, das er nicht einmal als Möglichkeit in Erwägung zog. Um was es wirklich ging, erkannte mit aller Klarheit fast allein der Abwehrchef Canaris, der mit Raeder selbst und mit der Marine eigentlich zu wenig Kontakt besaß, als dass sein Anteil am Widerstand gegen Hitler seiner Waffengattung, der Marine, zuzurechnen wäre. Die Marine distanzierte sich vielmehr von Canaris und sie lehnte - von wenigen Ausnahmen abgesehen - überhaupt den Widerstand ab. Dennoch gab es neben Canaris noch einige Männer innerhalb der Marine, die sich an dem ersten Akt der deutschen militärischen Opposition während der Sudeten-Krise im Sommer 1938 beteiligten. Raeder war durch Hitlers Rüstung und das „Hoßbach-Protokoll“ nicht beunruhigt worden, sondern er glaubte an Görings beruhigende Versicherungen. Dafür hatten im Oberkommando der Marine zwei Männer - Vizeadmiral Guse, der Chef des Stabes der Seekriegsleitung, und Fregattenkapitän Heye, sein erster Operationsführer - die gleichen Sorgen wie Beck. Heye, Sohn des ehemaligen Chefs der Heeresleitung und ein Offizier, der schon vor der Machtergreifung Hitlers durch politisches Denken unangenehm aufgefallen war, verfasste im Juli 1938 eine „Lagebetrachtung“ im Falle eines deutschen Angriffs auf die Tschechoslowakei. Er sah, wie Beck, das Eingreifen Englands und Frankreichs voraus, später möglicherweise auch Amerikas und Russlands. „Schon ein Krieg gegen die Westmächte aber bedeutet den Verlust des Krieges für Deutschland mit allen Folgen.“ [25] Ihm schloß sich Guse mit der Forderung einer gemeinsamen Vorstellung der drei Oberbefehlshaber der Wehrmacht bei Hitler an, bzw. wenigstens der beiden Oberbefehlshaber des Heeres und der Kriegsmarine, „da Göring wahrscheinlich nicht dazu zu bewegen sein werde.“ [26] Doch auch ein gemeinsamer Schritt von Brauchitsch und Raeder unterblieb, weil beide von der soldatischen Gehorsamspflicht und der Hoffnung, es werde wieder gut gehen, abgehalten wurden.
Bei dem Versuch, Hitler in dem Augenblick mattzusetzen, in dem er den Fall „Grün“, den Angriff auf die Rest-Tschechei verwirklichen wollte, war von der Marine niemand beteiligt. Canaris stand zwar leitend und schützend hinter Oster, doch kann er nicht als Vertreter der Marine betrachtet werden. Dasselbe gilt für den Kapitänleutnant Liedig, der ebenfalls zur Abwehr gehörte. Liedig hatte sich für den Stoßtrupp zur Verfügung gestellt, der unter Führung von Oberstleutnant Heinz in die Reichskanzlei eindringen und Hitler verhaften sollte.
Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der weiter tätigen, wenn sich auch wandelnden Oppositionsgruppe um Halder und Witzleben und dem späteren Widerstandskreis in der Marine ist nicht zu erkennen. Verschiedene Versuche des Generalstabschefs auch Marineoffiziere heranzuziehen, waren nicht nur erfolglos, sondern sogar gefährlich. „Die völlige Unbrauchbarkeit der Marine für Zwecke des Widerstandes bestätigte sich für den Generalstabschef so kraß, dass er sie danach nicht weiter umwarb, zumal sie technisch nur wenig nutzen konnte.“ [27]
7. Schlußbemerkung
Nach dem katastrophalen Ausgang des Krieges ist es natürlich leicht zu sagen, die Generäle hätten einfach handeln müssen, und zwar rechtzeitig, d.h. solange noch ein einzelner den Anfang eines Krieges bestimmen kann, da bekanntlich nach allen historischen Erfahrungen das Kriegsende von anderen bestimmt wird.
Wer dem nationalsozialistischen Staat, seinem „Führer“ und seiner Programmatik kritiklos gegenüberstand, sei es aus Mangel an Urteilsfähigkeit, sei es aus soldatischer Gehorsamspflicht, wie er sie verstand, für den gab es selbstverständlich keine Opposition. Die anderen dagegen, die von der vielfachen Schuld und der moralischen Entartung des herrschenden Regimes ebenso wie von den uferlosen Machtstreben des Diktators und seinen unzulänglichen politischen und militärischen Fähigkeiten überzeugt waren, mussten in ihrer Sorge um das deutsche Volk und seine Zukunft darauf bedacht bleiben, durch einen missglückten Staatsstreich nicht noch weit größere Gefahren für das Vaterland heraufzu- beschwören. Eine Aktion gegen das bestehende System musste auf jeden Fall so vorbereitet werden, dass jeder Fehlschlag ausgeschlossen war. Dies war im Sommer 1939 - nach den großen Erfolgen Hitlers - nicht möglich. Dazu kam, dass die Bereitschaft zur Aktion sich bekanntlich bei jeder Wiederholung eines Spannungszustandes abnutzt, dessen Auflösung einen Staatstreich mit hochverräterischem Charakter bewirkt.
Nachdem aber einmal der Kriegszustand eingetreten war, hatten die oppositionell eingestellten Generäle, sowie all jene, die nach wie vor den Krieg als ein „Hasardspiel“ betrachteten, in ihren Positionen die doppelte Aufgabe: sie mussten einmal jeden militärischen Vorteil für die kämpfende Truppe gewissenhaft wahrnehmen, sowie jeden militärischen Nachteil von ihr abwenden, und andererseits ihr Bestreben und ihre Tätigkeit darauf einstellen, dass der unselige Krieg so schnell wie möglich und unter für Deutschland einigermaßen günstigen, beziehungsweise erträglichen Bedingungen, beendet wurde.
Zu Hilfe genommene Bücher:
- Bernt Engelmann: Einig gegen Recht und Freiheit. Deutsches Anti-Geschichtsbuch 2. Teil; Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt/Main 1975
- Der Nationalsozialismus, Dokumente 1933-1945 hrsg. Von Walther Hofer; Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt/Main 1957
- Walter Baum: Marine, Nationalsozialimus und Widerstand in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte Jg. 11 (1963)
- Fabian v. Schlabrendorff: Offiziere gegen Hitler; hrsg. Von Gero v. S. Gaevernitz; Europa Verlag Zürich 1951
- Hans Rothfels: Deutsche Opposition gegen Hitler; Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt/main 1958
- Georg Franz: Über die Ursachen der Militäropposition; in: Wehrwissenschaftliche Rundschau 7 (1957)
- Georg Stadtmüller: Zur Geschichte der deutschen Militäropposition 1938-45; in: Saeculum Jg. 4, H. 4 (1953)
- Vollmacht des Gewissens; Hrsg. Von der Europäischen Publikation e.V.; Alfred Metzener Verlag; Frankfurt/Main 1960
- Gerhard Ritter: Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung; Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart 1956
- Gert Buchheit: Soldatentum und Rebellion; Grote`sche Verlagsbuchhandlung KG, Rastatt/Baden 1961
[...]
[1] Fabian v. Schlabrendorff: Offiziere gegen Hitler Bearb. U. Hrsg. Von Gero v. S. Gaevernitz; Europa-Verlag Zürich: (1951) S. 26
[2] Georg Franz: Über die Ursachen der Militäropposition; in: Wehrwissenschaftl. Rundschau 7 (1957) S. 373
[3] Georg Franz a.a.O. S. 376
[4] Gerhard Ritter: Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung, Dt. Verlags-Anstalt Stuttgart 1956 S. 144
[5] Gerhard Ritter a.a.O. S. 145
[6] Gerhard Ritter a.a.O. S. 145
[7] Hans Rothfels: Deutsche Opposition gegen Hitler Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt/Main 1958 S. 71
[8] Hans Rothfels a.a.O. S. 71
[9] Hans Rothfels a.a.O. S. 72
[10] Hans Rothfels a.a.O. S. 73
[11] Hans Rothfels a.a.O. S. 73
[12] Hans Rothfels a.a.O. S. 74
[13] Hans Rothfels a.a.O. S. 74
[14] Fabian von Schlabrendorff a.a.O. S. 31
[15] Hans Rothfels a.a.O. S 75
[16] Hans Rothfels a.a.O. S 76 f.
[17] Gerd Buchheit: Soldatentum und Rebellion Grote`sche Verlagsbuchhandlung KG, Rastatt/Baden, 1961 S. 192
[18] Gerd Buchheit a.a.O. S. 193
[19] Gerd Buchheit a.a.O. S. 197
[20] Gerd Buchheit a.a.O. S. 201
[21] Gerd Buchheit a.a.O. S. 202
[22] Fabian von Schlabrendorff a.a.O. S. 38
[23] Walter Baum: Marine, Nationalsozialismus und Widerstand; in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte Jg. 11 (1963) S. 20
[24] Erich Raeder: Mein Leben Tübingen 1956/57 Bd. II S. 171
[25] Walter Baum a.a.O. S. 23
[26] Walter Baum a.a.O. S. 23
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text über den Widerstand gegen Hitler?
Der Text behandelt den Widerstand gegen das Hitler-Regime, seine Hintergründe, die Träger des Widerstandes und den Beginn des Widerstandes. Er geht auch auf das "Hoßbach-Protokoll", die "Blomberg-Fritsch-Krise", die Krise im Herbst 1938, den Polenfeldzug und die Haltung der Marine zum Widerstand ein.
Wer waren die Hauptträger des Widerstandes gegen Hitler?
Zu den Hauptträgern des Widerstandes gehörten zivile Gegner wie Carl Friederich Goerdeler und militärische Figuren wie General Ludwig Beck, General Halder, General von Witzleben, General von Stülpnagel, General Hoepner und Oberst Hans Oster.
Was war das "Hoßbach-Protokoll" und welche Bedeutung hatte es für den Widerstand?
Das "Hoßbach-Protokoll" war ein geheimes Protokoll einer Sitzung vom 5. November 1937, in der Hitler seine Kriegspläne darlegte. Dies führte zum Widerspruch von Reichskriegsminister von Blomberg, Chef der Heeresleitung von Fritsch und Reichsaußenminister von Neurath, was später zu Veränderungen in der militärischen und außenpolitischen Führung führte.
Was war die "Blomberg-Fritsch-Krise"?
Die "Blomberg-Fritsch-Krise" war eine Folge von Skandalen und Intrigen im Winter 1937/38, die zur Entlassung von General Blomberg und General von Fritsch führten. Hitler nutzte diese Gelegenheit, um die militärische Führung der Wehrmacht selbst zu übernehmen und gefügigere Werkzeuge auszuwählen.
Welche Rolle spielte England im Widerstand gegen Hitler im Herbst 1938?
Der deutsche Widerstand suchte die Unterstützung Englands, um Hitler von seinen Kriegsplänen gegen die Tschechoslowakei abzubringen. Ewald von Kleist wurde nach London geschickt, um die britische Regierung zu einer klaren Stellungnahme gegen Hitlers Kriegstreiberei zu bewegen, jedoch ohne Erfolg.
Was war der "Aktionsplan Halder-Witzleben-Oster"?
Der "Aktionsplan Halder-Witzleben-Oster" war ein Staatsstreichplan, der die Besetzung der Reichskanzlei, die Gefangennahme Hitlers und möglicherweise seine Verwahrung als Geisteskranker vorsah. Der Plan scheiterte jedoch, als Chamberlain und Daladier die Einladung zur Zusammenkunft in München annahmen.
Wie verhielt sich die Marine zum Widerstand gegen Hitler?
Die Marine war im Allgemeinen weniger aktiv im Widerstand gegen Hitler als das Heer. Obwohl es einige Marineoffiziere gab, die Bedenken äußerten, distanzierte sich die Marine größtenteils von Canaris und lehnte den Widerstand ab. Admiral Raeder, der Oberbefehlshaber der Marine, war zwar zeitweise kritisch gegenüber Hitler, stellte jedoch seine soldatische Pflicht über den Widerstand.
Was war der "Aktionsplan Hammerstein"?
Nach dem Beginn des Krieges gegen Polen im September 1939 plante Generaloberst von Hammerstein, Hitler bei einem Besuch seiner Armee am Rhein festzunehmen. Der Plan scheiterte, da Hitler den Besuch absagte und Hammerstein den Oberbefehl abgeben musste.
- Quote paper
- Martin Eder (Author), 1982, Die deutsche Militäropposition von 1937 bis 1939, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105668