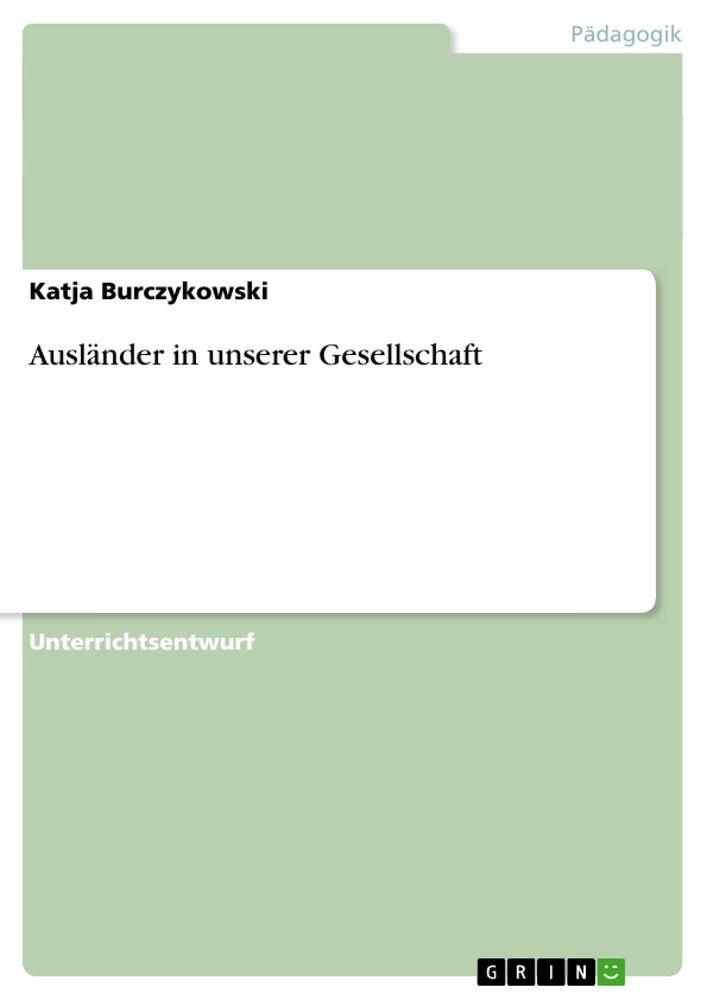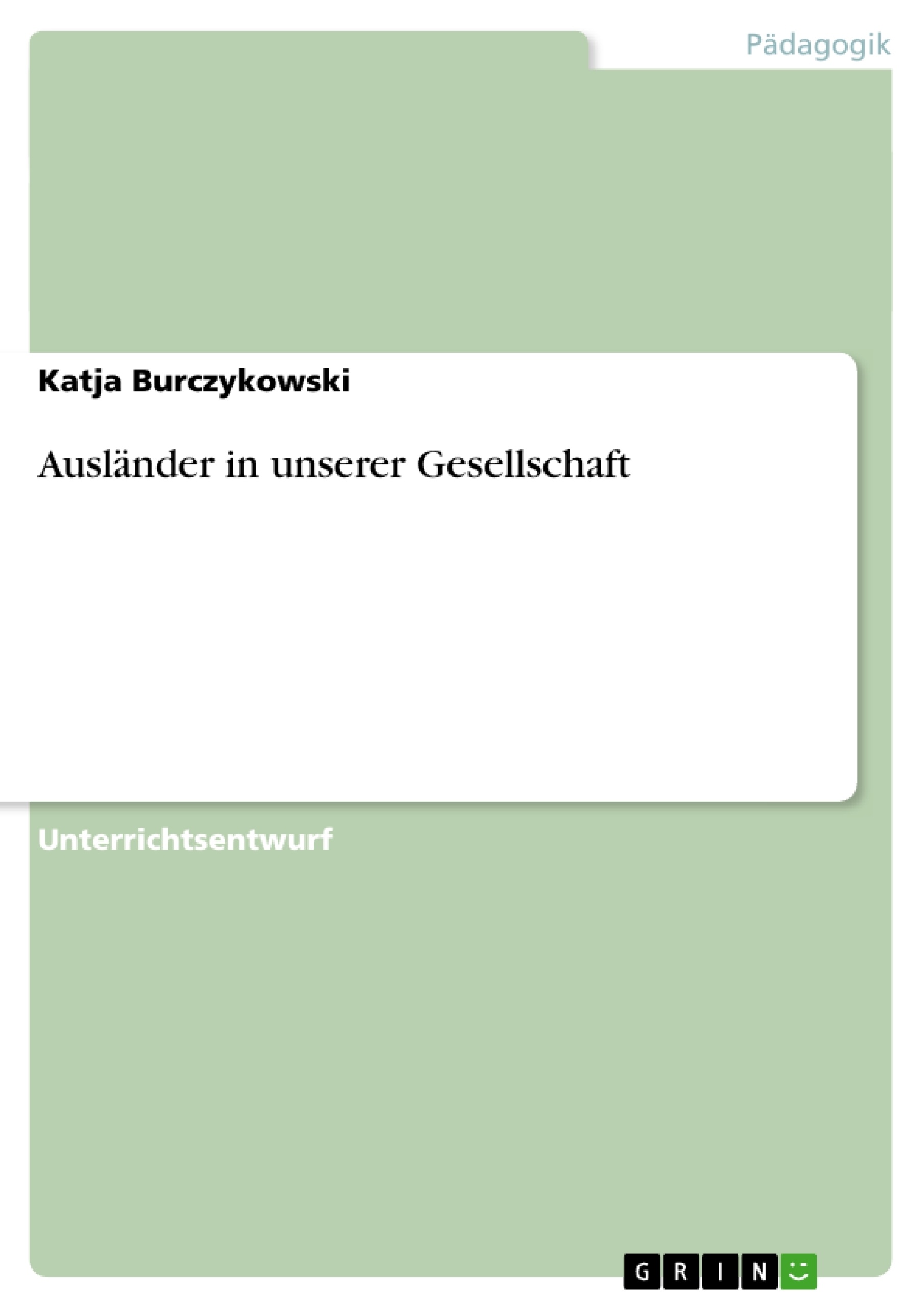1. Ziele und Aufgaben des Ethikunterrichts
Vom Bildungsauftrag der Schule her führt der Ethikunterricht in anthropologische und ethische Sichtweisen und Problemstellungen ein, die die Grundlagen der menschlichen Existenz sichtbar machen und die verdeutlichen, daß der Mensch und die Gesellschaft auf Sittlichkeit angewiesen sind. Wesentlicher Bezugspunkt für den Ethikunterricht ist die Sinnfrage menschlichen Lebens. Handlungen des einzelnen oder der Gesellschaft sind verantwortlich an Grundsätze gebunden. Erst auf dem Fundament der Grundwerte ergeben sich Grundrechte, die es wiederum nicht ohne Grundverpflichtungen gibt. Es gilt, die Schüler mit den Grundwerten vertraut zu machen, ihre Urteilsfähigkeit zu entwickeln und sie zu einem weltorientierten Handeln zu befähigen. Ziel ist die Übernahme von Verantwortung in verschiedenen Lebensbereichen.
In einer Zeit schneller gesellschaftlicher Veränderungen und der Verunsicherung hat dieses Fach einen großen Beitrag zu leisten, um den Verlust von Orientierung und Sinnhaftigkeit des Lebens weiter Teile der Jugend abzufangen und Hilfen zur individuellen Lebensgestaltung und Lebensbewältigung zu geben. Für den Ethikunterricht in keiner pluralistischen Gesellschaft ist es unerläßlich, unterschiedliche weltanschauliche Standorte aufzuzeigen und sich mit ihnen auseinander zusetzen. Der Unterricht darf in keiner Weise ideologisch indoktrinieren, muß aber auch die Gefahr der Indifferenz vermeiden.
Die Selbstfindung des Einzelnen ist vom Zusammenleben mit den anderen Menschen nicht zu trennen. Das Zusammenleben der Menschen ist ethisch gesehen an Werten orientiert. Die sittliche Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen ist Voraussetzung für ein sinnvolles Leben.
Bei der Behandlung von Religionen im Unterricht gilt:
Es geht nicht um die Beeinflussung missionarischer Arbeit, sondern um Information, Vertiefung des Allgemeinwissens und um die Weckung von Verständnis für verschiedene religiöse Weltdeutungen.
Es sollte aber für die Schüler erfahrbar werden, daß der Mensch seine Existenz in übergreifenden Zusammenhängen deuten kann. Religiöse Begriffe sollten mit Einfühlungsvermögen und in toleranter Haltung vermittelt werden.
2. Warum ein Projekt zu diesem Thema durchgeführt werden sollte
Ausländerfeindlichkeit resultiert offenbar nicht aus persönlichen Erfahrungen mit Ausländern, im Gegenteil: Gerade hoch-ausländerfeindliche Jugendliche haben erheblich weniger Kontakte zu Nichtdeutschen. Im Kern der Ausländerfeindlichkeit scheinen sich Deprivationsängste zu verstecken, bzw. die Furcht, in der wachsenden Konkurrenz um Arbeitsplätze und Zukunftschancen (projektiv verlängert: um Anerkennung, Mädchen und öffentliche Aufmerksamkeit) zu unterliegen. Bei allen Aussagen, welche die Konkurrenz zwischen Deutschen und Ausländern ansprechen, sind die Differenzen zwischen hoch und niedrig Ausländerfeindlichen sehr groß.
Ausländer in Deutschland
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der abgebildeten Statistik ist ein deutlicher Anstieg der Zahlen ausländischer Mitbürger in Deutschland zu erkennen. In vielen Gebieten treten daher Probleme auf. Deswegen sollte man die Schüler nicht allein mit ihren Fragen, Problemen, Ängsten und vielleicht auch Vorurteilen lassen, sondern ihnen helfen die Problematik besser zu verstehen. Hier bietet sich ein Unterricht in Projektform sehr gut an, da man dabei verscheiden Problem bearbeiten kann. Und im Anschluß an die Arbeit die bearbeiteten Themen vorstellen und darüber diskutieren kann.
3. Aufbau und Themen des Projektes
3.1 Aufbau
Die Klasse sollte in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Jede Gruppe bearbeitet dann ein Thema und am Ende kann dann diskutiert werden. Jedes Thema sollte auf dem nächsten aufbauen, so daß man am Ende eine ganze Sammlung hat. Diese kann dann zu einem anderen Zeitpunkt vervollständigt, bearbeitet oder erweitert werden.
Den Schülern sollten zwei Tage zur freien Arbeit gewährleistet werden. Hier sollte man ihnen diverse Materialien zur Verfügung stellen.
➪ Bücher, Zeitschriften, Zeitungen
➪ diverse Statistiken
➪ Fachliteratur zum Thema
➪ Medien ( Internet, Filme, Dokumentationen,..)
➪ Arbeitsblätter / Plakate
3.2 Themen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Durchführung der Projekte
Ich gehe jetzt von einer Schülerzahl von ca. 25 in einer Klasse aus. Daher können in jeder Gruppe mindestens vier Schüler arbeiten.
Gruppe 1:
Diese Gruppe beschäftigt sich dann mit dem Phänomen der Zuwanderung. Sie soll Gründe und Ursachen erforschen, warum immer mehr Menschen nach Deutschland einwandern wollen. Hierbei können sie Befragungen und Interviews durchführen. Außerdem könnte man ihnen verschiedene Thesen vorgeben, die dann innerhalb der Gruppe und später in der Klasse diskutiert werden können.
Beispiel:
- Flucht vor Willkür
- Flucht vor politischer Verfolgung
- Flucht vor religiöser Unterdrückung
- Flucht vor Krieg
- Als Arbeitskräfte für die deutsche Wirtschaft
- Weil ihnen Wundergeschichten über Deutschland erzählt wurden
Gruppe 2:
Die zweite Arbeitsgruppe hat als Thema die Ausländerprobleme in Deutschland. Hier können aktuelle Zahlen, Daten, Statistiken und Berichte ausgewertet werden. Außerdem kann die Frage des Rechtsextremismus in Deutschland genauer beleuchtet werden. Das geschieht aufgrund der aktuellen Probleme. Gerade hier in Brandenburg ist das ein sehr aktuelles Thema. Auch hier können wieder verschieden Statistiken ausgewertet und diskutiert werden. Außerdem kann man Hilfen und Problemlösungen aufzeigen, sowie andere Schüler, Lehrer, für das Thema sensibilisieren.
Beispiele:
- Die Hamburg - Wahl: Eine ernste Warnung?
- Der Todesfall Joseph Abdullah
- Aktuelle Debatte über die Leitkultur
- NPD - Verbot: Ja oder Nein?
Gruppe 3:
Diese Gruppe hat die Aufgabe verschiedene Meinungen von Deutschen über Ausländer und von Ausländern über Deutsche zu analysieren und zu diskutieren. Hierzu können Lehrer und auch Schüler befragt werden. Außerdem kann man in der Stadt Passanten befragen und die Ergebnisse dann in Tabellenform festhalten und auswerten.
Beispiel:
Deutsche über Ausländer Ausländer über Deutsche
- sind faul und arbeiten nicht - fluchen, schimpfen
- sind alle dumm - nur arbeiten und Geld verdienen
- liegen dem Staat auf der Tasche - keinen Kontakt zu Mitmenschen
- sind kriminell - trinken gern Bier
- sind intolerant, wollen Deutschland nicht als Heimat - sind nicht spontan, geregeltes Leben - Terminplaner akzeptieren
- beschäftigen sich nur mit Familie, - haben alle Lederhosen an
Wenn sich genügend Protest geregt hat, kommt man dann sicher zu einer fruchtbaren Diskussion über Verallgemeinerung, Vorurteile, das Erscheinungsbild "der Deutschen" usw. Dazu sollte man dann die Frage aufdecken: Stimmt das?
Gruppe 4:
Warum ist es gut, wenn Ausländer nach Deutschland kommen? Bereichern sie das Land? In welchen Bereichen können sie hilfreich sein?
Hier soll darüber gesprochen werden, weshalb wir die Ausländer nicht diskriminieren sollten, sondern sie akzeptieren, tolerieren und ihnen helfen sollten.
Beispiel:
Bereicherung deutschen Lebens durch Ausländer 4
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gruppe 5:
Ist es wirklich so einfach nach Deutschland einzuwandern wie alle behaupten?
Was muß ich wissen, wenn ich einwandern will? Welche Voraussetzungen muß ich erfüllen?
Diese Gruppe soll den amtlichen Weg der Einwanderung nachvollziehen. Hierbei soll die Gruppe herausfinden, wie tolerant Ämter und Behörden gegenüber ausländischen Einwanderern sind. Außerdem kann das deutsche Einwanderungsgestz beleuchtet werden.
Beispiel:
- Amtsgang zur Ausländerbehörde
- Gespräch mit einem Beamten
5. Abschlußbemerkung
Als Fazit soll am Ende der drei oder auch vier Tage über das gesamte Projekt in der Klasse diskutiert werden. Jede Gruppe soll ihre Ergebnisse präsentieren und Zeit haben, mit den Mitschülern darüber zu reden.
Die modernen Vorurteilsforscher sind überwiegend der Meinung, feindselige Vorurteile werden erlernt, also von den Eltern und aus der Umwelt übernommen. Sie verweisen dabei auf die Tatsache, daß Kleinkinder offenbar noch keine Aversionen gegen den Andersartigen kennen, sondern ungehemmt mit Kindern von Schwarzen, Türken, Puertoricanern, von Minderheiten überhaupt spielen, ohne deren Andersartigkeit wahrzunehmen. Erst mit dem Schulalter erwachen offenbar die Vorurteile und erreichen bei pubertierenden Jugendlichen einen ersten Höhepunkt.
Daher bin ich der Meinung, daß in Schulen Projekte zu dieser Thematik ("Ausländer in Deutschland") durchgeführt werden sollen. Allerdings ist hier anzumerken, daß man nicht nur reden soll, sondern auch handeln soll.
Jugendliche sollen auf die Probleme aufmerksam gemacht werden und sie "bekämpfen".
Denn diese jungen Menschen sind die Zukunft in Deutschland. Daher muß aktiv etwas gegen den momentan extrem herrschenden Fremdenhaß und die Ausländerfeindlichkeit getan werden.
Literatur:
www.zum.de
www.auslaender.de
von Hellfeld, Matthias (Hrsg.): Im Schatten der Krise: Rechtsextremismus, Neofaschismus und Ausländerfeindlichkeit in der BRD. Köln: 1986
Klawe, Willi (Hrsg.): Lernen gegen Ausländerfeindlichkeit: Pädagogische Ansätze zur Auseinandersetzung mit Orientierungsverlust, Vorurteilen und Rassismus. Weinheim: 1993
Häufig gestellte Fragen
1. Was sind die Ziele und Aufgaben des Ethikunterrichts im Kontext von Ausländerfeindlichkeit?
Der Ethikunterricht zielt darauf ab, anthropologische und ethische Perspektiven zu vermitteln, die die Grundlagen menschlicher Existenz und die Notwendigkeit von Sittlichkeit für Individuen und die Gesellschaft verdeutlichen. Er soll die Schüler mit Grundwerten vertraut machen, ihre Urteilsfähigkeit entwickeln und sie zu verantwortlichem Handeln in verschiedenen Lebensbereichen befähigen, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit unterschiedlichen Kulturen und die Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit. Ein wesentlicher Bezugspunkt ist die Sinnfrage menschlichen Lebens und das Aufzeigen unterschiedlicher weltanschaulicher Standpunkte, ohne zu indoktrinieren oder Indifferenz zu fördern.
2. Warum sollte ein Projekt zum Thema "Ausländer in Deutschland" durchgeführt werden?
Ausländerfeindlichkeit scheint oft nicht auf persönlichen Erfahrungen zu beruhen, sondern auf Ängsten vor Deprivation und Konkurrenz. Ein Projekt ermöglicht es, diese Ängste zu thematisieren, die Problematik der Zuwanderung besser zu verstehen, Vorurteile abzubauen und Lösungsansätze zu entwickeln. Es bietet eine strukturierte Möglichkeit, Fragen, Probleme und Ängste der Schüler anzugehen und ihnen zu helfen, die komplexen Zusammenhänge zu erfassen.
3. Wie ist ein solches Projekt aufgebaut und welche Themen können behandelt werden?
Das Projekt kann in Gruppenarbeit organisiert werden, wobei jede Gruppe ein spezifisches Thema bearbeitet und die Ergebnisse anschließend vorgestellt und diskutiert werden. Mögliche Themen sind: Gründe und Ursachen der Zuwanderung nach Deutschland, Ausländerprobleme und Rechtsextremismus in Deutschland, Meinungen von Deutschen über Ausländer und umgekehrt, der Beitrag von Ausländern zur Bereicherung des Landes sowie die Bedingungen und Prozesse der Einwanderung.
4. Wie könnte die Durchführung des Projekts konkret aussehen?
Die Klasse wird in Gruppen aufgeteilt, die jeweils ein bestimmtes Thema bearbeiten. Gruppe 1 könnte die Gründe für Zuwanderung erforschen (z.B. Flucht vor Krieg, politischer Verfolgung, wirtschaftliche Gründe). Gruppe 2 könnte sich mit Ausländerproblemen und Rechtsextremismus auseinandersetzen. Gruppe 3 könnte Meinungen über Ausländer analysieren und diskutieren. Gruppe 4 könnte die positiven Aspekte der Zuwanderung hervorheben. Gruppe 5 könnte den Einwanderungsprozess selbst untersuchen.
5. Welche Materialien können den Schülern für die Projektarbeit zur Verfügung gestellt werden?
Den Schülern sollten diverse Materialien zur Verfügung stehen, darunter Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Statistiken, Fachliteratur, Medien (Internet, Filme, Dokumentationen) sowie Arbeitsblätter und Plakate.
6. Was ist die abschließende Bemerkung und die zentrale Botschaft dieses Ansatzes?
Die abschließende Bemerkung betont die Bedeutung der Auseinandersetzung mit Vorurteilen, da diese oft erlernt werden und bereits in der Jugend ihren Höhepunkt erreichen. Projekte zu diesem Thema sind wichtig, um Jugendliche für die Problematik zu sensibilisieren und sie zu befähigen, aktiv gegen Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit vorzugehen, da sie die Zukunft Deutschlands gestalten.
- Arbeit zitieren
- Katja Burczykowski (Autor:in), 2002, Ausländer in unserer Gesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105873