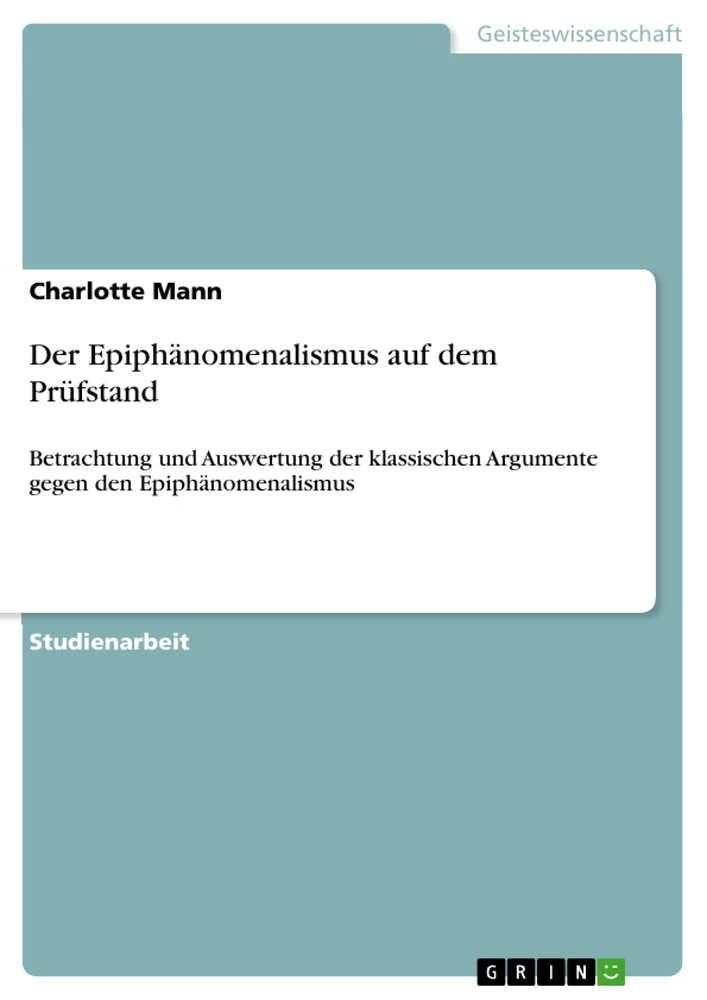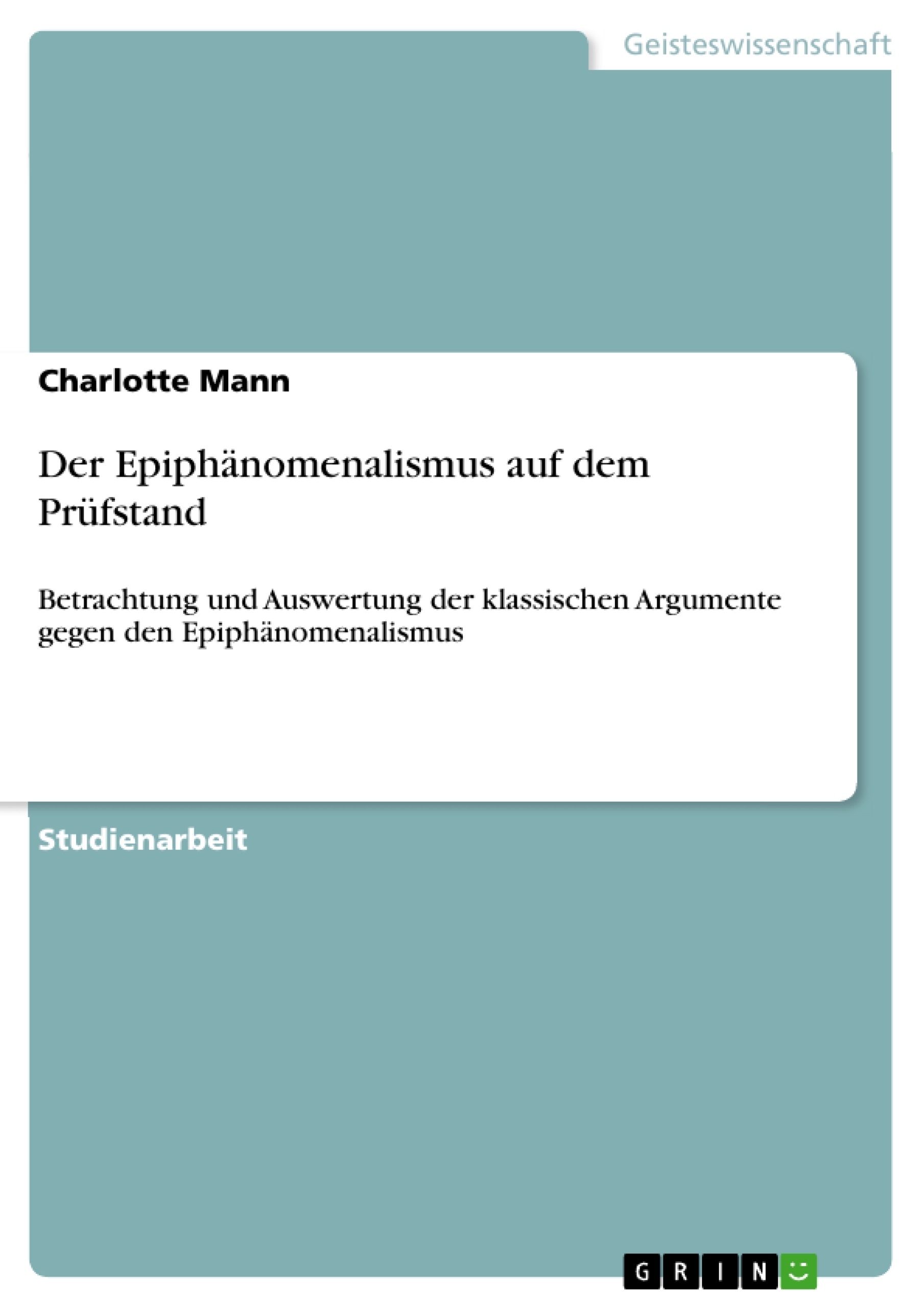Die subjektive Wahrnehmung unserer Rolle in der Welt besteht unter anderem darin, dass wir mit unseren Absichten und Überzeugungen unser Verhalten und damit auch die Welt um uns herum beeinflussen können. Demzufolge haben mentale Phänomene eine kausale Wirkungskraft auf die physische Welt. Wie aber ist es möglich, dass geistige Ereignisse in die materielle Welt eingreifen und dort Veränderungen verursachen können?
Dies ist Teil eines Problems, das Philosophen schon seit der Antike beschäftigt. Das Leib-Seele-Problem beschäftigt sich mit eben diesen Fragen, die das Verhältnis zwischen mentalen und Physischen Phänomenen beschäftigen: Sind mentale und physische Phänomene identisch? Und wenn nicht, wie stehen sie zueinander in Verbindung?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Leib-Seele-Problem
- 3. Der Epiphänomenalismus
- 4. Einwände gegen den Epiphänomenalismus
- 4.1 Kontraintuitivität
- 4.2 Qualia und die Evolution
- 4.3 Fremdpsyche und epistemische Asymmetrie
- 4.4. Das Bewusstsein über Bewusstseinsereignisse
- 5. Wie das Gehirn lernt
- 6. Der Epiphänomenalismus auf dem Prüfstand
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Epiphänomenalismus als Lösungsansatz für das Leib-Seele-Problem. Ziel ist es, die klassische Argumente gegen den Epiphänomenalismus zu betrachten und zu analysieren, um die Plausibilität dieser philosophischen Position zu beurteilen.
- Das Leib-Seele-Problem und die unterschiedlichen Lösungsansätze
- Die Kernaussage des Epiphänomenalismus und seine Vorzüge
- Kritikpunkte am Epiphänomenalismus und mögliche Gegenargumente
- Die Rolle des Gehirns im Prozess des Lernens und seine Relevanz für den Epiphänomenalismus
- Eine kritische Bewertung der Tragfähigkeit des Epiphänomenalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Leib-Seele-Problem vor und erläutert, wie die subjektive Wahrnehmung unserer Rolle in der Welt mit der Frage nach der kausalen Wirkungskraft mentaler Phänomene zusammenhängt. Kapitel 2 beleuchtet die beiden wichtigsten Ansätze zur Lösung des Leib-Seele-Problems, den Monismus und den Dualismus. Im dritten Kapitel wird der Epiphänomenalismus vorgestellt und dessen Kernaussage, dass mentale Ereignisse zwar durch physische Vorgänge im Gehirn verursacht werden, aber selbst keine kausale Wirkungskraft besitzen, erläutert.
Kapitel 4 widmet sich den klassischen Einwänden gegen den Epiphänomenalismus. Dabei werden die Kontraintuitivität des Epiphänomenalismus, die Problematik der Qualia und die Herausforderungen durch die Fremdpsyche und die epistemische Asymmetrie beleuchtet.
Kapitel 5 befasst sich mit der Biologie des Lernens, um die Relevanz von Gehirnvorgängen für die Diskussion um den Epiphänomenalismus hervorzuheben.
Schlüsselwörter
Leib-Seele-Problem, Epiphänomenalismus, Monismus, Dualismus, mentale Verursachung, kausale Geschlossenheit, Qualia, Fremdpsyche, epistemische Asymmetrie, Gehirnvorgänge, Lernen, Bewusstseinsereignisse.
- Arbeit zitieren
- Charlotte Mann (Autor:in), 2020, Der Epiphänomenalismus auf dem Prüfstand, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1059974