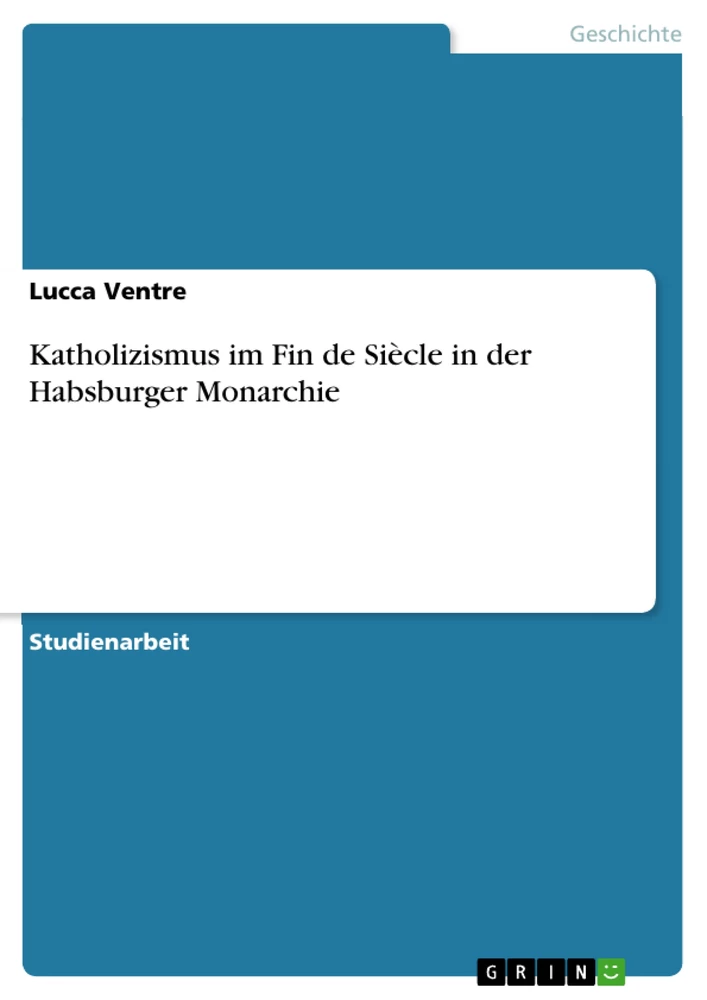In der Arbeit soll der Katholizismus im Fin de Siècle, also von etwa 1880 bis 1910, betrachtet und analysiert werden. Dabei wurde vor allem die Entwicklungsgeschichte der katholischen Kirche und des Katholizismus ab 1868 betrachtet, um die konfessionelle Situation in der Monarchie zu erläutern. In weiterer Folge soll die Stellung der katholischen Kirche im Fin de Siècle sowie die Entstehung der Christlichsozialen Partei erörtert und analysiert werden.
Die katholische Kirche prägte die gesellschaftliche und politische Landschaft in Österreich über mehrere Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg. Erst durch den Druck der liberalen Bewegungen und den daraus resultierenden Maigesetzen manifestierte sich eine drastische Einschränkung der kirchlichen Einflusspolitik, die im endgültigen Bruch des Konkordates 1870 endete.
Die zur Zeit des Fin de Siècle vorherrschende Gesellschaftsstimmung begrenzte sich auf eine gewisse Konnotation des kulturellen Verfalls sowie eine Aufbruchsstimmung, die aber noch maßgeblich von antiken und mittelalterlichen Weltordnungen eingeschränkt wurde. Zur Zeit des Fin de Siècle manifestierte sich in Österreich die Entstehung einer katholischen Bewegung, die sich als Trittbrett für den Katholizismus entpuppen sollte und maßgeblich zu einer neuerlichen „Katholisierung“ der Gesellschaft führte.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung:
- Stellung der Katholischen Kirche ab den Maigesetzen 1868
- Katholizismus und die Stellung der Katholischen Kirche ab 1880.
- Der Aufstieg der Christlichsozialen Partei im „monarchialen“ Fin de Siècle
- Karl Luegers Tod und der Weg in den ersten Weltkrieg .
- Katholizismus im Fin de Siècle unter Betrachtung der Christlichsozialen Partei………………………………………
- Gesellschaft und Katholische Kirche im Fin de Siècle ............
- Anti-Katholische Literatur im Fin de Siècle
- Katholische Kirche und Antisemitismus .......
- Gewaltexzesse von Katholiken in der Habsburgermonarchie…....
- Resümee
- Literaturverzeichnis/Bibliographie......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des Katholizismus in Österreich während des Fin de Siècle, einer Zeit des gesellschaftlichen und politischen Umbruchs. Der Fokus liegt auf der Analyse der Positionierung der katholischen Kirche und ihrer Einflussnahme auf die Gesellschaft, insbesondere in den Bereichen Bildung, Politik und Kultur.
- Die Stellung der katholischen Kirche nach den Maigesetzen von 1868
- Der Aufstieg der Christlichsozialen Partei im Kontext des Fin de Siècle
- Die Rolle der katholischen Kirche in der Gesellschaft und ihre Auseinandersetzung mit Antisemitismus
- Die Entstehung und Verbreitung anti-katholischer Literatur
- Die Bedeutung der katholischen Kirche im Kontext der Habsburgermonarchie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Einfluss der katholischen Kirche auf die österreichische Gesellschaft und die Veränderungen, die durch die liberalen Bewegungen und die Maigesetze von 1868 herbeigeführt wurden.
Das Kapitel "Stellung der Katholischen Kirche ab den Maigesetzen 1868" analysiert die Auswirkungen der Maigesetze auf die Kirche, die ihre Macht und ihren Einfluss im Bildungswesen und in anderen Bereichen einschränkten.
Im Kapitel "Katholizismus und die Stellung der Katholischen Kirche ab 1880." wird die Entwicklung des Katholizismus im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen des Fin de Siècle betrachtet.
Das Kapitel "Der Aufstieg der Christlichsozialen Partei im "monarchialen" Fin de Siècle" untersucht die Entstehung und den Einfluss der Christlichsozialen Partei als wichtiges Element der katholischen Bewegung in Österreich.
Das Kapitel "Gesellschaft und Katholische Kirche im Fin de Siècle" befasst sich mit der Beziehung zwischen der katholischen Kirche und der Gesellschaft, beleuchtet die unterschiedlichen Einstellungen und Meinungen.
Das Kapitel "Anti-Katholische Literatur im Fin de Siècle" analysiert die kritische Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche in der Literatur und die Entstehung von anti-katholischen Texten.
Das Kapitel "Katholische Kirche und Antisemitismus" beleuchtet die Rolle der katholischen Kirche im Kontext des Antisemitismus in Österreich.
Das Kapitel "Gewaltexzesse von Katholiken in der Habsburgermonarchie" untersucht die verschiedenen Formen von Gewalt, die von Katholiken in der Habsburgermonarchie ausgeübt wurden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Katholizismus im Fin de Siècle in Österreich, mit einem Fokus auf die Entwicklung der katholischen Kirche, ihre Stellung im gesellschaftlichen und politischen Kontext, ihre Auseinandersetzung mit den liberalen Bewegungen, die Entstehung der Christlichsozialen Partei, Antisemitismus und Gewalt. Die Arbeit analysiert den Einfluss der Maigesetze von 1868 auf die Kirche, die Rolle der Kirche in der Bildung, die Verbreitung anti-katholischer Literatur und die Beziehung zwischen Kirche und Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte sich der Katholizismus nach 1868?
Durch die liberalen Maigesetze wurde der kirchliche Einfluss drastisch eingeschränkt, was 1870 zum endgültigen Bruch des Konkordates führte.
Welche Rolle spielte die Christlichsoziale Partei?
Sie entstand im Fin de Siècle als katholische Bewegung, die maßgeblich zu einer neuerlichen „Katholisierung“ der Gesellschaft beitrug.
Wie war das Verhältnis zwischen Kirche und Antisemitismus?
Die Arbeit analysiert die Rolle der katholischen Kirche im Kontext des damals in Österreich vorherrschenden Antisemitismus.
Was war die Stimmung im Fin de Siècle der Habsburgermonarchie?
Die Zeit war geprägt von einer Mischung aus kulturellem Verfall, Aufbruchsstimmung und dem Festhalten an antiken oder mittelalterlichen Weltordnungen.
Ging es im Fin de Siècle auch um anti-katholische Literatur?
Ja, ein Kapitel der Arbeit widmet sich der Entstehung und Verbreitung von Literatur, die sich kritisch mit der Macht der Kirche auseinandersetzte.
- Arbeit zitieren
- Lucca Ventre (Autor:in), 2021, Katholizismus im Fin de Siècle in der Habsburger Monarchie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1060126