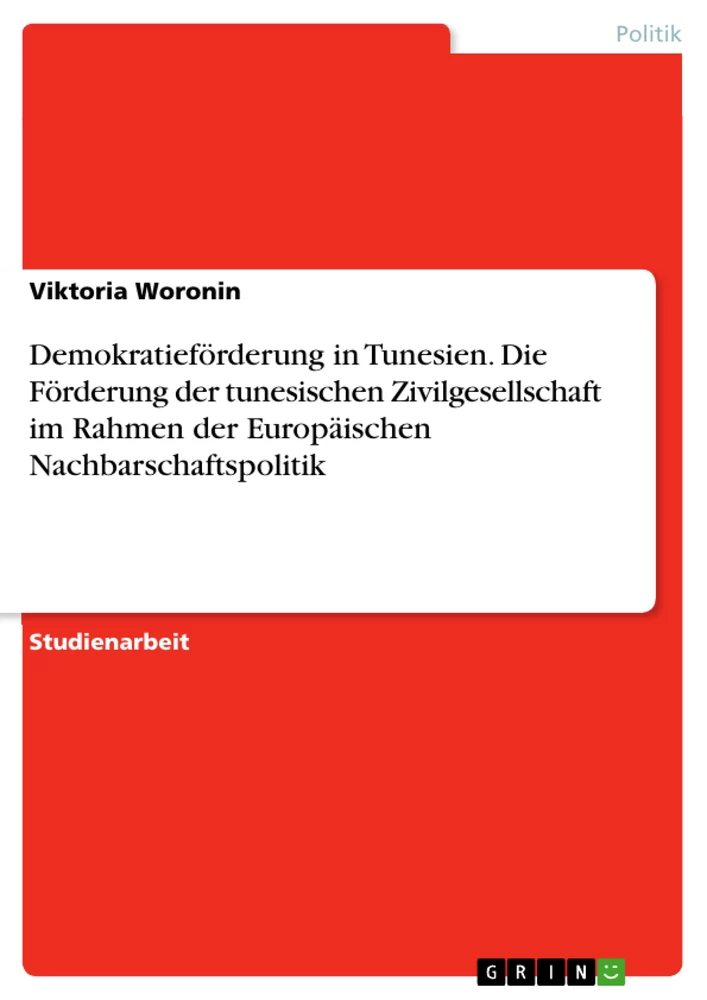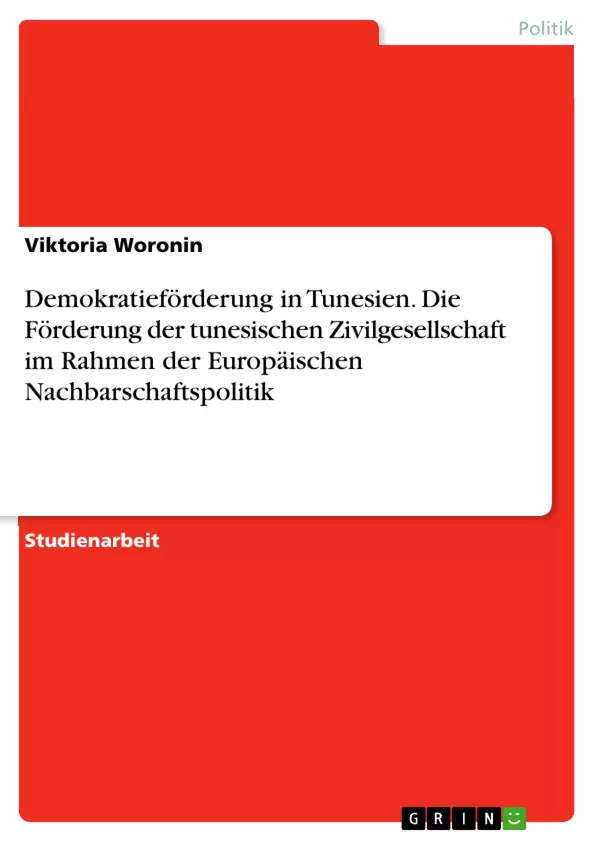Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die Förderung der tunesischen Zivilgesellschaft im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) verläuft, gemessen an den Ansprüchen der EU und der tatsächlichen Fortschritte.
Mit der 2004 in Kraft getretenen und sich an Staaten ohne Beitrittsperspektive richtenden ENP nahm die Europäische Union (EU) es sich zum Ziel, einen „ring of friends“ zu schaffen. Damit wollte sie zur Konfliktprävention und Krisenbewältigung in den an sie grenzenden Staaten beitragen, gemeinsame Sicherheitsbedrohungen bekämpfen, gute Regierungsführung (‚good governance‘) fördern, ihre Werte exportieren und zu Wohlstand und Stabilität beitragen.
Einer ihrer Partnerstaaten ist Tunesien, mit dem sich diese Arbeit auseinandersetzt. Dieses Land ist von Interesse, weil es als Musterbeispiel für wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Nordafrika gilt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Demokratieförderung in der ENP
- 2.1. Definition und Mittel
- 2.2. Kritik an der Umsetzung
- 3. Demokratieförderung in Tunesien bis zum,Arabischen Frühling‘
- 3.1. Verlauf der Förderung der tunesischen Zivilgesellschaft
- 3.2. Die tunesische Zivilgesellschaft unter der Präsidentschaft Ben Alis
- 4. Die tunesische Zivilgesellschaft seit dem,Arabischen Frühling‘
- 4.1. Entwicklungen
- 4.2. Förderungsmaßnahmen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erfolge der Förderung der tunesischen Zivilgesellschaft im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) und prüft dabei, ob die EU-Ansprüche mit den tatsächlichen Fortschritten übereinstimmen. Die Arbeit analysiert die Maßnahmen und die Wirksamkeit der Demokratieförderung durch die EU in Tunesien, insbesondere im Kontext der Zivilgesellschaft.
- Die Rolle der Zivilgesellschaft in der Demokratieförderung
- Die Ziele und Mittel der Europäischen Nachbarschaftspolitik
- Die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Förderung der tunesischen Zivilgesellschaft
- Die Auswirkungen der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Zivilgesellschaft in Tunesien
- Die Erfolgsfaktoren und Hindernisse der Demokratieförderung in Tunesien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Fragestellung und die Hypothesen der Arbeit, die sich mit der Effektivität der Förderung der tunesischen Zivilgesellschaft im Rahmen der ENP befassen.
Kapitel 2 beleuchtet die Definition und die Mittel der Demokratieförderung der EU im Rahmen der ENP. Es diskutiert die Kritik an der Umsetzung der Demokratieförderung und den Herausforderungen, die sich aus der mangelnden Bereitschaft einiger Partnerstaaten ergeben.
Kapitel 3 beleuchtet die Förderung der tunesischen Zivilgesellschaft bis zum Ausbruch des "Arabischen Frühlings". Es beschreibt die Entwicklung der Zivilgesellschaft unter der Präsidentschaft Ben Alis und die spezifischen Herausforderungen dieser Zeit.
Kapitel 4 untersucht die Förderung der tunesischen Zivilgesellschaft seit dem "Arabischen Frühling" und analysiert die Entwicklungen sowie die Maßnahmen der EU zur Unterstützung der Zivilgesellschaft in dieser Phase des Wandels.
Schlüsselwörter
Demokratieförderung, Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP), Zivilgesellschaft, Tunesien, "Arabischer Frühling", Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Menschenrechte, Politische Kultur, Wirtschaftsförderung, EU-Finanzierung, Liberalisierungsstrategie
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP)?
Die ENP zielt darauf ab, einen „Ring von Freunden“ um die EU zu schaffen, um Stabilität, Sicherheit, Wohlstand und gute Regierungsführung in Partnerstaaten ohne Beitrittsperspektive zu fördern.
Wie wird die tunesische Zivilgesellschaft durch die EU gefördert?
Die Förderung erfolgt durch finanzielle Unterstützung, Programme zur Stärkung von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Maßnahmen zum Export europäischer Werte wie Menschenrechte und Demokratie.
Welche Rolle spielte die Zivilgesellschaft unter Präsident Ben Ali?
Unter Ben Ali war die Zivilgesellschaft stark eingeschränkt. Die Arbeit analysiert die spezifischen Herausforderungen und Unterdrückungsmechanismen dieser Ära vor dem Arabischen Frühling.
Wie hat der Arabische Frühling die Demokratieförderung in Tunesien beeinflusst?
Nach dem Arabischen Frühling entwickelten sich neue Dynamiken. Die EU passte ihre Fördermaßnahmen an, um den politischen Wandel und die Eigenständigkeit der tunesischen Zivilgesellschaft zu unterstützen.
Stimmen die EU-Ansprüche mit den tatsächlichen Fortschritten überein?
Die Arbeit untersucht kritisch die Diskrepanz zwischen den rhetorischen Zielen der EU und der praktischen Wirksamkeit der Demokratieförderung vor Ort.
- Citation du texte
- Viktoria Woronin (Auteur), 2017, Demokratieförderung in Tunesien. Die Förderung der tunesischen Zivilgesellschaft im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1061070