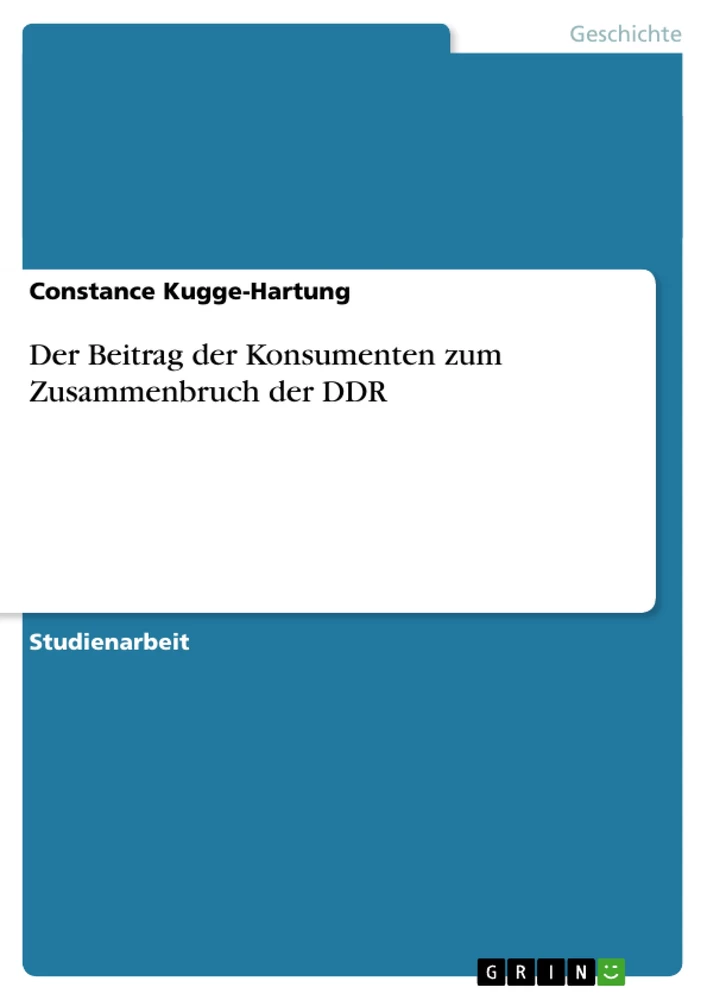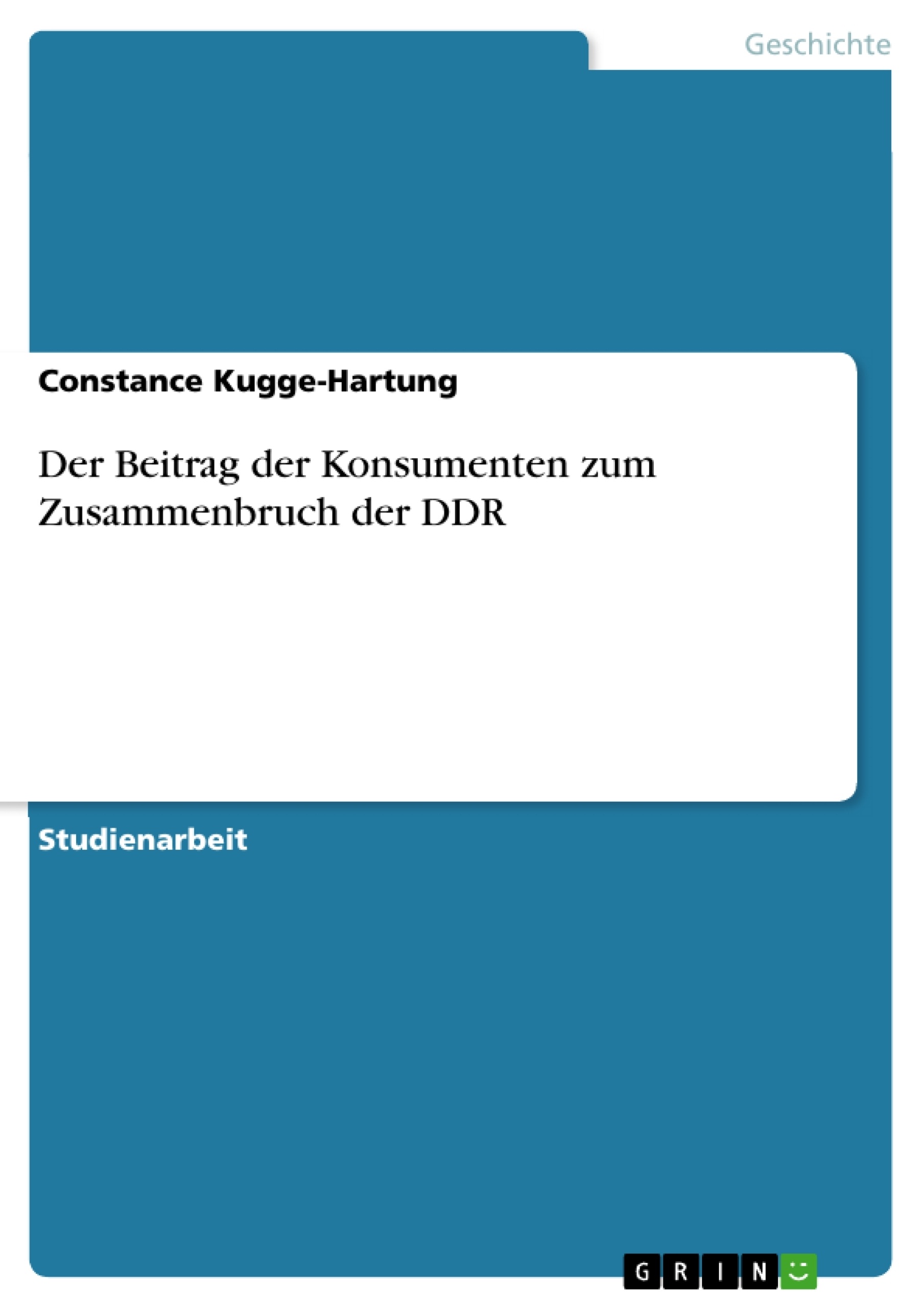Was bleibt vom Leben in der DDR, wenn man den Blick auf Konsum und Alltagskultur richtet? Diese intriguerende Frage steht im Zentrum einer Analyse, die weit über die übliche wirtschaftshistorische Betrachtung hinausgeht und die Konsumgewohnheiten, Produktkultur und den gesellschaftlichen Wertewandel in der DDR in den Fokus rückt. Entdecken Sie, wie der Mangel an begehrten Gütern, die unerfüllten Konsumwünsche und die ständige Konfrontation mit dem westlichen Überfluss das Fundament des sozialistischen Staates untergruben. Die Arbeit beleuchtet, wie Konsum in der DDR nicht nur eine Frage der Bedürfnisbefriedigung, sondern ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Wandels, der politischen Ideologien und der individuellen Identitätsfindung war. Von den unerreichbaren Westprodukten über die ideologisch aufgeladene "entwickelte sozialistische Persönlichkeit" bis hin zur Konsumsehnsucht, die schließlich zur Massenbewegung wurde, wird ein vielschichtiges Bild der DDR-Gesellschaft gezeichnet. Erfahren Sie, wie die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Propaganda und Alltagserfahrung, das Vertrauen in das System erodierte und den Weg für die politische Wende ebnete. Die Analyse zeigt, dass der Zusammenbruch der DDR nicht nur ein politisches oder wirtschaftliches Versagen war, sondern auch eine Folge der gescheiterten Konsumpolitik und der damit verbundenen Enttäuschung der Bürger. Die Geschichte der DDR wird hier aus einer neuen, überraschenden Perspektive erzählt – als eine Geschichte des Konsums, der Sehnsüchte und der letztendlich unerfüllten Versprechen. Schlüsselwörter: DDR, Konsum, Konsumgesellschaft, Alltagskultur, Mangelwirtschaft, Produktkultur, Systemwettbewerb, Wende, sozialistische Persönlichkeit, Identität, Propaganda, Westfernsehen, Lebensstandard, politische Wende, deutsche Geschichte, Ostalgie, Konsumverhalten, gesellschaftlicher Wandel, Beduerfnisbefriedigung, Wirtschaftspolitik, Konsumkonditionierung, Vergleich Ost und West, sozialistische Ideologie, Konsumpolitik, Alltagserfahrung, politische Wende, Kaufkraft, Lebensqualitaet, Konsumwunsch, Produktgestaltung, Konsumrausch, Konsumentensouveränität, Entfremdung, Versorgungslage. Warenästhetik, Konsumtrends, Konsumverhalten, soziale Prozesse, Massenkonsum, Konsumforschung, Marken, Konsumentenverhalten, Marketing, Wirtschaftswunder, Transformation, Diktatur, Teilung Deutschlands, Kalter Krieg, deutsche Wiedervereinigung. Diese Arbeit ist ein Muss für alle, die die Hintergründe der deutschen Wiedervereinigung wirklich verstehen wollen und die sich für die Bedeutung des Konsums in modernen Gesellschaften interessieren.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einführung
2. Begrifflichkeiten
2.1. Konsum
2.2. Konsumgesellschaft
2.3. Produkt, Produktkultur
3. Thesen
3.1. Konsum-Gefrierschrank DDR
3.1.1. Die goldenen Sechziger?
3.1.2. Der verlorene Systemwettlauf
3.2. Konsum als Destabilisierungsfaktor
3.2.1. Die entwickelte sozialistische Persönlichkeit
3.2.2. Warum im Westen das Gras grüner war
4. Zusammenfassung
4.1. Einsichten
4.2. Aussichten
5. Literaturverzeichnis
1. Einführung
In einem Seminar zu deutscher Kulturgeschichte nach dem zweiten Weltkrieg spielt die deutsche Wiedervereinigung mit all ihren Ursachen und Folgen eine zentrale Rolle. Im vorliegenden Fall geschah die Auseinandersetzung mit diesem Thema unter dem Blickwinkel der Wirtschaftsbezogenheit von Kulturgeschichte. Wichtiger Aspekt einer so fokussierten Betrachtung ist auch der individuelle Konsum und seine gesellschaftlichen Auswirkungen.
Bereits an dieser Stelle gabelt sich der Weg der Geschichte nach Ost und West. Während im Westen Konsum ein detailliert erforschtes Feld gesellschaftlicher Realität war, bezeichnete dasselbe Wort im Osten Deutschlands bis 1989 (mit Betonung auf der ersten Silbe) ungeliebte Verkaufseinrichtungen, in denen die Mängel des Systems für jeden Bürger deutlich sichtbar zutage traten.
Ich möchte in dieser Arbeit das Augenmerk auf die Bedeutung des Konsums für den Zusammenbruch der DDR lenken. Nach meinen Recherchen ist das Thema Konsum für soziologische und kulturgeschichtliche Betrachtungen in Deutschland eher ein Randthema. Konsum ist in der Konsumgesellschaft aber nicht nur wirtschaftliche Antriebskraft, sondern sowohl Ursache als auch Ergebnis von Wertewandel und gesellschaftlicher Entwicklung.1 Dieser Bedeutung des Konsums möchte ich mich in meiner Arbeit nähern und nach seiner Rolle für die politische Wende in der DDR fragen.
Allerdings werde ich keine soziologische Betrachtung anstellen oder systematisch empirische Daten auswerten, sondern - bezogen auf die Intention des zugrundeliegenden Seminars - Konsum als kulturellen und treibenden Faktor für die geschichtlichen Abläufe, die zur politischen Wende in der DDR führten, einzuordnen versuchen. Ich habe den Hauptteil der Arbeit in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil werde ich die notwendigen Begriffe klären. Dies ist nur vor dem historischen Hintergrund, in den die Begriffe eingebettet sind, möglich. Im zweiten Teil werde ich, an die geschichtliche Entwicklung des Themas anschließend, zwei Thesen behandeln: Zuerst werde ich den zwiespältigen Umgang der DDR mit ihrer Lokalisierung in der Konsumgesellschaft aufzeigen, indem ich verpassten Entwicklungen nachspüre. Desweiteren werde ich mich der Frage widmen, wie durch den Konsum erzeugte Identität auf die Gesellschaft zurückwirkt, bzw. wie dauerhafte Mangelwirtschaft das Vertrauen in ein System untergraben kann. In der Zusammenfassung werde ich die gewonnenen Einsichten bewerten und den Versuch unternehmen, Ausblicke aufzuzeigen.
2. Begrifflichkeiten
2.1. Konsum
Der gute alte Brockhaus nennt als Herkunft für das Wort Konsum das italienische consumo (Verbrauch), dies wiederum wird abgeleitet von lateinisch consumere (verbrauchen), um es schließlich als letzten Zweck allen Wirtschaftens zu definieren.2
Auch in Gablers Wirtschaftslexikon steht Ver- oder Gebrauch von Gütern im Vordergrund der Definition.3 Diese Auffassung wurde auch in der DDR geteilt. Im Lexikon der Wirtschaft von 1980 findet sich eine Definition für Konsumtion (Konsum selbst wird dort nicht definiert), die den Verbrauch von Gütern in produktiven und nichtproduktiven Verbrauch einteilt und in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung einen antagonistischen Widerspruch zwischen Konsumtion und Produktion ausmacht. In der sozialistischen Gesellschaft dagegen werde die Verbindung von Konsumtion und Produktion durch Distribution und Zirkulation gewährleistet.4 Inwiefern diese Behauptung ernst zunehmen oder als blanker Zynismus zu betrachten ist, muss Kennern der Materie vorbehalten bleiben. Dass die Einordnung des Konsums als reine Verbrauchskatagorie eine traditionelle Sichtweise ist, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass schon im Handwörterbuch der Staatswissenschaften von 1923 Konsumtion als Verbrauch von Gütern erklärt wird, welche als Begleiterscheinung der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung daherkommt.5
Da sich im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung auch der Konsum und seine Betrachtungsweisen gewandelt haben, bietet der Brockhaus im Unterschied zur rein ökonomischen Definition des Konsums zumindest für die Konsumforschung die Aspekte der soziologischen Betrachtung an: So sind die Erscheinungsformen des Konsums „kulturelle Derivate der Wirtschaftsformen moderner Gesellschaften“6 und werden als Maßstab industriellen und gesellschaftlichen Wohlstands gesehen. Gerhard Scherhorn verweist darauf, dass der klassische homo oeconomicus nicht ausreicht, um sich dem modernen Konsum zu nähern, da Konsum als Befriedigung rational begründbarer Bedürfnisse nicht zu erklären sei und dieser Tatbestand seit seiner Entstehung bestehe.7
Hans-Peter Müller erklärt Konsum zum sozialen Prozess, in dem Güter zirkulieren, die eine soziale Bedeutung tragen und zeigen. Er entwickelt diese Blickrichtung aus den konsumanthropologischen Arbeiten von Mary Douglas und Baron Isherwood. Sie weisen dem Konsum Funktionen zu, die weit über eine schlichte Produktentnahme vom Markt hinausreichen. So wird mittels Konsum die Persönlichkeit dargestellt, die soziale Stellung in der gesellschaftlichen Hierarchie angezeigt und der Grad von Gruppenzugehörigkeit gemessen.8 Diese Sichtweise wird für die Entwicklung meiner Thesen von Bedeutung sein.
2.2 Die Konsumgesellschaft
Die Entstehung der Konsumgesellschaft wird oft als Explosion, Revolution oder Geburt bezeichnet.9 Damit soll deutlich gemacht werden, dass sich die Konsumgesellschaft nicht gemächlich entwickelte, sondern, als Pendant zur industriellen Revolution, einen abrupten Bruch zur vorindustriellen Gesellschaft darstellte.10
Lokalisiert wird die Geburt der Konsumgesellschaft im England des 18. Jahrhunderts. Die Konsumrevolution war eng mit der industriellen Revolution verknüpft. Die Explosion der Nachfrage entstand durch steigenden Wohlstand und, damit einhergehend, wachsende Ansprüche. Damit wurden Werte der vorindustriellen Gesellschaft hinfällig und neue geschaffen. Eine Konsumkultur entwickelte sich, die, von England ausgehend, ihren Siegeszug durch Europa antrat. Die damit verbundenen geschichtlichen Veränderungen und gesellschaftlichen Entwicklungen sind eng mit den Werten der Konsumkultur verflochten.
Drei theoretische Ansätze dazu seien hier kurz vorgestellt: Zum ersten Veblens „Theorie der feinen Leute“, die als Motivation menschlichen Handelns das Bedürfnis, sich von anderen abzuheben, ausmacht. In der Konsumgesellschaft, in der Konsum für das Wertgefüge ein maßgeblicher Faktor ist, wird folglich wirtschaftliche und finanzielle Leistungskraft durch demonstrativen Konsum angezeigt.11
Zum zweiten Georg Simmels Trickle-down-Effekt, bei dem die unteren gesellschaftlichen Schichten die oberen imitieren und diese dadurch veranlassen, sich zwecks Differenzierung zu verändern, woraufhin die unteren Schichten wieder nachziehen usw.12 Dieser sich selbst erhaltende Kreislauf der Veränderung zieht eine Konsumspirale nach sich, die zunächst Änderung von Bedürfnissen, später aber auch von Wertgefügen mit sich bringt.
Zum dritten, den beiden vorangegangenen Ansätzen entgegengesetzt, gibt es die These von Galbraith, wonach ohne manipulatives Eingreifen zur Weckung von Bedürfnissen Tendenzen zur Sättigung des Marktes auftreten würden.13 Diese These impliziert, dass Konsumenten durch Manipulation zu unnötigem Konsum veranlasst werden. Die Ansätze von Simmel und Vershofen zeigen jedoch auf, dass dem Individuum, ganz gleich ob Konsument oder nicht, der Wunsch zu Nachahmung, Differenzierung und Entwicklung innewohnt. Dass in der Konsumgesellschaft dieser Drang mittels Konsum ausgelebt wird, macht den Menschen noch nicht zum willfährigen Opfer manipulativer (Werbe)Strategien. Die kritische Theorie sah dies allerdings bis in die 90er Jahre so.14 Nachdem die Konsumgesellschaft sich im 18. und 19. Jahrhundert als Wertgefüge etabliert hatte, waren im 20. Jahrhundert zwei Faktoren für ihre Weiterentwicklung maßgeblich: Zum einen wurde durch die Erhöhung der Einkommen und damit steigende Nachfrage die Massenkonsumkultur möglich, zum anderen entwickelte sich die Konsumkultur zur Erlebnisorientierung hin. Ein theoretischer Ansatz dafür ist die Theorie des imaginativen Hedonismus von Campbell.15 Sie besagt, dass bei ausreichender Güterversorgung der Genuss zum Ziel des Konsumentenverhaltens wird und nicht mehr nur Nebeneffekt des Konsums ist.
Ich hoffe, damit hinreichend gezeigt zu haben, dass Konsum weit mehr ist als Verbrauch von Gütern. Konsum ist ein sozialer Prozess, in dem Gesellschaftsmitglieder Bedeutungen und Identität konstruieren, sich ausdrücken, abgrenzen, verständigen, kommunizieren. So betrachtet dürfte Konsum für die Konsumgesellschaft, unabhängig von der jeweiligen Wirtschaftsordnung, mithin ein Indikator für gesellschaftliche Werte und ein Faktor für gesellschaftliche Veränderungen sein. Inwieweit dies für den Zusammenbruch der DDR gelten kann, wird anhand der hier vorgestellten Denkansätze zu zeigen sein.
2.3 Produkt, Produktkultur
Konsum ist nicht denkbar ohne die Produkte, um die sich dieser soziale Prozess rankt. Aus der ökonomischen Perspektive werden zwei Funktionsarten von Produkten unterschieden: Man spricht hier von der Gebrauchsfunktion und der Geltungsfunktion. Die Gebrauchsfunktion wird durch die technische, wirtschaftliche, soziale und ökologische Nutzung bestimmt, während die Geltungsfunktion, darüber hinausgehend, Aspekte wie Prestige und Ästhetik einbezieht.16
Aus kulturtheoretischer Sicht stellen sich die Dinge weitaus differenzierter dar. Reinhard Eisendle und Elfie Miklautz haben in ihrem Buch „Produktkulturen“ wichtige historische und moderne Aspekte von Produktkultur zusammengetragen.
Sie beginnen mit einem Klassiker: Georg Simmel hat Produkten soviel Bedeutung zugewiesen, dass er sie als „Körper der Kultur“17 bezeichnet. Clifford Geertz spricht abstrahierend von den materiellen Artefakten, die als Modelle von und für Kultur kollektive Werte manifestieren.18
Neben der üblichen, ökonomischen Betrachtungsweise von Produkten versuchen Eisendle und Miklautz, den Bereich der kulturtheoretischen Bedeutungszuweisung von Produkten ins Blickfeld zu rücken. Unter diesem Blickwinkel werden Produkte zu mehr als reinen Tausch- oder Gebrauchswertobjekten. Sie werden zu Trägern von sozialen Bedeutungen.19 In allen Aktivitäten, die sich um Herstellung, Vertreibung und Verbrauch von Produkten drehen, wird soziale Bedeutung erzeugt und verändert. Insbesondere findet diese Produktion von Bedeutung in der Kommuniktion über Produkte statt. Produkte tragen in der Konsumgesellschaft damit maßgeblich zur Entwicklung von Identität bei.20 Auch andere Autoren betonen diese identitätsstiftende Funktion der Konsumtion von Produkten.21
Dass Produktdifferenzierung durch äußerliche Gestaltung zu einer eigenen Kulturform, der Produktkultur, führt, leitet sich aus dieser kulturtheoretischen Sichtweise folgerichtig ab. Bereits im 18. und 19,. Jahrhundert entwickelte sich eine Konsumkultur , die auf einem Muster an Werten und Beziehungen beruhte, das sich auf den Kauf und die Konsumtion von Gütern bezog.22 In der westlichen Kultur werden also mit der Produktion von Gütern maßgebliche Symbole und Werte geschaffen.
3. Thesen
Konsumkultur ist Alltagskultur schlechthin. Diese Einordnung muss zu Beginn der Betrachtung der DDR-Konsumkultur getroffen werden. Über Alltag als Kulturform zu sprechen, ist lange Zeit weitgehend ungewöhnlich gewesen. Kultur wurde, und wird heute noch gerne, in erster Linie mit Hochkultur in Zusammenhang gebracht. Gerade für die historische Analyse gesellschaftlicher Transformationen von so umwälzendem Ausmaß wie im Osten Deutschlands ist die Alltagsperspektive jedoch ein legitimer Zugang.23 Da das System der DDR, so Ehrhard Neubert, seine eigentliche Niederlage im Alltag erlitt, ist es für das Verständnis des Umbruchs in Ostdeutschland besonders wichtig, diesen Alltag genau zu rekonstruieren.24 Die von einer so breiten Mehrheit der Bevölkerung getragene Forderung nach Systemveränderung muss eine ebenso breit angelegte Ursache gehabt haben. Diese Ursache auch in der Konsumkultur zu suchen, wird, mittels der folgenden Arbeitsschritte, Anliegen der von mir formulierten Thesen sein. Ich werde beispielhaft auch eigene Alltagserfahrungen zur Untermauerung der Thesen einbringen.
3.1 Konsum-Gefrierschrank DDR
Wenn Besucher aus dem Westen Deutschlands die DDR besuchten, fanden sie in jedem Fall seltsam altmodische Verhältnisse vor. Dem einen erschien die DDR liebenswert und schlicht, der andere erlitt einen Kulturschock, wenn er das erste Mal auf Vertreter der führenden Klasse - des Proletariats - stieß. Wie auch immer die individuellen Eindrücke waren, es lässt sich feststellen, dass gewisse Entwicklungen eingefroren zu sein schienen. Dies lässt die Frage aufkommen: Wo begann DDR? Was fanden die Erbauer des Sozialismus nach dem Ende des zweiten Weltkrieges vor?
Wie bereits in der Begriffsklärung aufgezeigt, existierte in Deutschland vor dem zweiten Weltkrieg eine hochentwickelte Konsumgesellschaft mit Tendenz zu Massenkonsum und Erlebnisorientierung. In diese homogene Entwicklung machte die Spaltung Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg einen tiefen Schnitt. Während in den westlichen Besatzungszonen Marshall-Plan und Währungsreform griffen und mit der erfolgreich eingeführten sozialen Marktwirtschaft das Wirtschaftswunder zu blühen begann, wurde in der sowjetischen Besatzungszone ein wirtschaftlicher Großversuch gestartet, der seinesgleichen suchen dürfte.
In dem nicht nur vom Krieg zerrütteten Land, sondern auch in dem Teil Deutschlands, der kaum über Bodenschätze oder nennenswerte Industrie verfügte, wurde nach dem Willen der militärischen Befehlshaber ein planwirtschaftliches System aufgebaut. Das zentralverwaltungswirtschaftliche System, basierend auf einer sozialistischen Gesellschaftstheorie, wurde umfassend eingeführt. Zugrundeliegend ist bei diesem Modell die Idee, dass eine gerechte und herrschaftsfreie Gesellschaftsordnung nur durch die Überführung der Produktionsmittel in Volkseigentum möglich ist. Der Einsatz der Produktionsmittel untersteht einer zentralen Planungsbehörde. Die Planungsbehörde legt fest, was, wie viel und für wen produziert werden soll. Einen Bedarf am Markt gibt es dabei nicht, sondern der Bedarf wird auf der Grundlage gesellschaftlicher Zielsetzungen festgelegt.25
Eigentlich handelt es sich bei dieser Wirtschaftsordnung um ein Modell, das in dieser Reinform wohl kaum existieren kann, für den Aufbau der DDR wurde jedoch die reine Lehre verfolgt, so dass marktwirtschaftliche Aktivitäten während der gesamten Laufzeit dieses Modells nahezu im Keim erstickt wurden. Diese Ausgangsbedingen vorausgesetzt, ist es kein Wunder, wenn nun Beobachter sagen, der Anfang der DDR war im Grunde genommen auch schon ihr Ende, das Wettrennen bereits verloren, ehe es überhaupt begonnen hatte.26 Es liegen umfangreiche Arbeiten zur Wirtschaft der DDR vor, deshalb soll dieses Thema hier nicht ausgeweitet werden. Der Staat DDR baute auf der kollektiven Erinnerung an die Konsumgesellschaft auf, lehnte ihre freie Entwicklung aber bald als bürgerlich ab.
3.1.1 Die goldenen Sechziger?
Obwohl DDR in der bitteren Not der Nachkriegszeit begann und im wirtschaftlichen und politischen Ruin von 1989 endete, gibt es in der Retrospektive eine Zeit, die sich aus dem allgemeinen Grau der „Fürsorgediktatur“27 herauszuheben scheint.
Mir, als Kind der siebziger Jahre, erschienen die wenigen verbliebenen Relikte aus der Jugend meiner Eltern als Zeugen einer glanzvollen Vergangenheit. Da fanden sich edel gearbeitete Kosmetik-Utensilien, Kleider, die bei der Schneiderin angefertigt worden waren, ja sogar zwei Wildlederjacken im Partnerlook. In meiner frühen Jugend hinkte die Mode der DDR der westlichen um zehn Jahre hinterher, war allen bürgerlichen Konsumgewohnheiten dank Propaganda und Mangelwirtschaft längst erfolgreich abgeschworen worden. Insofern könnte tatsächlich der Eindruck entstehen, es habe in der DDR so etwas wie „goldene Sechziger“ gegeben. Wer dies behauptet, vergisst jedoch, mit welch hohem Preis dieser Aufschwung bezahlt worden war. 1961 wurde mit der Mauer ein wirksamer Schutz gegen unkontrollierte Austauschaktivitäten mit dem Westen Deutschlands errichtet. Natürlich war der DDR-Führung nach dem 17. Juni 1953 klar geworden, dass der Sozialismus nicht vollkommen an den elementarsten Bedürfnissen der eigenen Bürger vorbei aufgebaut werden konnte.28 Der Zusammenhang von Mauerbau und Konsumaufschwung diente dem Machterhalt des politischen Systems. Dieser Zusammenhang, und das Wissen um ernsthafte Versorgungskrisen bei Grundnahrungsmitteln noch Anfang der sechziger Jahre, lassen es nicht zu, von einer goldenen Zeit zu sprechen. Zwar heben sich die sechziger Jahre im Vergleich zur nachkriegsbedingten Not in den Fünfzigern und der Stagnation in den siebziger und achtziger Jahren aus der kontinuierlichen Entwicklung der Mangelwirtschaft heraus, die grundlegenden Mängel des DDR-Systems griffen jedoch auch in dieser Zeit und individueller Konsum war nach wie vor ein Problembereich.
3.1.2 Der verlorene Systemwettlauf
Dass der Systemwettlauf verloren war, macht sich für mich in zwei Beobachtungen deutlich:
Die Ästhetik der meisten Konsumprodukte, die in der DDR hergestellt wurden, nahm zum Ende hin immer mehr ab. Ich habe diese Hässlichkeit immer als eine Lieblosigkeit gegenüber denen empfunden, die diese Produkte kaufen mussten, ganz abgesehen davon, welche Schwierigkeiten es bereitete, einigen Produkten überhaupt auf die Spur zu kommen.
Der allgegenwärtige Mangel, von Sozialromantikern zur edlen Schlichtheit stilisiert, machte das Leben für die Mehrheit der Bevölkerung unerträglich. Dies belegen auch historische Befunde.29 Der Mangel wurde als entwürdigend und mühselig empfunden und „war nur zu ertragen, weil es den anderen auch nicht besser ging.“30 Die traurige Erscheinungsform vieler Konsumgüter wurde sogar öffentlich thematisiert. So verspottete das Satire-Magazin Eulenspiegel die eigens für die junge Generation kreierte Jugendmode als hässlich und teuer, nur „Für die kleine Oma mit Lottofünfer.“ geeignet.31 Kein Wunder, dass nach dem Versuch, die Produktwerbung zur Vermarktung von Ladenhütern umzufunktionieren, diese schließlich ganz abgeschafft wurde.
Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, und so gibt es auch Verfechter einer These vom reinen Gebrauchswert der DDR-Produkte, die in ihrer Ästhetik nicht auf irreführenden Produktwettkampf angewiesen sind und sich nur zum Schein unterscheiden müssen.32 Tatsache ist jedoch, dass die Bürger der DDR mit dieser kargen Erscheinungsform der Produkte nicht zufrieden waren, bei vielen Dingen sehnsüchtig nach dem Westen Deutschlands schielten und den Unterschied zwischen DDR-Produkten und Westwaren zum Gradmesser der Unfähigkeit des politischen Systems machten. Ein bezeichnender Witz für die Klarsicht, mit welcher der ruinöse Zustand der DDR von ihren Bewohnern beurteilt wurde, lautete: „1945 standen wir am Rande des Abgrunds, heute sind wir schon einen Schritt weiter.“
Obwohl in diesem Witz ein gewisser Fatalismus steckt, ist er auch Spiegel für die platten Durchhalteparolen, die der Bevölkerung vierzig Jahre lang in den unterschiedlichsten Variationen präsentiert wurden.
Damit komme ich zur zweiten Beobachtung des verlorenen Wettlaufs: Hatte man in den sechziger Jahren noch vollmundig davon gesprochen, dass es nicht mehr lange dauere, bis die BRD eingeholt sei und der Kommunismus endlich in voller Schönheit errichtet werden könne, wurde in den siebziger Jahren aus der schönen Utopie unversehens der „real existierende Sozialismus“.
In meiner Schulzeit war ein geeintes Deutschland undenkbar, der Kommunismus wieder wissenschaftliche Theorie und die Floskel vom Einholen ohne Überholen Grundlage für zahlreiche bissige Verunglimpfungen. Dazu kam eine staatliche Hysterie gegen alles Westliche, die darin gipfelte, dass es Schülern verboten wurde, ihre Utensilien in westdeutschen Plastiktüten zu transportieren.33 Ich selbst hatte das einschneidende Erlebnis, in der ersten Klasse ein T-Shirt, auf dem weiße Sterne auf blauem Hintergrund und rot-weiße Streifen abgebildet waren - eine Symbolik, die mir als Erstklässlerin überhaupt nichts sagte - ausziehen und verkehrt herum tragen zu müssen, versehen mit der ernsthaften Mahnung meiner Lehrerin, nicht noch einmal für den Klassenfeind „Werbung zu laufen“. Der Vergleich mit dem Westen wurde nicht mehr thematisiert. Die Ära Honecker begab sich nach scheinbar hoffnungsfrohem Start in eine Politik der Starrheit und Blindheit, die ihren Machterhalt mittels willkürlicher Geschenke, verpackt als Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, sicherte.
Wenigstens einen traurigen Sieg errang die DDR im Systemwettlauf: Das Gemisch aus Frustration und eingeschränktem Nahrungsmittelangebot führte dazu, dass die DDR- Bürger verfetteten (jeder vierte) und beim Pro-Kopf-Verbrauch an reinem Alkohol an der Weltspitze lagen.34
3.2. Konsum als Destabilisierungsfaktor
Bei der Begriffsklärung war schon herausgestellt worden, dass Konsum als sozialer Prozess maßgeblich zur Identitätsbildung beiträgt. Diese These vorausgesetzt, kann eine Gegenüberstellung der ost- und westdeutschen Konsumphasen interessante Rückschlüsse auf häufig bemühte, unterschiedliche Mentalitäten in Ost und West zutage bringen. Die Konsumtrends der BRD lassen sich grob nach Friedrich A. Rode skizzieren: Von 1945-55 finden wir demonstrativen Konsum ohne soziale Gegenbewegung, sozusagen als Kompensation für die Entbehrungen des Krieges. Die Blue-Jeans-Revolution von 1955-65 wird gefolgt von der Spaltung in Freizeitwelle und Konsumaskese von 1965-75. Daraufhin überlässt sich von 1975-85 eine satte Turnschuhgeneration der Nullbock-Stimmung, während neue gesellschaftliche Bewegungen auf den Plan treten, um schließlich - so resümiert Rode 1989 - von einer neuen Generation von Konsumenten abgelöst zu werden, die es nach mehr Menschlichkeit und verantwortungsvollem, bewusstem Konsum verlangt.35 Bei dieser Entwicklung ist nachvollziehbar, wie sich jede Generation in konsumbestimmte Wertgefüge eingeordnet oder dagegen rebelliert hat.
In der DDR werden drei Phasen aufgelistet:36 Die Zeit von 1945-58 wird als Nachkriegszeit mit Not und Mangel gewertet, gleichzeitig werden noch bürgerliche Lebensstile nachgeahmt. In den sechziger Jahren werden einerseits eine Modernisierungswelle aufgrund gewachsener Bedürfnisse und andererseits anhaltende Versorgungskrisen festgestellt. In den siebziger- und achtziger Jahren tritt schließlich völlige Stagnation ein. Die Phasen des Konsums in der DDR sind durchgängig von Mangel und damit einhergehender Unzufriedenheit der Bevölkerung geprägt. Die Generationen, die ihre Sozialisation und Identitätsbildung unter diesen Umständen erlebten, entwickelten folglich auch als Konsumenten eine andere Identität als vergleichbare westliche Generationen. Diese Identität war davon geprägt, in einem System zu leben, das nicht in der Lage war, die konsumtiven Grundbedürfnisse angemessen zu befriedigen. Natürlich hungerte niemand in der DDR, doch die unkontinuierliche Versorgung untergrub das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat und ließ zumindest den Eindruck entstehen, das Individuum sei als Konsument ungeliebt. Dass dies destabilisierend auf das gesellschaftliche System wirkt, belegt der Umstand, dass Lebenszufriedenheit und Glück zu einer positiven Haltung gegenüber der eigenen Gesellschaft beitragen.37
Dazu kam die Möglichkeit des Vergleichs mit dem Westen. Die Tatsache, dass Menschen der gleichen Sprache und Herkunft wesentlich besser lebten, musste zu Zweifeln am System führen. In Kapitel 3.1.2 bin ich schon darauf eingegangen, wie beschämend dieser Vergleich sein konnte. Doch diesen Zweifeln und von außen eindringenden bürgerlichen Konsumgewohnheiten wollte der Staat eine eigene Idee entgegensetzen.
3.2.1 Die entwickelte sozialistische Persönlichkeit
Nachdem der Aufbau des Sozialismus an den Bedürfnissen der Menschen vorbei knapp der Katastrophe entgangen war, wurde mit dem Ende der Ära Ulbricht eine wirtschaftspolitische Kurskorrektur zur Stabilisierung der SED notwendig.38 Die gewachsenen Bedürfnisse wurden nun zumindest anerkannt, waren als solche aber gestaltungsbedürftig. Durch die Erziehungsarbeit der Partei sollten sie in die richtigen Bahnen gelenkt werden, sollte aus dem niederen Konsummenschen ein Kulturmensch werden. Das Idealbild der „allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit“ entstand. Natürlich legte Vater Staat fest, was modern und schön oder imperialistisch und verwerflich war. Das „Wohl der Menschen war...gedacht...als die Zuweisung eines Lebensstandards, dessen Kriterien die Partei bestimmte und der an den Zielen der Arbeiterbewegung der Weimarer Republik bestimmt war“.39 Und so wuchs die entwickelte sozialistische Persönlichkeit in einem unüberbrückbaren Zwiespalt auf. Einerseits hausbackener Propaganda, der sich in der DDR niemand vollständig entziehen konnte, andererseits dem seit 1973 legalisierten Westfernsehen, das von einer anderen Welt kündete, ausgesetzt. Auch die in den Schulen systematisch verbreitete These vom faulenden und stinkenden Imperialismus konnte im Intershop überprüft und verworfen werden.
Diese zwiespältige Lebensweise darf jedoch nicht in Richtung gespaltener Persönlichkeiten fehlinterpretiert werden. Sie diente vielmehr als Überlebensinstrument zur Herstellung von Normalität. Hätte diese Zwiespältigkeit ständig in voller Schärfe bestanden, wäre normales Leben unter den Bedingungen des DDR-Systems wohl kaum möglich gewesen.
Darüber hinaus wurde die entwickelte sozialistische Persönlichkeit einer halbfreiwilligen Vergemeinschaftung unterzogen. Halbfreiwillig deshalb, weil sie zwar vom Staat vorgegeben wurde, von vielen aber ohne Widerstand praktiziert wurde. Der organisierte Freizeitbereich als Zwischenbereich zwischen Staat und Privatsphäre diente bis in die achtziger Jahre als Kontrollmöglichkeit von Freizeitaktivitäten.40 Danach setzte ein Trend zur Individualisierung ein und die Menschen entzogen sich dieser Ebene zunehmend.
In den achtziger Jahren räumt denn auch das Institut für Marktforschung ein, dass die Erziehung und Beeinflussung der Bevölkerung bezüglich ihrer Bedürfnisse gescheitert sei.41 Dies werte ich als ein deutliches Indiz dafür, dass auch die Erziehung zur allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit die Menschen nicht so manipulieren konnte, dass sie keinen einfachen Vergleich mehr anstellen konnten. Langsam aber sicher begann die Konsumentensouveränität, die es seit Entstehung der DDR nicht mehr gegeben hatte, hervorzubrechen. Die in Kapitel 2.2 diskutierten Theorien der gesellschaftlichen Entwicklung mittels Konsum funktionierten auch in der DDR, denn die DDR war, entgegen allen offiziellen Beteurungen, tief in der Konsumkultur verwurzelt. Allerdings lagen die Bemessungskriterien für Nachahmung und Differenzierung außerhalb der gelebten Wirklichkeit.
Die SED-Führung selbst lebte diesen Spagat vor, indem sie sich mehr aus der Auseinandersetzung mit dem Westen als aus sich selbst heraus definierte.42 Die Bevölkerung tat ihr dies aus naheliegenden Gründen nach und wies den westlichen Konsumgütern einen höheren Wert zu als ihren östlichen Pendants.43 „In“ war deshalb, was aus dem Westen kam, wer über Westprodukte verfügte, war Trendsetter. Wer nicht mithalten konnte, stellte wenigstens wieder aufgefüllte Westverpackungen zur Schau oder versuchte andere Nachahmungsmethoden. Selbst in der Tschechoslowakei gekaufte Nivea- Creme, unverkennbar durch ihren tschechischen Aufdruck, wurde damals noch besser bewertet als die einheimische Florena. DDR-Produkte führten also nicht zur Identifikation mit dem politischen System, sondern vielmehr zur schleichenden Entfremdung und Abgrenzung. Dagegen half auch keine Propaganda. Die breiteste gesellschaftliche Bewegung der DDR war die der unzufriedenen Konsumenten.
3.2.2 Warum im Westen das Gras grüner war
Nachdem sich schließlich Unzufriedenheit und Enttäuschung, eben nicht nur bezüglich der Politik, sondern auch über die vier Jahrzehnte währende beschämende Versorgung, Bahn gebrochen hatte, gab es für die Konsumenten kein Halten mehr. Der von den Intellektuellen geschmähte Konsumrausch musste einfach befriedigt werden. Plötzlich standen ausnahmslos alle DDR-Bürger leibhaftig vor der glänzenden Fassade des Wohlstands und durften daran teilhaben. Dass der Konsumstau nun ungehindert aufgelöst werden konnte, ist den DDR-Konsumenten nicht vorzuwerfen. Sie waren, je nach Lebensalter, mit mehr oder weniger vielen hilflosen Versuchen, einen westlichen Standard zu imitieren oder vorzutäuschen, konfrontiert worden. Die realitätsfernen Bemühungen der DDR-Führung, die wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, hatten nicht nur auf der ganzen Linie versagt, sondern eine gigantische Schuldenspirale in Gang gesetzt, die letztlich nur zum wirtschaftlichen Ruin beitragen konnte. Da kaum lukrative Exportgüter produziert wurden, sollte die steigende Verschuldung durch Produktivitätserhöhung ausgeglichen werden. Angesichts der desolaten Situation in den volkseigenen Betrieben ist dies eine bemerkenswert optimistische Lösung. Derart wirklichkeitsfern anmutende Versuche, zu retten was noch zu retten sein könnte, waren der Starrsinnigkeit der ausgehenden Honecker-Ära geschuldet. So sollten Umsatzsteigerungen des Handels nicht durch Produktionserhöhungen, sondern durch Preiserhöhungen erzielt werden.
Dass diese letzten Versuche zu ernsthafter Ent-Identifizierung mit dem System beitrugen, liegt auf der Hand. Der desolate Zustand des Wirtschaftssystems wurde für die Konsumenten täglich deutlich sichtbar. Mit Nachkriegs-Begründungen und Übergangszeit zum Kommunismus konnte diese Entwicklung nicht mehr begründet werden. Die gähnende Leere vieler Ladenregale und das andererseits reichlich vorhandene Überangebot an unbrauchbaren Ladenhütern machte den Alltag unerträglich. Die angeblich klassenlose Gesellschaft hatte sich, zumindest im Konsumbereich, in zwei deutlich sichtbare Klassen - die Valuta-Besitzer und die, die sie nicht besaßen, geteilt. Dazu kam ein Kaufkraftüberhang, der dazu führte, dass 1989 fünfzig Prozent der DDR-Bürger quasi auf ihrem Geld sitzen blieben, da sie nichts fanden, was sie dafür hätten kaufen können.44 Dieses Geld schlichtweg durch Preiserhöhungen abschöpfen zu wollen, war eine ausgesprochen platte Idee, die den Bürgern deutlich vor Augen führte, dass sie als souveräne Konsumenten nicht gefragt waren.
Dass sie, nachdem sie es mit eigenen Augen gesehen hatten, nach einem System verlangten, in dem sie als Konsumenten geliebt und umworben wurden, kann eigentlich nicht verwundern. Die Breite der Bewegung in der Wendezeit wurde gespeist aus dem breiten Konsens der Unerträglichkeit des alltäglichen Lebens in der DDR. Meiner Ansicht nach traten dabei, begründet durch die lange, unfreiwillige Konsumaskese, moralische und politische Fragen für die Mehrheit erst einmal in den Hintergrund. Nur so ist zu erklären, warum so schnell und machtvoll „Deutschland einig Vaterland“ gefordert und realisiert wurde. Die aufgeräumte und ihren Wohlstand offen zur Schau tragende BRD, schien gegen den angeblich moralisch sauberen, in der Realität aber verwahrlosten Staat DDR, wie das Land in dem Milch und Honig fließen.45 Selbst mir schien der Himmel über Westberlin blauer und das Gras in Coburg grüner zu sein.
4. Zusammenfassung
4.1. Einsichten
Ich hoffe, es ist ersichtlich geworden, dass der Bereich des privaten Konsums eine entscheidende Rolle bei der mentalen Vorbereitung der Bürgerinnen und Bürger der DDR auf die politische Wende spielte. Er war Grundlage für die breiteste zivile Bewegung, die die DDR jemals erlebt hat. Viele Bereiche des Wendegeschehens sind bereits gut erforscht. So zieren die Bibliotheken zahlreiche Bände zur Geschichte, Wirtschaft, dem politischen System und verschiedenen Gruppierungen in der DDR. Der Bereich des privaten Konsums in der DDR und seine Rückwirkungen auf das politische System ist als solcher jedoch noch nicht ausreichend systematisch erforscht.
Annette Kaminsky hat in ihrer „Kleinen Konsumgeschichte DDR“ eine umfassende Sammlung von Zeitdokumenten und historischen Quellen zusammengetragen, enthält sich jedoch einer dezidierten Wertung.
Die Enquetekommission des Deutschen Bundestages zur „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit“ hat sich in ihrem Band „Alltagsleben in der DDR“ dem Bereich des Konsums als einer Facette des Alltags genähert. Die Titelwahl, nämlich von SED-Diktatur zu sprechen, zeigt das ernsthafte Bekenntnis der Kommission, DDR nicht zu relativieren oder zu verharmlosen. Auch die Schriftenreihe des Bundesinnenministeriums „Am Ende des realen Sozialismus“ weist in diese Richtung und erhebt den Anspruch, einen nüchternen und realistischen Rückblick auf die DDR zu liefern.46 In diesen beiden Bänden wird sowohl die Makro- als auch die Mikroebene betrachtet. Neben Untersuchungen über die großen Zusammenhänge des sozialistischen Systems kommen auch Individuen zu Wort. Dem Konsum widmet sich auch Gernot Schneider in seinem Aufsatz „Lebensstandard und Versorgungslage“. Eine wertende Einordnung in die Destabilisierung der politischen Verhältnisse erfolgt jedoch auch hier nicht. Geschichtsforschung auf dem Territorium des zusammengebrochenen Staates DDR ist nach wie vor ein sensibler Bereich. Noch sind alle „Forschungsobjekte“ zu stark vom Thema betroffen, ist die Vergangenheit noch zu gegenwärtig. Thomas Lindenberger hat das zugrundeliegende Problem auf den Punkt gebracht, wenn er es als die Frage nach der Beteiligung der Beherrschten an ihrer Unterdrückung formuliert.47 Sein Anliegen ist es, eine differenzierte Sicht der DDR-Geschichte zu finden, ohne vorschnell in Opfer-Täter- Zuweisung zu verfallen. Dazu kann meines Erachtens die Konsumgeschichte einen entscheidenden Beitrag leisten, denn sie ist die Geschichte aller Gesellschaftsmitglieder. Niemand kann sich den Bedürfnissen des täglichen Lebens entziehen. Die DDR war Bestandteil der Konsumgesellschaft. In einer Gesellschaft, die sich stark am Konsum orientiert, können auch persönliche Verstrickungen über den Konsumbereich sichtbar gemacht werden. Insofern dürfte Konsumgeschichte besonders facettenreich und authentisch sein.
4.2 Aussichten
Die vielfach zitierte Ostmentalität stellt sich nach der Rezeption der vorliegenden Materialien unter anderem auch als systembedingte Konsumkonditionierung dar. Damit meine ich, dass viele Eigenheiten, die den Ostdeutschen als Mentalität zugeschrieben werden, auf ihre Sozialisation in der Mangelgesellschaft zurückzuführen sind. Konsummuster und Wertgefüge sind jedoch keine beständigen Größen, sondern einem ständigen Wandel unterzogen. Deshalb glaube ich nicht an eine fortbestehende, eigenständige Ost-Mentalität, die mit dem geographischen Gebiet der ehemaligen DDR gleichzusetzen ist. Laut analytischen Befunden überwiegt in Gesamtdeutschland im Konsum- und auch in anderen Lebensbereichen die Annäherung von Ost und West.48 Dies wird auch, trotz mancher Verklärung des DDR-Lebens, so bleiben, denn die Konsumgesellschaft geht ihren geschichtlichen Weg. Und mit ihr auch die Konsumenten des Ostens, die ihre Konsumentensouveränität wiedererlangt haben, sich für den konsumtiven Nachholbedarf der letzten Jahre nicht zu schämen brauchen und bereits neue, teils gesamtdeusche, teils spezifische Konsumgewohnheiten entwickelt haben.
Die angemahnte, differenzierte Sicht der DDR-Geschichte kann durch Konsumforschung mit Sicherheit vorangebracht werden. Eine weniger emotionsbeladene Sicht der DDRGeschichte wird aber möglicherweise erst von einer Generation, die diesem Teil der deutschen Geschichte mit mehr Abstand gegenübersteht, möglich sein.
5. Literaturverzeichnis:
Conley, Patrick: Das Kaninchen und die Schlange. Der Blick auf „den Westen“ im DDRFeature, in: Deutschland-Archiv, Leske und Budrich, Opladen, 6/2001
Boyer, Christoph/Skyba, Peter: Sozial -und Konsumpolitik als Stabilisierungsstrategie, in: Deutschland-Archiv, Leske und Budrich, Opladen, 4/99
Brockhaus, Bd. 12, Eigenverlag, 19. Auflage, Mannheim, 1990
Eisendle, Reinhard, Miklautz, Elfie (Hrsg.): Produktkulturen. Dynamik und Bedeutungswandel des Konsums, Campus, Frankfurt/Main; New York, 1992
Faulenbach, Bernd: Gründe des Scheiterns, in: Die DDR als Geschichte. Fragen -
Hypothesen - Perspektiven, in: Zeithistorische Studien, hrsg. von Kocka, Jürgen/Sabrow, Martin, Bd. 2, Akademieverlag, Berlin 1994
Faulenbach, Bernd: Alltag in der Diktatur, in: Alltagsleben in der DDR und in den neuen Ländern, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Band V, Nomos Verlag; Suhrkamp, BadenBaden; Frankfurt am Main 1999
Fritze, Lothar: Innenansicht eines Ruins, in Akademiebeiträge zur politischen Bildung, Olzog Verlag, München 1993
Fritze, Lothar: Panoptikum DDR-Wirtschaft. Machtverhältnisse, Organisationsstrukturen, Funktionsmechanismen, in: Akademiebeiträge zur politischen Bildung, Olzog Verlag, München 1993
Geiger, Herbert: Veränderungen im Konsum- und Freizeitverhaltenin: Alltagsleben in der DDR und in den neuen Ländern, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Bd. 5, Nomos Verlag;Suhrkamp, Baden-Baden;Frankfurt am Main 1999
Geyer, Michael: Industriepolitik in der DDR. Von der großindustriellen Nostalgie zum Zusammenbruch, in: Die DDR als Geschichte. Fragen - Hypothesen - Perspektiven, hrsg. von Kocka, Jürgen/Sabrow, Martin, Zeithistorische Studien, Bd. 2, Akademieverlag, Berlin 1994
Gutmann, Gernot/Buck, Hannsjörg F.: Die Zentralplanwirtschaft der DDR -
Funktionsweise, Funktionsschwächen und Konkursbilanz, in: Am Ende des realen
Sozialismus, hrsg. von Eberhard Kuhrt/Hannsjörg F. Buck, Gunter Holzweißig, Bd, 2, Leske und Budrich, Opladen 1996
Hadeler, Thorsten/Winter, Eggert: Gablers Wirtschaftslexikon, 15. Aufl., GablerVerlag, Wiesbaden 2000
Haug, Fritz Wolfgang: Kritik der Warenästhetik, 1. Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1972
Haug, Fritz Wolfgang: Warenästhetik und kapitalistische Massenkultur, Bd. 1, 1. Auflage, Argument-Verlag, Berlin 1980
Jäckel, Michael/Kochbau, Christoph: Notwendigkeit und Luxus. Ein Beitrag zur
Geschichte des Konsums, in: Konsum. Soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, hrsg. von Rosenkranz, D./Schneider, N.F., Leske und Budrich, Opladen 2000
Kaminsky, Annette: Wohlstand, Schönheit, Glück. Kleine Konsumgeschichte der DDR, 1. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2001
Kaschuba, Wolfgang/Merkel, Ina/Scholze-Irrlitz, Leonore/Scholze, Thomas:
Forschungsbericht Freizeitverhalten in der DDR, in: Alltagsleben in der DDR und in den neuen Ländern, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Bd. 5, Nomos Verlag;Suhrkamp, BadenBaden;Frankfurt am Main 1999
Kuhrt, Eberhard/Buck, Hannsjörg F./Holzweißig, Gunter: Am Ende des realen Sozialismus, 2 Bde, Leske und Budrich Opladen 1996 Lindenberger, Thomas: Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte der DDR, in: Zeithistorische Studien, hrsg. vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, Bd. 12, Köln 1999
Maser, Peter: Erscheinungsformen des Mangels, in: Alltagsleben in der DDR und in den neuen Ländern, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Band V, Nomos Verlag;Suhrkamp, Baden-Baden;Frankfurt am Main 1999
Maier, Charles: Vom Plan zur Pleite. Der Verfall des Sozialismus in Deutschland, in: Die DDR als Geschichte. Fragen - Hypothesen - Perspektiven, hrsg. von Kocka, Jürgen/Sabrow, Martin, Zeithistorische Studien, Bd. 2, Akademieverlag, Berlin 1994
May, Herrmann: Wirtschaftsbürger-Taschenbuch, 3. Auflage, Oldenbourg Verlag, Wien 1997
Müller, Hans-Peter: De gustibus non est disputandum? Bemerkungen zur Diskussion um Geschmack, Distinktion und Lebensstil, in: Eisendle, Reinhard/ Miklautz, Elfie, (Hrsg.) Produktkulturen, Campus-Verlag, Frankfurt am Main; New York 1992
Neubert Ehrhard: Erfahrene DDR-Wirklichkeit, in: Lexikon des DDR-Sozialismus, hrsg. von R.Eppelmann, G. Nooke, D. Willms, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 1997
Pollack, Detlef: Der Zusammenbruch der DDR als Verkettung getrennter
Handlungslinien, in: Weg in den Untergang - Der innere Zerfall der DDR, hrsg. von Jarausch Konrad H./Sabrow, Martin, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1999
Rode, Friedrich, A.: Der Weg zum neuen Konsumenten, Gabler-Verlag, Wiesbaden 1989 Rosenkranz, Doris/Schneider, Norbert, F.: Konsum. Soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, Leske und Budrich, Opladen 2000
Schneider, Gernot: Lebensstandard und Versorgungslage, in: Am Ende des realen
Sozialismus, hrsg. von Eberhard Kuhrt/Hannsjörg F. Buck, Gunter Holzweißig, Bd, 2, Leske und Budrich, Opladen 1996
Schneider, Norbert F.: Konsum und Gesellschaft, in: Konsum. Soziologische,
ökonomische und psychologische Perspektiven, hrsg. von Rosenkranz, D./Schneider, N.F., Leske und Budrich, Opladen 2000
Sontheimer, Kurt/ Bleek, Wilhelm: Die DDR. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, 2. Auflage, Hoffmann und Campe, Hamburg 1972
Steeger, Horst (Hrsg): Lexikon der Wirtschaft, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1980
Steiner, André: Zwischen Konsumversprechen und Niedergang, in: Weg in den
Untergang - Der innere Zerfall der DDR, hrsg. von Jarausch Konrad H./Sabrow, Martin, Göttingen 1999
Stihler, Ariane: Die Entstehung des modernen Konsums, in: Beiträge zur Verhaltensforschung, Heft 35, Duncker und Humblot, Berlin 1998
Veen, Hans-Joachim/Zelle, Carsten: Zusammenwachsen oder Auseinanderdriften? Eine empirische Analyse der Werthaltungen, der politischen Prioritäten und der nationalen Identifikationen der Ost- und Westdeutschen, in: Interne Studien, hrsg. von der KonradAdenauer-Stiftung, 2. Auflage, 1994
Voigt, Dieter/Meck Sabine: Leistungsprinzip und Gesellschaftssystem, in: Die Gesellschaft der DDR, hrsg. von Dieter Voigt, Schriftenreihe der Gesellschaft für Deutschlandforschung, Duncker und Humblot, Berlin 1984
Westle Bettina: Kollektive Identität im vereinten Deutschland. Nation und Demokratie in der Wahrnehmung der Deutschen, Leske und Budrich, Opladen 1999
Wettig, Gerhard: Niedergang, Krise und Zusammenbruch der DDR. Ursachen und
Vorgänge, in: : Am Ende des realen Sozialismus, hrsg. von Eberhard Kuhrt/Hannsjörg F. Buck, Gunter Holzweißig, Bd. 1, Leske und Budrich, Opladen 1996
Wolle, Stefan: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971 - 1989, 1. Auflage, Christoph Links Verlag, Berlin 1998
[...]
1 Vgl. Rosenkranz, D./Schneider, N.F.: Konsum. Soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, Opladen 2000 , S.7
2 Vgl. Brockhaus, Bd. 12, 19. Auflage, Mannheim 1990, S. 299
3 Vgl. Gablers Wirtschaftslexikon, 15. Aufl., Wiesbaden 2000, S. 1796
4 vgl. Lexikon der Wirtschaft. Volkswirtschaftsplanung, hrsg. von Horst Steeger, Berlin 1980
5 Vgl. Jäckel, Michael/ Kochbau Christoph: Notwendigkeit und Luxus, Ein Beitrag zur Geschichte des Konsums, in: Konsum. Soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, hrsg. von Rosenkranz/Schneider, Opladen 2000, S. 75
6 Vgl. Brockhaus, S. 299
7 So in seinem Vorwort zu A. Stihler: Die Entstehung des modernen Konsums, in: Beiträge zur Verhaltensforschung, Heft 35, Berlin 1998, S. 5f.
8 Vgl. Müller, Hans-Peter, De gustibus non est disputandum? Bemerkungen zur
Diskussion um Geschmack, Distinktion und Lebensstil, in: Eisendle/ Miklautz (Hrsg.), Produktkulturen, Campus-Verlag, 1992, S. 123
9 Vgl Stihler, A.: Die Entstehung des modernen Konsums, in: Beiträge zur Verhaltensforschung, Heft 35, Duncker und Humblot, Berlin 1998, S 13 und Schneider N. F.: Konsum und Gesellschaft, in: Rosenkranz/Schneider, Lehrtexte Soziologie S. 10
10 Vgl Stihler, Ariane, a.a.O., S. 23
11 Vgl ebd., S. 180
12 Vgl. ebd., S. 184
13 Vgl. ebd., S. 187
14 Vgl. Schneider N. F.: a.a.O, S. 14
15 Vgl. Stihler, A.: a.a.O., S. 194
16 Vgl. Gablers Wirtschaftslexikon, S. 2491
17 Vgl. Eisendle, Reinhard/ Miklautz, Elfie (Hrsg.), Produktkulturen, Campus-Verlag, 1992, S. 13
18 Vgl. Ebd. S. 15
19 Vgl. Ebd. S. 15
20 Vgl. Schneider, N. F.: a.a.O, S. 12
21 Vgl Stihler, A.: Die Entstehung des modernen Konsums, S. 92
22 Vgl. Eisendle, R., Miklautz, E.: Produktkulturen, S. 17
23 vgl. Faulenbach, Bernd: Alltag in der Diktatur, Vortrag vor der Enquetekommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“, in: Alltagsleben in der DDR und in den neuen Ländern, hrsg. vom Deutschen Bundestag, Band V, Frankfurt am main/Baden-Baden 1999, S. 16
24 vgl. Neubert Ehrhard: Erfahrene DDR-Wirklichkeit, in: Lexikon des DDR- Sozialismus, hrsg. von R.Eppelmann, G. Nooke, D. Willms, Paderborn 1997, S. 42
25 vgl. May, Herrmann: Wirtschaftbürger-Taschenbuch, 3. Auflage, 1997, S. 373f
26 vgl. Fritze Lothar: Innenansicht eines Ruins, in Akademiebeiträge zur politischen Bildung, München 1993, S. 38
27 vgl. Boyer, Christoph/Skyba, Peter: a.a.O., S 538
28 vgl. Kaminsky, Annette: a.a.O., S. 48
29 vgl. Kaminsky, Annette: a.a.O., S.159 und Schneider, G.: Lebensstandard und Versorgungslage, in: Am Ende des realen Sozialismus, hrsg. von Eberhard Kuhrt/Hannsjörg F. Buck, Gunter Holzweißig, Opladen 1996, S. 111ff.
30 Maser, Peter: Erscheinungsformen des Mangels, Vortrag vor der Enquetekommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“, in: Alltagsleben in der DDR und in den neuen Ländern, hrsg.vom Deutschen Bundestag, 1999, Band V, S. 22
31 vgl. Kaminsky, Annette: a.a.O., S. 96
32 Haug, W. F.: Kritik der Warenästhetik, Hamburg 1972, S. 138
33 vgl. auch Kaminsky, Annette: a.a.O., S. 121
34 vgl. Kaminsky, Annette: a.a.O., S. 99 und S. 135
35 vgl. Rode, Friedrich, A.: Der Weg zum neuen Konsumenten, Wiesbaden, 1989, S. 42
36 vgl. Kaschuba, Wolfgang/Merkel, Ina/Scholze-Irrlitz, Leonore/Scholze, Thomas: Forschungsbericht Freizeitverhalten in der DDR, in Materialien der Enquetekommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“, in: Alltagsleben in der DDR und in den neuen Ländern, hrsg. vom Deutschen Bundestag, 1999, Band V, S. 708
37 Westle Bettina: Kollektive Identität im vereinten Deutschland. Nation und Demokratie in der Wahrnehmung der Deutschen, Opladen 1999, S 265
38 vgl. Boyer, Christoph/Skyba, Peter: a.a.O., S. 538
39 Boyer, Christoph/Skyba, Peter: a.a.O., S. 589
40 vgl. Kaschuba, Wolfgang/Merkel, Ina/Scholze-Irrlitz, Leonore/Scholze, Thomas: a.a.O., S. 658
41 vgl. Kaminsky, Annette: a.a.O.: S. 149
42 Conley, Patrick: Das Kaninchen und die Schlange. Der Blick auf „den Westen“ im DDR-Feature, in: Deutschland-Archiv, 6/2001, S. 998
43 vgl. Kaminsky, Annette: a.a.O., S. 129 und auch Wolle, Stefan: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989, Berlin, 1998, S. 83
44 vgl. Schneider, Gernot: a.a.O., S. 115.
45 vgl. Neubert Ehrhard: a.a.O, S. 46
46 so Manfred Kanther im Vorwort zu: Am Ende des realen Sozialismus, hrsg. von Eberhard Kuhrt/Hannsjörg F. Buck, Gunter Holzweißig, Bd. 1, Opladen 1996, S. 6
47 vgl. Lindenberger, Thomas: a.a.O, S. 22
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Dieser Text behandelt die Bedeutung des Konsums für den Zusammenbruch der DDR. Er untersucht Konsum als kulturellen und treibenden Faktor für die geschichtlichen Abläufe, die zur politischen Wende in der DDR führten.
Welche Begriffe werden in diesem Text definiert?
Der Text definiert die Begriffe Konsum, Konsumgesellschaft, Produkt und Produktkultur, jeweils im Kontext der DDR und im Vergleich zur westlichen Sichtweise.
Welche Thesen werden im Text aufgestellt?
Der Text behandelt zwei Hauptthesen: Erstens, dass die DDR ein "Konsum-Gefrierschrank" war, der Entwicklungen verpasste. Zweitens, dass Konsum ein Destabilisierungsfaktor war, der das Vertrauen in das System untergrub.
Welche Phasen der Konsumentwicklung werden in der DDR betrachtet?
Der Text unterteilt die Konsumentwicklung in der DDR in drei Phasen: die Nachkriegszeit mit Not und Mangel (1945-58), die Modernisierungswelle und Versorgungskrisen in den 1960er Jahren, und die Stagnation in den 1970er und 1980er Jahren.
Wie wird die "entwickelte sozialistische Persönlichkeit" im Zusammenhang mit Konsum diskutiert?
Der Text beschreibt, wie die DDR versuchte, durch Erziehung eine "entwickelte sozialistische Persönlichkeit" zu formen, die sich von bürgerlichen Konsumgewohnheiten abgrenzen sollte. Dies scheiterte jedoch, da die Bevölkerung weiterhin einen Vergleich zum Westen zog.
Welche Rolle spielte das Westfernsehen?
Das Westfernsehen spielte eine wichtige Rolle, da es der Bevölkerung Einblicke in eine andere Welt und andere Konsumgewohnheiten ermöglichte und somit die Propaganda des Staates untergrub.
Wie wird die Konsumentensouveränität in der DDR betrachtet?
Der Text argumentiert, dass die Konsumentensouveränität in der DDR eingeschränkt war und die Bevölkerung als Konsumenten nicht gefragt wurde, was zur Unzufriedenheit und letztendlich zur Entfremdung vom System führte.
Was sind die Haupteinsichten der Arbeit?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass der Bereich des privaten Konsums eine entscheidende Rolle bei der mentalen Vorbereitung der Bürger auf die politische Wende spielte und die breiteste zivile Bewegung in der DDR darstellte.
Welche Autoren und Werke werden im Text zitiert oder erwähnt?
Der Text zitiert und erwähnt unter anderem Werke von Brockhaus, Gabler, Fritz Wolfgang Haug, Annette Kaminsky, Thorstein Veblen, Georg Simmel, John Kenneth Galbraith, Mary Douglas, Reinhard Eisendle, Elfie Miklautz und Friedrich A. Rode.
Wie wird die "Ostmentalität" im Zusammenhang mit Konsum betrachtet?
Die "Ostmentalität" wird als systembedingte Konsumkonditionierung dargestellt, die auf die Sozialisation in der Mangelgesellschaft zurückzuführen ist. Es wird aber argumentiert, dass sich Ost- und Westdeutsche im Konsumverhalten immer mehr annähern.
- Quote paper
- Constance Kugge-Hartung (Author), 2001, Der Beitrag der Konsumenten zum Zusammenbruch der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106195