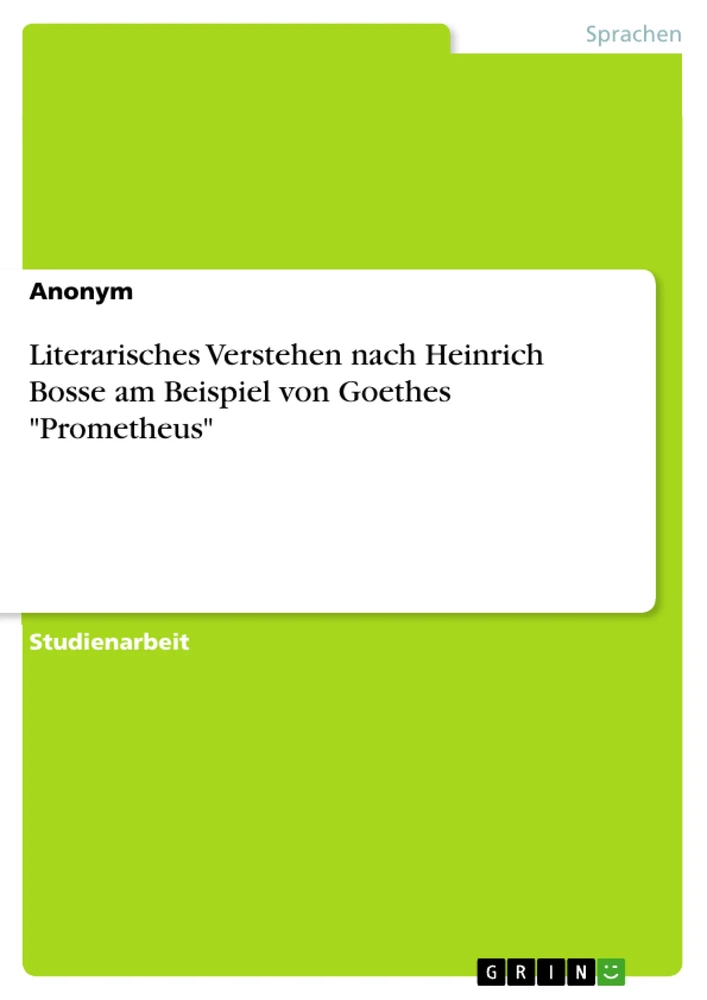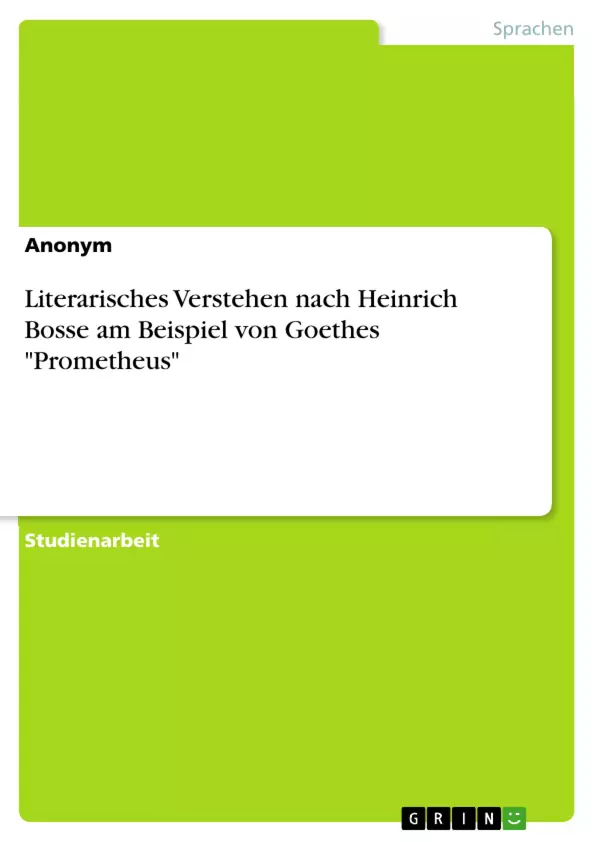Handlungen in Texten sind motiviert. Sie bedingen einander und ziehen nachvollziehbare Folgen nach sich. "Der schlechtgefesselte Prometheus" des Andre Gide stellt einen Ausbruchsversuch aus dieser Konvention dar. Ein Verstehen des Textes wird durch die Unmotiviertheit der Handlungen schier unmöglich. Wie aber kann ein Verstehen eines Textes, der nicht durch unmotivierte Handlungen bestimmt ist, vonstattengehen? Oder besser: Welche ist die Konvention, die Grundlage, der
sich Andre Gide offensichtlich zu entziehen versucht? Wie also kann ein literarisches Verstehen geschehen? Gibt es eine Konvention des solchen und falls ja, welche Schritte beinhaltet diese? Diese Fragen, die eine Beschäftigung mit Gides Text unwillkürlich aufwirft, möchte die vorliegende Arbeit beantworten. Dafür zieht sie Heinrich Bosses Ausführungen zum Thema heran und vollzieht diese an Goethes Gedicht "Prometheus" nach.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Der Begriff „literarisches Verstehen“ nach Heinrich Bosse
- Die Wissenschaftlichkeit des Begriffes
- Eine Schrittfolge des Verstehens nach Heinrich Bosse
- Vorbemerkung
- Die Sprechsituation
- Das Paraphrasieren als Sprechhandlung
- Die Kontexterweiterung und kulturelle Rahmensetzung
- Die Themenfindung
- Das Aufstellen von Sinnhypothesen
- Die Bekräftigung der Hypothesen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Goethes Gedicht „Prometheus“ im Kontext von Heinrich Bosses Konzept des „literarischen Verstehens“. Ziel ist es, Bosses Schrittfolge des Verstehens nachzuvollziehen und anhand des Gedichtes zu demonstrieren, wie ein literarisches Verstehen im praktischen Sinne stattfinden kann. Die Arbeit befasst sich dabei nicht primär mit einer kritischen Auseinandersetzung mit Bosses Ansatz, sondern verfolgt vielmehr das Ziel, diesen zu verstehen und nachzuvollziehen.
- Der Begriff „literarisches Verstehen“ nach Heinrich Bosse
- Die Wissenschaftlichkeit des „literarischen Verstehens“
- Die Schrittfolge des Verstehens nach Heinrich Bosse
- Die Anwendung der Schrittfolge auf Goethes „Prometheus“
- Bedeutung von Kontext und Mythologeme für das Verstehen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „literarisches Verstehen“ ein und stellt Bosses Ansatz sowie die Relevanz des Themas für die Literaturwissenschaft vor. Sie erläutert die Motivation der Arbeit und skizziert die Vorgehensweise. Der Hauptteil beginnt mit einer Definition des „literarischen Verstehens“ nach Heinrich Bosse und diskutiert die Frage nach der Wissenschaftlichkeit des Begriffes. Anschließend wird Bosses Schrittfolge des Verstehens detailliert dargestellt. Abschließend wird die Anwendung der Schrittfolge auf Goethes „Prometheus“ erörtert.
Schlüsselwörter
Literarisches Verstehen, Heinrich Bosse, Goethe, Prometheus, Mythologeme, Sprechhandlung, Kontexterweiterung, Themenfindung, Sinnhypothesen, Textwelt, Textoberfläche, Pragmatik, Wissenschaftlichkeit, Hermeneutik, Dekonstruktion.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Heinrich Bosse unter "literarischem Verstehen"?
Bosse definiert es als einen methodischen Prozess, der über Sprechsituation, Paraphrasieren und Kontexterweiterung zur Themenfindung und Sinnhypothese führt.
Wie wird Bosses Methode auf Goethes "Prometheus" angewendet?
Die Arbeit vollzieht die Schrittfolge nach, indem sie die Sprechsituation des lyrischen Ichs analysiert und Sinnhypothesen auf Basis der Mythologie aufstellt.
Warum ist das Paraphrasieren ein wichtiger Schritt beim Verstehen?
Es dient als Sprechhandlung, um den Inhalt des Textes in eigenen Worten zu erfassen und so die Grundlage für eine tiefere Interpretation zu schaffen.
Welche Rolle spielt die Kontexterweiterung?
Sie setzt den Text in einen kulturellen Rahmen (z.B. antike Mythologeme), um Bedeutungen zu erschließen, die über die reine Textoberfläche hinausgehen.
Was kritisiert Andre Gide an literarischen Konventionen?
Gide versucht in "Der schlechtgefesselte Prometheus", durch unmotivierte Handlungen die Konventionen des klassischen literarischen Verstehens zu durchbrechen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Literarisches Verstehen nach Heinrich Bosse am Beispiel von Goethes "Prometheus", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1064395