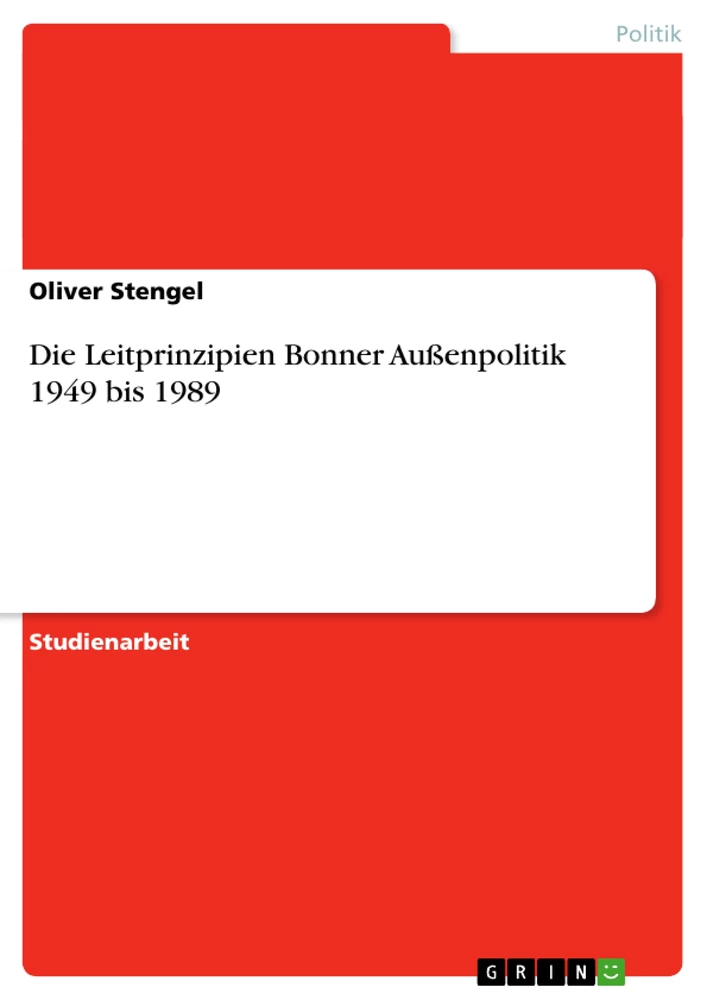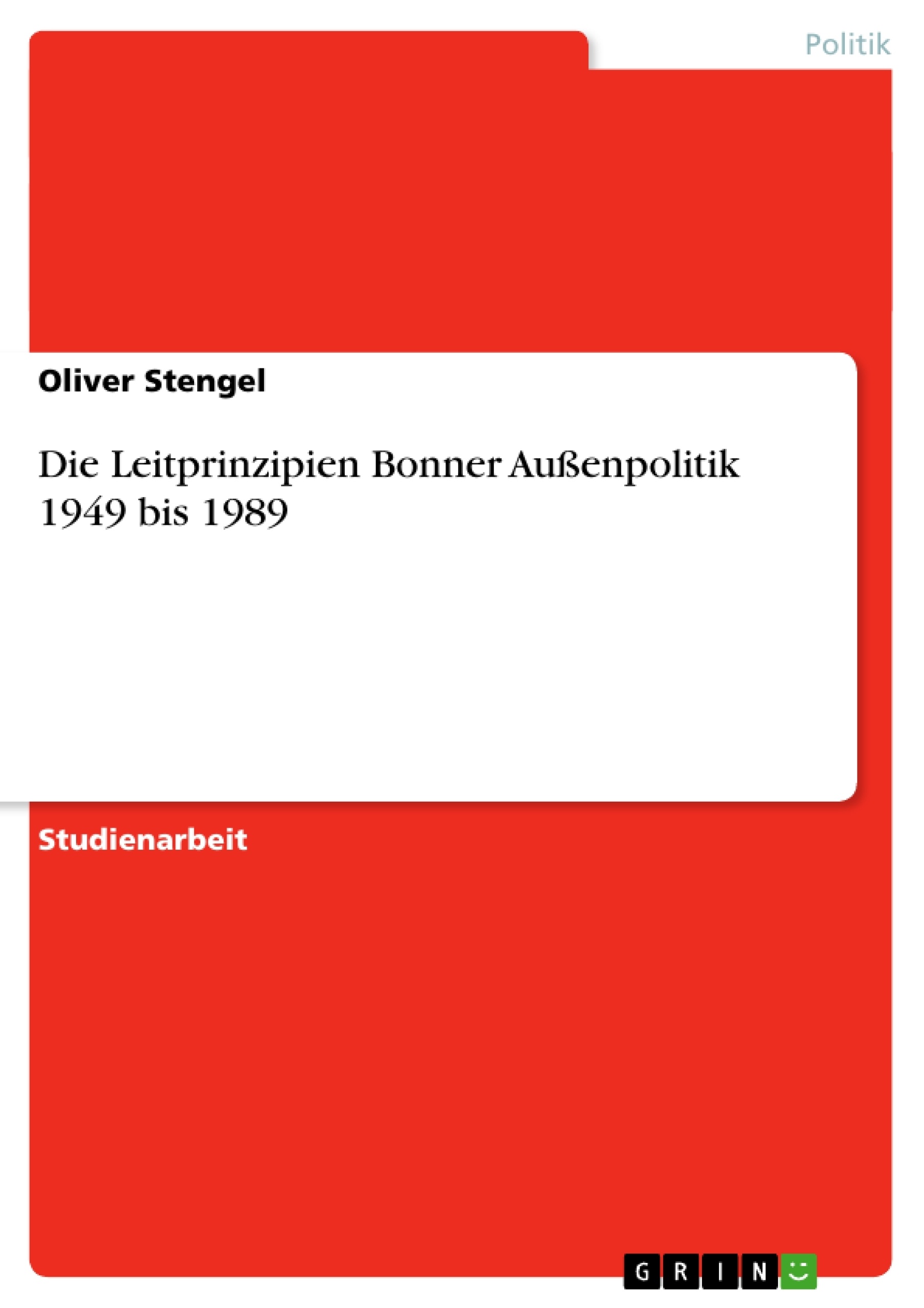Inhalt
1. Einleitung
2. Konzeption der Westpolitik
2.1 »Westintegration«
2.1.1 »Westintegration« aufgrund alliierter Vorgaben
2.1.2 »Westintegration« aufgrund Adenauers Anti-Kommunismus
2.1.3 »Westintegration« aufgrund der Abendland-Vorstellung
3. Konzeptionen der Ostund Deutschlandpolitik
3.1 »Magnettheorie« und die »Politik der Stärke«
3.2 Die »Politik der Bewegung« als »Zangen-Politik«
3.3 Die »Neue Ostpolitik« als Politik der Bewegung
Adenauer: Konfrontation nach Osten
3.4 Operative Kontinuität aber deklaratorischer Wandel
4. Bonner Außenpolitik als »großer Kompromiss«
5. Konzeptionen der Weltpolitik
5.1 »Germanozentrische Außenpolitik«
5.2 Übernahme internationaler Verantwortung
6. Die BRD – Handelsstaat oder Zivilmacht?
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Waldemar Besson war einer der ersten, welcher die Außenpolitik der BRD über einen längeren Zeitraum (bis 1970) analysierte. Er tat dies unter der Fragestellung, wie das anfängliche Provisorium Westdeutschland »in zwanzig Jahren ein Staat unter Staaten«1 werden und damit den Wandel von einem »Objekt« zu einem »Subjekt« der internationalen Politik vollziehen konnte. Weitere Studien folgten im Laufe der Jahre und Jahrzehnte: Paul Noack etwa untersuchte die Außenpolitik der BRD (bis 1980) primär im Hinblick
»auf die technologischen und waffentechnischen Entwicklungen«2 von denen sie beeinflusst wurde. Frank Pfetsch zeigte, wie die BRD (bis 1990) ihre nationalen Interessen gegenüber oder gemeinsam mit anderen Staaten durchzusetzen vermochte.3 Helga Haftendorns (aktuelle) Analyse der deutschen Außenpolitik erstreckt sich bis 2000. Sie vollzog nach, wie die BRD durch eine »Strategie der Selbstbeschränkung« (d.h. die freiwillige Hinnahme von Souveränitätsverzichten) zu einem handlungsfähigen, gleichberechtigten, geachteten und schließlich geeinten Mitglied der Völkergemeinschaft werden konnte: Indem sie ihren Grad an Autonomie durch Multilateralismus und der damit verbundenen Möglichkeit zur Mitsprache vergrößern konnte.4 Dabei konzentriert sich Haftendorn »auf die Wechselwirkungen zwischen den Impulsen, die vom internationalen System ausgingen, und den Reaktionen der handelnden Politiker in Deutschland.«5
Sie folgte damit einem Challange-and-Response-Analyseansatz, dem schon Wolfram Hanrieder nachgegangen war. Für die Zeit bis 1969 vertrat er die These, »dass Ziele und Mittel der westdeutschen Außenpolitik durch die internationalen Bedingungen festgelegt wurden, über die die Bonner Republik keine Kontrolle hatte.«6 Auch ich vertrete in dieser Arbeit den Standpunkt, dass man die verschiedenen außenpolitischen Konzeptionen und ihren Wandel mit den Begriffenchallangeundresponseam besten erklären kann. Die These soll demnach sein, dass die in der Folge untersuchten außenpolitischen Konzeptionen der BRD bis 1989 Reaktionen bzw. Antworten auf die Impulse bzw. Herausforderungen der (sich wandelnden) Konstellationen in den internationalen Beziehungen waren.7 Obzwar die Konzeptionen westdeutscher Außenpolitik reaktiv waren, konnten von ihnen auch Impulse ausgehen, welche (wie etwa im Fall der »Neuen Ostpolitik«) Einfluss auf die internationalen Beziehungen hatten.
Konzeptionen sind die Mittel eines Staates, um Ziele realisieren zu können. Die wichtigsten Ziele der BRD sind nun in der Zeit von 1949–1989 konstant geblieben.8 Dies waren: Sicherheit, Wohlfahrt, Wiedervereinigung, und bis 1955 war der BRD auch die Wiedererlangung der Souveränität ein grundlegendes Ziel. Blieben die Ziele konstant, veränderten sich die Konzeptionen – und zwar, so die These, – aufgrund neuer Herausforderungen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Konzeptionen der Bonner Außenpolitik, deren Wandel und ihre Folgen zu untersuchen. Dabei werden auch die o.a. Fragestellungen Berücksichtigung finden. Fernerhin werden, wo es heftige Kontroversen über bestimmte Konzeptionen gab, die Positionen der Befürworter und der Gegner dargestellt. Es versteht sich dabei von selbst, dass die immense Komplexität der Geschehnisse und Standpunkte im Rahmen einer knapp 20-seitigen Hausarbeit erheblich reduziert werden muss.9
Die verschiedenen Richtlinien Bonner Außenpolitik bis 1989 sind im weiteren Verlauf in die drei Felder Westpolitik, Ostund Deutschlandpolitik sowie Weltpolitik eingeteilt und werden in je eigenen Kapiteln untersucht. Die Arbeit schließt mit einer Ausführung zu der Frage, ob die BRD bis 1989 dem Modell eines Handelsstaates oder eines Zivilstaates folgte.
2. Konzeption der Westpolitik
2.1 »Westintegration«
Die Westintegration, d.h. die Einbindung der BRD in interoder supranationale ökonomische, politische oder militärische Organisationen der Westmächte, war in den ersten Jahren die bestimmende außenpolitische Konzeption der BRD. Zugleich prägte sie – in der Gründerphase der BRD (bis 1955) –maßgeblich die westdeutsche Innenpolitik: Die politischen Institutionen sowie die wirtschaftlichen Strukturen wurden von dieser Konzeption abgeleitet und waren aufgrund dieser Bedeutung auch Ursache für die Spannungen zwischen Regierung und Opposition. Kurt Schumacher äußerte sich 1948 aus diesem Grund dahingehend, dass »die Auseinandersetzung über die Außenpolitik im Grunde die Auseinandersetzung über die Innenpolitik und über die sozialen der politischen Ordnung ist. [...] Die Außenpolitik bestimmt die Grenzen für die Möglichkeit unserer Wirtschaftsund Sozialpolitik.«10 Nach der Gründerphase aber, als die innenpolitische Ausrichtung der BRD festgelegt und unwiderrufbar war, verlor dieser Aspekt an Bedeutung.
2.1.1 »Westintegration« aufgrund alliierter Vorgaben
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Deutschland ein besetztes, in fünf Gebietskörperschaften aufgeteiltes und international geächtetes Land. Die Deutschen wurden von den Besatzungsmächten regiert und hatten selbst keine Entscheidungsbefugnisse. Auf der politischen Agenda der Alliierten im Osten und im Westen stand zunächst nur die Sicherheit vor Deutschland. Nach zwei Weltkriegen war es das erklärte Ziel der Sieger, Deutschland weder militärisch noch wirtschaftlich stark werden zu lassen. Aus dieser Einstellung entstanden verschiedene Pläne der Alliierten, wie mit Deutschland zu verfahren sei. Der prominenteste war der Morgenthau-Plan, der vorsah, Deutschland zu einem Agrarland zu machen. Seitens der SU schlug Außenminister Molotow eine »völlige militärische und wirtschaftliche Abrüstung« Deutschlands vor.
Diese Pläne wurden jedoch nicht umgesetzt, denn die Einigkeit der Alliierten in Bezug auf Deutschland änderte sich schon bald. Grund hierfür war die Eskalation der gegensätzlichen Positionen zwischen USA und SU: In den USA setzte sich immer mehr die Erkenntnis durch, die SU strebe nach der Weltherrschaft. Dem wollte man kraftvoll entgegentreten, anstatt mit den Russen wie bisher großzügig zu verfahren. Der noch unentschlossenen Politik des Hinausschiebens (Postponement) und der Politik des Entgegenkommens (Appeasement) folgte jetzt eine konfrontative Politik der weltweiten »Eindämmung« (Containment) des kommunistischen Einflusses. 1947 verkündete Truman entsprechend der Empfehlungen George Kennans11 die Truman-Doktrin, die ein Wendepunkt in der amerikanischen Außenpolitik waren. Allen vom Kommunismus bedrohten Völkern würde amerikanische Unterstützung zugesichert. Jede Nation, so Truman, müsse in Zukunft zwischen westlicher Demokratie und Kommunismus wählen. Damit hatte der US- Präsident zum ersten Mal von einer Zweiteilung der Welt gesprochen.
Drei Monate später erließ der neu berufene US-Außenminister Marshall denMarshallplan, ein amerikanisches Hilfsprogramm zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage in Europa. Dieses war infolge der Kriegsschäden so desolat, dass, wenn sich seine Lage nicht besserte, ein Staat nach dem anderen aus innerer Schwäche dem SU-Machtbereich zuzufallen drohte. Der Plan ging in seinem Kern davon aus, dass ein Wiederaufbau Europas nur gelingen könne, wenn auch die deutsche Wirtschaft wieder genas und ihr Potential in einem sich abzeichnenden Westblock eingebracht wurde. Laut Plan sollten auch die osteuropäischen Länder die Möglichkeit haben, Wiederaufbauhilfen zu erhalten. Die Annahme der Gelder aus dem US-Hilfsprogramm war jedoch von den USA an die Verpflichtung gekoppelt, einer gemeinsam geschaffenen Organisation zur wirtschaftlichen Kooperation – der OEEC – beizutreten. Diese hatte die Aufgabe, ein europäisches Wirtschaftsprogramm zu erstellen und umzusetzen, ein liberales Handelssystem durch die Abschaffung der Handelschranken und die Herabsetzung der Zölle zu errichten, und drittens die europäischen Währungen zu stabilisieren. Da die Konzeptionen der OEEC dem US-Ziel, ein liberales Weltwirtschaftsystem zu gründen, folgten, verbot die SU den osteuropäischen Staaten ihre Beteiligung, denn die SU strebte ihrerseits danach, die Expansion des »Dollarimperialismus« einzudämmen.
Zur erfolgreichen Umsetzung des Marshallplans bedurfte es einer Normalisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse, weshalb im Juni 1948 eine Währungsreform in Westdeutschland erfolgte. Die Sowjets zogen nur wenige Tage später mit einer Währungsreform für die SBZ nach. Es folgte ein Streit darüber, welche der beiden Währungen in Berlin eingeführt werden sollte. Die SU beharrte auf der Ost-Mark und blokkierte noch im Juni alle Zufahrtswege nach Berlin, um ihre Forderung durchzusetzen und die westlichen Besatzungsmächte zum Abzug zu bewegen. Die Berlin-Blockade hielt von Juni 1948 bis Mai 1949 an und schlug fehl aufgrund der Luftbrücke und der Wirkung einer Gegenblockade, mit der die Westmächte die SBZ von Kohleund Stahllieferungen abschnitten. Blockade und Gegenblockade wurden im Mai 1949 aufgehoben. Mit der Blockade erreichte die SU das Gegenteil dessen, was sie angestrebt hatte: Tatsächlich wollte Moskau eine westdeutsche Staatsgründung verhindern, um die deutsche Frage offenzuhalten und vielleicht doch noch Einfluss auf ganz Deutschland nehmen zu können. Die Weststaatengründung wurde aber mit der Blockade nicht verhindert, sondern beschleunigt. Im Mai 1949 wurde die BRD gegründet, die Gründung der DDR folgte nur wenige Monate später.
Mit ihrer Teilnahme am Marshallplan und ihrer Aufnahme in die OEEC war die deutsche Westzone mit einem ersten Schritt in den Westen integriert. Ein zweiter und dritter Schritt folgten 1949 mit dem Beitritt der BRD zum Europarat und auf Geheiß der Westmächte zur Internationalen Ruhrbehörde. Der Ruhrbehörde oblagen Entscheidungen über die Produktionshöhe und Verwendung von Erzeugnissen der Kohle-, Eisenund Stahlindustrie.
Zwar wurden der BRD im gleichen Jahr die Lockerung der wirtschaftlichen Beschränkungen im Petersberger Abkommen eingeräumt und ihr die Aufnahme außenpolitischer Beziehungen sowie das Recht völkerrechtliche Verträge abschließen zu können zugesprochen. Doch hatten die USA den außenpolitischen Kurs der BRD zu diesem Zeitpunkt bereits festgelegt:
»Eine echte politische Alternative zur Westintegration gab es nicht; jedenfalls keine, die mit der erforderlichen Zustimmung der Siegermächte in London, Paris und Washington hätte verwirklicht werden können. Für die US-Administration der Nachkriegszeit stellte die Förderung der westeuropäischen Integration das wichtigste Instrument dar, um Westdeutschlands ökonomisches und politisches Potential dauerhaft kontrollieren zu können.«12 Neben der Möglichkeit, Westdeutschland durch Einbindung kontrollieren zu können, gab es ein zweites Argument, das aus Sicht der USA für dessen Westintegration sprach: Ein gesundes Westdeutschland lief nicht Gefahr den Sowjets in die Hände zu fallen, im Gegenteil: Es konnte wiedererstarkt auch ein effektiver Schutzwall gegen den SU-Expansionsdrang bzw. ein »Vorposten der Freiheit«13 für die USA sein.
Damit verfolgten die USA eine Doppeleindämmungspolitik:14 Erstens Eindämmung der SU durch ein starkes und einiges Westeuropa und zweitens Eindämmung der BRD durch ihre Integration in die OEEC und Internationale Ruhrbehörde. Die Maßnahmen, welche die BRD eindämmen sollten, sollten dabei zugleich Westeuropa stärken und einen und die SU-Expansion stoppen.
2.1.2 »Westintegration« aufgrund Adenauers Anti-Kommunismus
Adenauer hätte sich aber dennoch für den Westkurs entschieden, hätte es die US-Vorgaben nicht gegeben. Denn mit den westlichen Nachbarn und insbesondere den USA teilte er eine in dieser Zeit weit verbreitete SU- bzw. Kommunismus-Furcht. In der SU sah der Bundeskanzler die Inkarnation des Bösen, was übertrieben anmutet, aber durchaus der Gefühlslage dieser Zeit entsprach. Beleg war ihm die Reparationsoder besser: Ausplünderungspolitik, welche die SU in der SBZ zum eigenen Wiederaufbau betrieb. Ad enauer war zudem der festen Überzeugung, die SU sei nur darauf aus, Europa in Unruhe zu versetzen »in der Hoffnung, dadurch seinen Machtbereich über Deutschland, Frankreich und die kleinen Länder bis an das Meer und dann auf England ausdehnen zu können«,15 so Adenauer über die SU. »Ihr Ziel ist die Beherrschung der Welt durch den Kommunismus.«16 Das Vorgehen der SU in China, Korea, Osteuropa und die Berlin-Blockade bestätigten ihm nur seine Überzeugungen und machten ihn endgültig zum Anti- Kommunisten. Da sich ein zerstörtes Land wie die Bundesrepublik Deutschland aber nicht gegen die Expansionsmacht SU hätte wehren können, kam die Neutralität Deutschlands für Adenauer nicht in Frage. Neutralisierung hieß für ihn Sowjetisierung.17 Um sich schützen und die Freiheit wahren zu können, konnte es in der Sichtweise Adenauers also nur eine Integration nach Westen geben. Die Westbindung war für ihn eine Antwort auf die Herausforderung SU – »eine Politik des reinen Selbsterhaltungstriebes«.18 Seine strikte Zuwendung nach Westen war zugleich seine Ostpolitik: »Aufs ganze gesehen dürfte Adenauers Antikommunismus und SU-Furcht die zentralen Triebkräfte seiner Außenund Europapolitik gewesen sein.«19
Adenauer verfolgte also aus tiefer Überzeugung heraus die Politik der Westbindung und eine diplomatisch-konfrontative Ostpolitik. Dadurch wurde er für die Westalliierten zu einem geachteten und berechenbaren Partner. Er war kein »Kanzler der Alliierten«, wie ihm Schumacher 1949 vorgeworfen hatte, denn »die Westintegration der Bundesrepublik entsprang [...] nicht einem primitiven Diktat, das man einer widerstrebenden deutschen Regierung hätte auferlegen müssen, sondern reflektierte eine fundamentale Übereinstimmung zwischen Bonn und den Westmächten über den zukünftigen Weg der jungen Republik.«20 Nach Maull befand sich die Bundesregierung in der »paradoxen Situation der freiwilligen Entscheidung ohne Alternative«.21 Obendrein versprach der Westkurs wirtschaftliche Vorteile.
2.1.3 »Westintegration« aufgrund der Abendland-Vorstellung
Neben diesem sicherheitspolitischen und ökonomischen Argument berief sich Adenauer immer wieder auf »unsere in vielen Jahrhunderten entwickelte Lebensform, die die christlich humanistische Weltanschauung zur Grundlage hat«22 – also zusätzlich auf ein kulturelles Argument. Daher kam für ihn nur der Anschluss an jene in Frage, die »in ihrem Wesen die gleichen Ansichten über Staat, Person, Freiheit und Eigentum hatten wie wir«.23
Damit gab es also vier Faktoren, welche den Kurs gen Westen vorgaben: Zum einen musste sich Bonn aufgrund der alliierten Vorgaben dem Westen anschließen, zum anderen entsprach dieser Kurs den Interessen Adenauers (und der seines Kabinetts). Er hatte hierfür ein sicherheitspolitisches (SU-Bedrohung), ein ökonomisches (erweiterte Absatzmärkte) und ein kulturelles (christlich-humanistisches Weltbild) Argument parat. Kein Kanzler nach Adenauer sollte sich je ernsthaft gegen eines dieser Argumente wenden.
2.2 Die Konzeption des Verzichts
Adenauers Ziel war es, die BRD von einem »Objekt«, über das die Westmächte verfügen konnten und der BRD eine eigenständige Außenpolitik unmöglich machten, zu einem gleichberechtigten handlungsfähigen
»Subjekt« zu machen, das über sein Entwicklung selbst bestimmen konnte. Die Grundidee aus deutscher Sicht war dabei stets dieselbe: Souveränität durch Integration in ökonomische und militärische Organisationen, die für die BRD beide supranational waren. Mit dieser Strategie des Gebens und Nehmens integrierte Adenauer die Bundesrepublik immer tiefer in Europa und erreichte gleichzeitig immer mehr Souveränität. Es scheint paradox: Der Verzicht auf militärische und wirtschaftliche Souveränitätsrechte brachte der BRD Souveränität über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten. Tatsächlich konnte die BRD aber nur souverän werden, weil ihre Politik durch die Abgabe entscheidender Rechte für ihre Partner im Westen berechenbar wurde und sie obendrein ihren Interessen entsprach. Dieser Umstand spielte auch bei der Vereinigung Deutschlands die entscheidende Rolle.
1950 warb der französische Außenminister Schuman für seinen als sensationell empfundenenSchumanplan, demzufolge eine Montanunion mit supranationaler Lenkungsbehörde gegründet werden sollte. Wer nicht mehr frei über Energie und Stahl verfüge, so die Logik, könne keinen Krieg mehr führen.24 Mit dieser Argumentation brachte Schuman ehemalige Kriegsgegner zusammen. Adenauer unterstützte den Plan, ebenso wie die Beneluxländer, Italien und Frankreich. Die SPD opponierte, da die EGKS nicht nach sozialistischen, sondern marktwirtschaftlichen Prinzipien funktionieren sollte.
Es war offensichtlich, dass sich hinter dem französischen Plan auch die Absicht verbarg, die wieder aufstrebende westdeutsche Wirtschaft in ein Kontrollsystem einzufügen, in dem Frankreich eine Überwachungsfunktion wahrnehmen konnte und das die Deutschen in ihren Möglichkeiten eindämmen sollte. Doch überwogen für ihn die positiven Aspekte: Mit dem Plan wurde das Ruhrstatut hinfällig, wurde die BRD ein gleichberechtigtes Mitglied in einem europäischen Gremium, und verknüpften sich ihre Sicherheitsinteressen mit denen ihrer Partner. 1952 trat der Plan für die Dauer von fünfzig Jahren in Kraft (und er endet ohne Verlängerung 2002). Auch in der Frage der Wiederbewaffnung und des Deutschlandvertrages verfuhr Adenauer nach der Junktim-Politik, welche verschiedene politische Probleme verknüpft und auf einer höheren Ebene auflöst. Auch sicherheitspolitisch wiederholte sich dieses Schema:
Die von der SU ausgehende militärische Gefahr schien nach Meinung der USA und ihrer Verbündeten beständig größer zu werden (1950 wurde auch die SU eine Atommacht, zudem waren die konventionellen Streitkräfte Westeuropas denen Osteuropas unterlegen), weshalb die westliche Verteidigungsgemeinschaft gestärkt werden müsse. Die westlichen Alliierten waren aber nicht in der Lage ihren Beitrag erhöhen zu können, weshalb die BRD einen Anteil zur Verteidigung leisten sollte. Das Interesse der westlichen Nachbarn, vor allem aber der USA, hatte sich geändert: »Die Sorge, sich gegen die Deutschen schützen zu müssen, war der bangen Frage gewichen, wie man sich zusammen mit den Deutschen gegen die Sowjets schützen könne«.25
Für Adenauer bot sich in der Debatte um die westdeutsche Wiederbewaffnung die Möglichkeit, selbige an sein Ziel der gleichberechtigten Partnerschaft der BRD im westlichen Bündnis zu knüpfen. Je größer der westdeutsche Beitrag zum westlichen Bündnis war – so der Gedanke –, desto eher musste die BRD als vollwertiges Mitglied anerkannt werden, desto näher musste das Ende der Besatzungszeit zu kommen.
Zwar sorgte man sich auch in Bonn um die Sicherheit: Der Einmarsch nordkoreanischer Truppen in den Süden des Landes (1950) ließ Befürchtungen laut werden, selbiges könne sich auch in Deutschland wiederholen, wenn man dem nicht militärisch vorbeuge. Trotzdem war die Öffentlichkeit gegen eine Wiederbewaffnung, da die Schrecken des Zweiten Weltkrieges noch sehr gut in Erinnerung waren. Auch die SPD wandte sich gegen die Aufstellung einer bundesdeutschen Armee. Neben einem Atomkrieg auf deutschem Boden fürchtete sie, dass das Ziel der Wiedervereinigung in weite Ferne rücken könne, weil die SU die Wiederbewaffnung als Bedrohung interpretieren und die DDR zur eigenen Absicherung weiter an sich binden würde.26 Adenauer aber hielt an der Wiederbewaffnung fest. Er »hatte mehrere Ziele im Auge: Er wollte mit Hilfe der Wiederbewaffnung, erstens, die vollständige Souveränität erreichen; er wollte die Wiedervereinigung, zweitens, als gemeinsame Aufgabe der Westmächte und der Bundesrepublik verankern [vgl. »Politik der Stärke«]; und er wollte, drittens, die EVG als eine weitere europäische Klammer neben dem Schuman-Plan verstehen.«27 Dazu bot sich der BRD die Möglichkeit, an militärischen Entscheidungen mitwirken zu können.
Zunächst war eine gemeinsame Armee der EGKS-Staaten vorgesehen, die eng mit den USA und Kanada zusammenarbeiten sollte, dies war der EVG-Plan. Der vom französischen Premierminister Pleven angeregte EVG-Plan scheiterte jedoch 1954 an der Befürchtung der französischen Nationalversammlung vor einem nicht nur wirtschaftlich, sondern auch noch militärisch wiedererstarkten, wenngleich integrierten, Westdeutschland. Außerdem glaubte man auf französischer Seite, dass sich die Beziehungen zwischen Ost und West mit dem Tod Stalins (1953) verbessern und der Kalte Krieg zu Ende gehen könnte. Ein deutscher Verteidigungsbeitrag schien daher nicht mehr zwingend zu sein. Da die EVG mit der EGKS in eine politische europäische Union münden sollte, wurde diese Idee mit dem Ende der EVG ebenfalls obsolet. Nur eine EWG kam 1957 mit den Römischen Verträgen zustande. Mit ihnen erfuhr der europäische Integrationsprozess einen Wandel: Stand er bis dahin unter primär sicherheitspolitischen Zielsetzungen, rückte nun die Ökonomie in den Vordergrund.
Wenngleich die EVG scheiterte, hatte es Adenauer doch geschafft, das Thema deutsche Souveränität auf die Agenda zu setzen. Auch eine Lösung zum deutschen Militärbeitrag fand sich rasch: Mit dem Beitritt der BRD zur WEU28 (die BRD musste, um ihr beitreten zu können, Rüstungsbeschränkungen wie den Verzicht der Herstellung, des Erwerbs und des Besitzes von ABC-Waffen und einigen konventionellen Waffensystemen akzeptieren, ihre Größe auf maximal 500 000 Soldaten begrenzen und die Stationierung einer britischen »Rheinarmee« auf eigenem Territorium hinnehmen) und zur NATO29 (die Bundeswehr musste sich, um ihr beitreten zu können, dem NATO-Oberbefehl unterstellen) wurde das westdeutsche Militär quantitativ und qualitativ begrenzt bzw. eingedämmt und leistete die BRD ihren militärischen Beitrag für das westliche Bündnis ohne den Staaten des Westens eine Bedrohung zu sein. Als Gegenleistung wurde ihr die Souveränität zuerkannt, wenngleich nicht die volle.30
[...]
1 Besson, S. 10
2 Noack, S. 8
3 Pfetsch, S. 11
4 siehe Haftendorn, S. 13
5 Haftendorn, S. 14
6 Hanrieder (1970), S. 9
7 Die weiteren Ausführungen sind nicht subsumtionslogisch, da die These erst nach Sichtung der Daten (und nicht umgekehrt) aufgestellt wurde.
8 vgl. Haftendorn, S. 433; Hanrieder (1991), S. XIV; Pfetsch, S. 11 f,
9 Manches musste ich gar ausselektieren: Zwei Kapitel (Bilateralismus mit Frankreich und den USA, Kooperation mit der SU und den osteuropäischen Staaten) habe ich – um im vorgeschriebenen Rahmen zu bleiben – der Arbeit wieder entnommen; die Rolle der FDP ist von mir nur marginal berücksichtigt worden – eingedenk der Tatsache, dass dies in einer tiefergehenden Analyse unverzeihlich gewesen wäre (vgl. Hacke 1988, S. 5 f.).
10 Schumacher zit. in: Hanrieder (1991), S. XVI
11 Wegbereiter dieses Umschwungs war der US-Diplomat George F. Kennan in Moskau. Im Februar 1946 schrieb er in einem Telegramm an Truman, dass sich die SU nachdrücklich zu dem Glauben bekenne, mit den Amerikanern auf Dauer nicht mehr zusammenleben zu können und daher die Sicherheit und das internationale Ansehen der USA zu zerstören versucht sein wird. Auch auf das sowjetische Expansionsstreben wies er hin und riet, dass sich die USA dem Weltkommunismus – der sich »wie ein bösartiger Parasit [...] nur von krankem Gewebe ernährt« (Kennan zit. in: Pfetsch, S. 110) und so ausweiten kann – entgegen stellen müsse. Nur wenn die SU auf starken Widerstand stoße, werde sie sich zurüc kziehen.
12 Staack, S. 35
13 zit. in: Haftendorn, S. 434
14 siehe Hanrieder (1991), S. 7 ff.
15 zit. in: Besson, S. 60 f.
16 Presseund Informationsamt der Bundesregierung, S. 2
17 siehe Besson, S. 148 f.
18 Adenauer zit. in: Hendrichs. S. 292
19 Baumgart, S. 13
20 Hanrieder (1991), S. 8
21 Maull (1993), S. 935
22 zit. in: Pfetsch, S. 146
23 ibid.
24 Grund für diesen Plan war auch die Anerkennung der Tatsache, dass die durch den Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich und finanziell geschwächten Staaten Europas sich im Ost-West-Konflikt einzeln nicht hätten behaupten können (zumal auch Dekolonisierungsbestrebungen weitere Einflusseinbußen erahnen ließen). Zudem hatte man nach dem Ersten Weltkrieg die Erfahrung gemacht, dass ein repressiver Umgang mit einem besiegten Deutschland keineswegs Sicherheit, sondern Nationalismus bedeutet. Eine europäische Zusammenarbeit schien also unumgänglich zu sein.
25 Besson, S. 99
26 Zur Debatte um die westdeutsche Wiederbewaffnung siehe Grosser, S. 339 ff.
27 Noack, S. 36
28 Die 1954 gegründete WEU trat sicherheitspolitisch stets hinter die NATO zurück und bis in die 1980er Jahre war es ihr Hauptzweck, den bundesdeutschen Militärapparat zu kontrollieren.
29 Die NATO entstand am 4.4.1949 im Zuge des sich verschärfenden Ost-West-Konfliktes, nachdem dieser mit der Berlin-Blockade einen ersten Höhepunkt erreicht hatte. Der erste NATO-Generalsekretär Lord Ismay brachte die Gründung auf den Punkt: NATO was created to »keep the Soviets out, the Americans in, and the Germans down.« (Ismay zit. in: Maull, S. 93) Am 14.5.1955 bildeten die Ostblockstaaten mit dem Warschauer Pakt (WP) ein eigenes Militärbündnis. Die östlichen Unterzeichnerstaaten verstanden ihren Zusammenschluss dabei als Antwort auf den am 9.5.1955 erfolgten Beitritt der BRD zur NATO. Einen besonderen Stellenwert nahm die kollektive Verantwortung der WP-Staaten für die Bewährung des Sozialismus im territorialen Geltungsbereich des Vertrages ein. War in einem WP-Staat der Sozialismus bedroht, so waren die anderen Paktstaaten nicht nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet, den Sozialismus durch »brüderliche Hilfe« aufrechtzuerhalten (»Breschnew-Doktrin«). Die Hilfe schloss als äußerstes Mittel militärische Gewalt ein. So intervenierte die SU 1956 in Ungarn, 1968 mit Hilfe Polens, Bulgariens und der DDR in der CSSR. Erst 1989 wurde die Breschnew-Doktrin von Gorbatschow aufgehoben, was den Umsturz in Osteuropa wesentlich fördern sollte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Analyse der Bonner Außenpolitik?
Diese Analyse untersucht die verschiedenen außenpolitischen Konzeptionen der BRD bis 1989 und deren Wandel als Reaktionen auf die sich ändernden Konstellationen in den internationalen Beziehungen. Dabei werden die Konzeptionen in die Bereiche Westpolitik, Ostund Deutschlandpolitik sowie Weltpolitik unterteilt.
Welche Hauptziele verfolgte die BRD von 1949 bis 1989?
Die wichtigsten Ziele der BRD in diesem Zeitraum waren Sicherheit, Wohlfahrt, Wiedervereinigung und bis 1955 auch die Wiedererlangung der Souveränität. Obwohl die Ziele konstant blieben, veränderten sich die Konzeptionen zur Erreichung dieser Ziele aufgrund neuer Herausforderungen.
Was war die Konzeption der "Westintegration"?
Die Westintegration, die Einbindung der BRD in westliche Organisationen, war in den ersten Jahren die bestimmende außenpolitische Konzeption. Sie war bedingt durch alliierte Vorgaben, Adenauers Anti-Kommunismus und die Vorstellung eines gemeinsamen "Abendlandes".
Warum war die Westintegration für Adenauer so wichtig?
Adenauer sah in der Westintegration eine Möglichkeit, die BRD vor der Expansionsmacht SU zu schützen und die Freiheit zu wahren. Sie war für ihn eine Politik des reinen Selbsterhaltungstriebes und ein notwendiger Schritt, um die Souveränität der BRD wiederzuerlangen.
Was versteht man unter der "Politik des Verzichts"?
Die "Politik des Verzichts" beschreibt Adenauers Strategie, durch Integration in supranationale Organisationen (z.B. EGKS, WEU, NATO) Souveränität zu erlangen. Der Verzicht auf bestimmte Souveränitätsrechte machte die BRD für ihre Partner berechenbarer und führte letztendlich zu mehr Handlungsfreiheit.
Welche Rolle spielte der Marshallplan für die Westintegration?
Der Marshallplan war ein entscheidender Faktor für die Westintegration, da er die wirtschaftliche Stabilisierung Westdeutschlands förderte und die BRD in die OEEC einband. Dies war ein wichtiger Schritt, um das ökonomische und politische Potential Westdeutschlands dauerhaft zu kontrollieren und gleichzeitig den Aufbau eines starken Westblocks zu ermöglichen.
Was waren die Gründe für das Scheitern der EVG (Europäische Verteidigungsgemeinschaft)?
Der EVG-Plan scheiterte 1954 an der Befürchtung der französischen Nationalversammlung vor einem militärisch wiedererstarkten Deutschland und an der Hoffnung auf eine Entspannung der Beziehungen zwischen Ost und West nach Stalins Tod.
Welchen Einfluss hatte der Beitritt zur WEU und NATO auf die BRD?
Der Beitritt zur WEU und NATO begrenzte die militärischen Kapazitäten der BRD, ermöglichte aber gleichzeitig die Integration in das westliche Bündnis und die Anerkennung der Souveränität (wenn auch nicht der vollen Souveränität) durch die Westmächte.
Was bedeutet die These von "Challenge and Response" in Bezug auf die Bonner Außenpolitik?
Die These besagt, dass die außenpolitischen Konzeptionen der BRD bis 1989 Reaktionen bzw. Antworten auf die Herausforderungen der sich wandelnden Konstellationen in den internationalen Beziehungen waren. Obzwar reaktiv, konnten diese Konzeptionen auch Impulse auf die internationalen Beziehungen ausüben.
Was war die Doppeleindämmungspolitik der USA?
Die USA verfolgten eine Doppeleindämmungspolitik: Erstens die Eindämmung der SU durch ein starkes und einiges Westeuropa und zweitens die Eindämmung der BRD durch ihre Integration in die OEEC und Internationale Ruhrbehörde. Die BRD sollte Westeuropa stärken und die SU-Expansion stoppen, war aber selbst nur begrenzt handlungsfähig.
- Quote paper
- Oliver Stengel (Author), 2002, Die Leitprinzipien Bonner Außenpolitik 1949 bis 1989, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106674