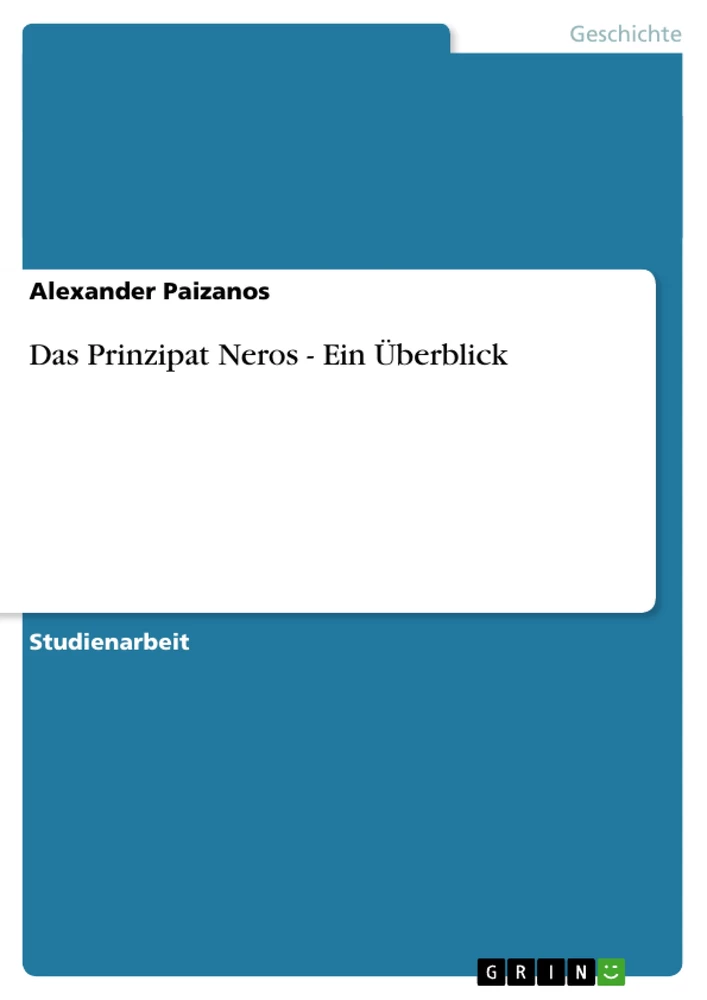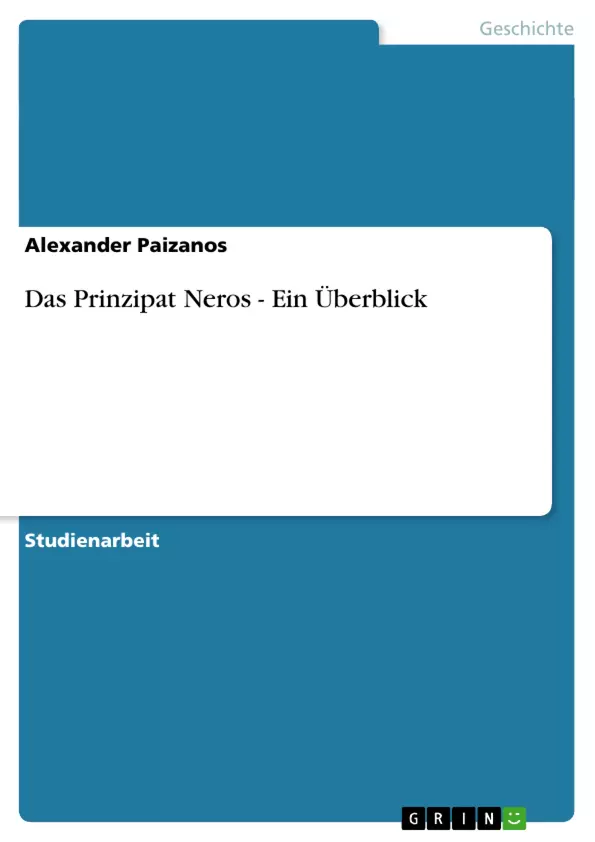Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Zur Person Neros: Sein familiärer Hintergrund und seine Jugend
2. Agrippinas Einflußnahme auf Neros Kaisererhebung
2.1 Seneca und Burrus am kaiserlichen Hof - Ihre positive Einfluß- nahme auf Nero: „Fünf goldene Jahre“
2.2 Neros Emanzipation von Agrippina und ihre Ermordung
3. Der Brand Roms und seine Folgen - Nero als Brandstifter?
3.1 Die Pisonische Verschwörung - Der Wandel zum Tyrannen?
3.2 Die Verschwörung und Neros Ende
4. Fazit
5. Bibliographie
1. Einleitung
Nero gehört zweifelsfrei zu den berühmtesten und berüchtigtesten Personen in der Weltgeschichte. Er gilt als die Personifikation des Bösen, Innbegriff des dem Cäsarenwahn verfallenen Tyrannen und manchmal sogar als Antichrist schlechthin. Nur wenige Persönlichkeiten haben es in den Jahrhunderten geschafft, ihn an schlechtem Ruf zu übertreffen.
Andererseits war er eine schillernde und fassettenreiche Person der Zeitgeschichte, musisch begabt und vielseitig interessiert, mit einem Hang zum Theatralischen und zur Selbstüberschätzung.
Diese Arbeit soll auch der Frage nach den Gründen für dieses Negativbild, welches er der Nachwelt hinterlassen hat, nachgehen; vielmehr noch soll sie Fakten und Behauptungen, die als Tatsachen anerkannt werden, darlegen und somit einen Gesamteindruck über sein Prinzipat vermitteln.
Die wichtigsten Quellen für Neros Lebensbeschreibung liefern P.1 Cornelius Tacitus (ca. 55 - 116), C.2 Suetonius Tranquillus (ca. 70 - 150) und Cassius Dio (ca. 150 - 235).
Tacitus, ein Sohn ritterlicher Herkunft, bekleidete während seines Cursus Honorum die höchsten Ämter bis hin zum Prokonsulat in Asia unter Nerva. Er vermittelt in seinen Annalen ein detailliertes Bild über das julisch-claudische Kaiserhaus. Da sein Werk im 16. Buch abbricht, kann auf ihn bei der Beschreibung von Neros letzten beiden Regierungsjahren nicht zurückgegriffen werden.
Sueton gehörte ebenfalls dem Ritterstand an und wurde standesüblich in der Rhetorik ausgebildet und war später als Advokat tätig. Von seinen Werken sind die Kaiserbiographien fast vollständig erhalten. Darin schildert er das Leben aller Kaiser, Caesar eingeschlossen, bis zu Domitian. Seltsamerweise sind seine Abhandlungen über die julisch-claudische Dynastie sehr viel ausführlicher als die des flavischen Hauses, obwohl dies ihm zeitlich näher stand. Im Unterschied zu Tacitus ist Sueton auf Unterhaltung aus. Daher hängt ihm auch mitunter der Makel des Klatschkolumnisten an, was vor allem aus seiner Vorliebe für Anekdoten und der umfangreichen Beschreibung allzu menschliche Züge herrührt.
Auch Cassius Dio, aus Bithynien stammend, bekleidete die höchsten römischen Ehrenämter und hatte zweimal das Konsulat inne. Er selbst gibt Auskunft über viele seiner Daten. Als einziger der drei genannten Autoren schrieb er in griechischer Sprache. Von seinen literarischen Werken am wertvollsten ist die von ihm selbst miterlebte Zeit nach Marc Aurel. Seine Biographie über Nero wirft hingegen mehr Fragen auf als Antworten zu geben, wobei seine Quellen im Dunkeln bleiben und sein Werk daher umstritten ist. Von seiner achtzig Bände umfassenden „Römischen Geschichte“ sind nur die Bände 36-60 und Teile aus 78 und 79 erhalten.
1.1 Zur Person Neros: Sein familiärer Hintergrund und seine Jugend
Lucius Domitius Ahenobarbus, der spätere Kaiser Nero, wurde am 15. Dezember des Jahres 37 in Antium, nahe Rom, zur Welt gebracht.
Väterlicherseits stammte er von einer der angesehensten Familien der plebejischen Nobilität ab, den Ahenobarbi, was Erz- oder Rotbart bedeutet und tatsächlich mit den erzfarbenen Haaren der Familienmitglieder in Verbindung steht3. Sueton erklärt die Entstehung des Familiennamens mit einer Legende, nach der dem Stammvater Lucius Domitius einmal, als er vom Felde kam, die göttlichen Zwillingsbrüder Castor und Pollux begegneten und ihm auftrugen Rom einen Sieg zu melden, von dem es noch keine zuverlässigen Angaben gab. Als göttlichen Beweis verwandelten sie sein bis dahin schwarzes Haar in erzfarbenes4.
Auch nachdem sie schon sieben Konsuln, zwei Triumphatoren und zwei Censoren gestellt hatten und somit unter die Patrizier aufgenommen worden waren, zählten sie weiterhin zur plebejischen Nobilität, da sie erst seit relativ kurzer Zeit, nämlich seit 192 v. Chr., als der erste aus ihrer Familie das Konsulat bekleidete, dem Patriziertum angehörten5.
Gnäus Domitius Ahenobarbus, Lucius6 Vater, war aus der Ehe des Domitius mit Antonia der Älteren hervorgegangen, die eine Nichte des Augustus und eine Tante des späteren Kaisers Claudius und des Germanicus, Lucius Großvater mütterlicherseits, war.
Im Jahre 28 heiratete Gnäus auf Anweisung des Kaisers Tiberius dessen zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alte Enkelin Agrippina die Jüngere. Tiberius Wahl war wegen der engen verwandt-schaftlichen Beziehung von Gnäus zu Augustus und wegen des Ansehens seiner Familie auf ihn gefallen7. Im Jahre 32 bekleidete er das ganzjährige Konsulat, fiel danach allerdings in Ungnade und entkam der drohenden Strafe wegen Majestätsbeleidigung und Blutschande mit der eigenen Schwester Domitia Lepida durch den inzwischen eingetretenen Thronwechsel8. Unter Caligula wurde er noch im gleichen Jahr 37 des Ehebruchs beschuldigt und mußte Rom verlassen. In seinem Exil in Pyrgi, dem heutigen Santa Severa bei Rom verstarb er im Jahre 40 an der Wassersucht, wie es Sueton angibt.9
Stellte der Vater die nötige Verbindung zu Augustus her, die unabdingbar war, um überhaupt als möglicher Nachfolger auf dem Kaiserthron in Betracht zu kommen, so war die Abstammung von Lucius Mutter Iulia Agrippina minor, geboren am 6. November 15 n. Chr., von noch adligerer Natur. Sie hatte nämlich sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits eine enge Verwandtschaft zum julisch- claudischen Haus. Ihre Mutter Vipsania Agrippina maior war eine direkte, blutsverwandte Enkelin von Augustus, da ihre Mutter Iulia aus Augustus erster Ehe mit Scribonia hervorgegangen war. Ihr Vater Germanicus war ein Enkel der Livia Augusta, die dessen Vater Drusus und dessen Onkel, den späteren Kaiser Tiberius, in ihrer ersten Ehe mit Tiberius Claudius Nero zur Welt gebracht hatte. Germanicus war wohl auch ursprünglich als Augustus Nachfolger vorgesehen, ergriff allerdings nicht die Gunst der Stunde, als er von dessem Tod erfuhr und schon von seinen Soldaten in Germanien zum Kaiser ausgerufen wurde, sondern erkannte sogleich Tiberius als Kaiser an und bot der aufkommenden Meuterei und einem möglicherweise daraus resultierenden Bürgerkrieg nur durch ein auf Tiberius Namen gefälschtes Dokument und eigenes Geld Einhalt10.
Gerade in diesem rücksichtsvollen und bescheidenen Verhalten des Germanicus sieht Vandenberg den Grund für Agrippinas11 enormen Ehrgeiz und ihr rücksichtsloses Verhalten auf dem Weg zum Durchsetzen ihrer Ziele. Seiner Ansicht nach hat sie es nie verkraftet, daß ihr Vater im passenden Moment nicht nach der Macht gegriffen hat und auf Grund seiner Bescheidenheit und Tatenlosigkeit letzten Endes gescheitert ist12.
Lucius hatte es in seinen frühen Kinderjahren sicherlich nicht leicht. Seine Mutter Agrippina wurde des Ehebruchs und der Mitwisserschaft in einer gegen Caligula gerichteten Verschwörung angeklagt und im Jahr 39 nach Korsika verbannt13. Ihren Sohn ließ sie bei seiner Tante väterlicherseits Domitia Lepida zurück, wo er von einem Tänzer und einem Barbier aufgezogen wurde14. Im darauf folgenden Jahr verstarb sein Vater Gnäus im Exil und Lucius blieb fast mittellos zurück, da sich sein Onkel Caligula seines Erbanteils bemächtigt hatte15. Die Wende zu besseren Zeiten erfolgte erst mit dem Tod des Caligula und der Nachfolge seines Großonkels Claudius im Jahr 41. Dieser hob umgehend die Agrippina auferlegte Verbannung auf und sie gelangte zusammen mit Lucius an den kaiserlichen Hof. Zwischen Messalina, Claudius Gattin, und Agrippina kam es zu erheblichen Spannungen, da erstere ihre eigene Position durch die Nichte des Kaisers gefährdet sah und ihrer möglichen Nebenbuhlerin und deren Sohn nachstellte. Agrippina sah sich daraufhin gezwungen, ihrer Sicherheit willen eine Ehe mit dem Redner Cripsus Passienus, einem Freund Senecas, einzugehen16. Nachdem sich Messalina durch ihre Heirat mit Gaius Silius, was einer Scheidung von Claudius gleichkam, ausgeschaltet hatte, ließ Agrippina ihren Ehemann Crispus Passiendus töten, da nun der Weg zu Claudius frei geworden war17. Lucius hatte sein väterliches Vermögen zurückbekommen und gelangte nun durch die erneute Erbschaft zu Reichtum18. Seinen ersten erwähnten Auftritt in der Öffentlichkeit hatte Lucius während der, aus Anlaß der 800-Jahr-Feier Roms abgehaltenen, Trojaspiele. Als er mit offensichtlicher Begeisterung an den Darbietungen teilnahm, wurde ihm von den Zuschauern sehr viel Sympathie entgegengebracht19.
Der eigentliche Aufstieg zur Macht sollte fortan beginnen.
2. Agrippinas Einflußnahme auf Neros Kaisererhebung
Eine Herrscherin wie Kleopatra konnte nur in der hellenistisch geprägten östlichen Mittelmeerregion auftauchen; im alten Rom blieb das Herrschen allein den Männern vorbehalten. Frauen blieb keine andere Möglichkeit als an der Seite einflußreicher Männer eine machtvolle Position in der Gesellschaft einzunehmen.
Da Agrippina als Frau nicht herrschen konnte, investierte sie ihren gesamten Ehrgeiz in ihren Sohn Lucius, um ihn auf den Thron zu bringen und durch ihren Einfluß auf ihn beinahe uneingeschränkte Macht über das römische Weltreich zu erhalten20. Um dieses Ziel zu erreichen heiratete sie zunächst ihren eigenen Onkel Claudius im Jahr 49, zu dessen Ermöglichung vom Senat zuvor das Eheverbot zwischen Onkeln und Nichten aufgehoben wurde21.
Daraufhin erwirkte sie die Rückberufung Senecas aus der korsischen Verbannung22 um ihrem Sohn die bestmögliche Erziehung anzueignen. Er galt schließlich als der beste Schriftsteller seiner Zeit und sollte den jungen Lucius auf seine spätere Rolle als Kaiser vorbereiten.
Claudius hatte drei gemeinsame Kinder aus seiner Ehe mit Messalina. Antonia, Britannicus, der im Jahr 41 geboren worden war und Octavia, die ein Jahr zuvor das Licht der Welt erblickt hatte.
Da Britannicus ein leiblicher Sohn des Claudius war, hatte er einen höheren dynastischen Rang als Lucius. Agrippina wußte dieser Situation Abhilfe zu verschaffen und die Position ihres Sohnes in der Rangfolge zu erhöhen, indem sie noch im selben Jahr 49 die Verlobung zwischen ihrem Sohn und Octavia mit Unterstützung des Senates, der sich für diesen Schritt ausgesprochen hatte, erreichte23. Die endgültige Höherstellung Lucius gegenüber Britannicus erfolgte allerdings erst mit seiner Adoption von Claudius, die am 25. Februar des Jahres 50 vollzogen wurde24. Von diesem Zeitpunkt an hieß er Nero Claudius Drusus Germanicus Caesar, kurz Nero25 und hatte Britannicus gegenüber die Stellung eines um drei Jahre älteren Bruders. Agrippina erhielt im gleichen Jahr den Beinamen und Ehrentitel Augusta26, womit sie ihre herausragende und einflußreiche Position an der Seite des Kaisers hervorhob.
Im darauffolgenden Jahr wurde Nero unter großen Feierlichkeiten und Ehrenbekundungen die Toga virilis (Männertoga) verliehen. Auf Anraten des Senates sollte er auch als designierter Konsul außerhalb Roms prokonsularische Gewalt besitzen und Fürst der Jugend genannt werden. An das Volk und die Soldaten wurden in seinem Namen Geldgeschenke verteilt. Besonders offensichtlich wurde die höhere Stellung Neros gegenüber Britannicus in der Öffentlichkeit, als beide bei einem Zirkusspiel erschienen. Während sich Nero im Triumph-gewand präsentierte, trug Britannicus noch immer das Knabenkleid27.
Schließlich heiratete der fünfzehnjährige Nero die dreizehnjährige Octavia im Jahr 5328 und war nun nicht nur Claudius Adoptiv- sondern auch Schwiegersohn. In der Auffassung, daß Agrippina in all diesen Punkten die Initiatorin war, sind sich die antiken Quellen einig. Ihr Einfluß auf den kaiserlichen Gatten war derart enorm, daß er es nicht gewagt hätte, ihren Ambitionen Einhalt zu gebieten.
Da nun feststand, daß es keinen anderen Nachfolger für Claudius geben konnte als Nero, zögerte sie laut einhelliger Quellenmeinung nicht, ihrem kaiserlichen Gatten ein jähes Ende zu bereiten.
Demnach soll sie den kränkelnden Claudius, kurz nachdem er aus einer Badekur in Sinuessa zurückgekehrt war29, mit einem Pilzgericht, dem sie ein von der Giftmischerin Locusta angefertigtes Mittel untergemischt hatte, vergiftet haben. Da der Mordversuch aufzufallen drohte, weil das Gift zu langsam wirkte, soll der miteingeweihte Arzt Xenophon ihm, im Anschein des Helfens beim Erbrechen, eine vergiftete Feder in die Kehle gestochen haben, so daß der Kaiser am Abend des 12. Oktober 54 verstarb30. Die Deutung der Vorzeichen hatte ergeben, daß ein schlechter Zeitpunkt für einen Thronwechsel bestand. Aus diesem Grund wurde Claudius Tod noch einige Stunden geheimgehalten31, so daß der siebzehnjährige Nero am Mittag des 13. Oktober in Begleitung des Prätorianerpräfecten Sextus Afranius Burrus vor die Palastwache trat, die ihn auf Anweisung Burrus mit Jubel empfing. Danach ließ er sich in einer Sänfte in das Soldatenlager tragen, wo er ebenfalls als Kaiser bejubelt wurde, nachdem er eine Rede gehalten und Geschenke versprochen hatte. Von dort aus machte er sich zur Curie auf, wo er vom Senat offiziell die Kaisertitel erhielt und einzig den Namen pater patriae seiner Jugend wegen ablehnte32.
Agrippina hatte somit ihr langersehntes Ziel erreicht. Ihr Sohn war Kaiser des römischen Weltreiches und durch ihren Einfluß auf ihn, hatte sie zunächst die eigentliche Macht inne.
2.1 Seneca und Burrus am kaiserlichen Hof - Ihre positive Einflußnahme auf Nero: „Fünf goldene Jahre“
Trajan soll über ein halbes Jahrhundert später die ersten fünf Regierungsjahre Neros, das sogenannte Quinquennium Neronis, als die blühendste und friedlichste Zeit der damaligen Monarchie bezeichnet haben33. So hat sich auch heute noch die Überzeugung durchgesetzt, Seneca und Burrus haben den unreifen Kaiser in die richtigen Bahnen gelenkt und Rom damit „fünf goldene Jahre“ beschert. Die antiken Autoren Sueton, Tacitus und Cassius Dio äußern sich hingegen sehr viel nüchterner über jene Zeit und verwenden auch nicht den Ausdruck Quinquennium Neronis, der zweifelsfrei erst später aufgekommen ist. Massimo Fini geht sogar soweit, daß er die These aufstellt, Trajan habe sich in Wirklichkeit auf die letzten fünf Jahre des Prinzipates von Nero bezogen; auf die Zeit, als er sich jeglicher Bevormundung durch Agrippina, Seneca und dem Senat entzogen hatte und somit seine eigene Politik voll entfalten konnte34.
Die Quellen äußern sich darüber allerdings ganz anders. Wenn sie positive Entwicklungen, die sich unter Neros Regentschaft zugetragen haben, erwähnen, dann werden sie in der Tat der Frühzeit seiner Regierung zugeordnet. Zum Ende hin finden sich nur noch Schandtaten.
Tacitus sieht Senecas und Burrus Rolle wie folgt:
„Man hätte mit den Morden fortgefahren, hätten nicht Afranius Burrus und Annaeus Seneca dem Wüten zu begegnen gesucht. Diese, als Führer des jugendlichen Imperators und, was bei gemeinschaftlicher Macht selten ist, untereinander einträchtig, bewirkten gleichviel durch entgegengesetzte Mittel, Burrus durch Sorgsamkeit in militärischen Angelegenheiten und Strenge der Sitten, Seneca durch Lehren und Beredsamkeit und edle Gefälligkeit.“ (Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.2)
Genauso wie Cassius Dio35 sieht Tacitus in Senca und Burrus das ausgleichende Gegengewicht zu Agrippinas progressiver Machtgier. In den von Seneca verfaßten Reden betonte Nero sein Vorhaben, nach augusteischer Vorlage36, also mit Respekt vor der republikanischen Staatsform, die ja offiziell nie abgeschafft worden war, zu regieren. In der Curie bekundete er, daß er auf Grund der fehlenden Erfahrungen mit Bürgerkriegen, ohne Haß und Rachegelüste sein Amt antreten werde37. Sueton erwähnt Neros Freigebigkeit, Milde und Leutseligkeit, die er mehrfach unter Beweis stellte38.
Zu den Reformen der frühen Regierungszeit Neros, gehört zum einen die gerechtere Neuordnung des Gerichtswesens. Er wollte nicht mehr allein oberste Instanz in allen Rechtsfällen sein, um so für eine breitere Streuung der Verhandlungen auf andere Instanzen zu sorgen, die zu mehr Gerechtigkeit führte und er bot Bestechung und Korruption in der Rechtssprechung Einhalt39.
Zum anderen hatte Nero im Jahr 58 das Vorhaben, eine großangelegte Steuerreform durchzusetzen, die allerdings am Senat scheiterte40. Waren, die von einem Distrikt des Reiches in ein anderes gelangten, wurden an jeder Grenze erneut verzollt. Dies führte zur Unmut der Bevölkerung, da diese Abgaben einen Großteil der eigentlichen Preise ausmachten. Der Senat argumentierte gegen diese Abschaffung damit, daß mit ihnen alle Steuern abgeschafft werden müßten und dies einem Staatsbankrott gleichkommen würde. Daher mußte sich Nero mit einigen kleineren Steuerreformen begnügen, die jedoch allesamt den breiten Bevölkerungs- schichten zugute kamen41.
So verlief auch die zweite Hälfte seines sogenannten Quinquenniums ohne nennenswerte Zwischenfälle, die seine Macht in Gefahr gebracht hätten. Zu den Vorkommnissen zählten Streitigkeiten um die Amtsgewalt der Tribunen, zahlreiche Prozesse gegen Statthalter, denen Erpressungen vorgeworfen wurden, sowie einige großzügige Geschenke an die Bevölkerung, die Nero teils aus eignem Vermögen finanzierte42. Im Kampf um die Vorherrschaft über Armenien siegte der römische Feldherr Corbulo43.
Da es nicht in Neros Interesse lag, die weitere Expansion des ohnehin bereits gewaltigen Römischen Reiches voranzutreiben44, blieben größere Schlachten, von einigen Ausnahmen in Britannien und Armenien abgesehen, aus. Auch dies führte zu einer Epoche des Friedens, wodurch das spätere Bild der friedlichen Anfangsjahre seiner Regentschaft zusätzlich geprägt wurde.
2.2 Neros Emanzipation von Agrippina und ihre Ermordung
Wie gewaltig Agrippinas Anteil an der kaiserlichen Macht zu Beginn von Neros Prinzipat war, wird am stärksten durch auch heute noch erhaltene Münzen verdeutlicht. Erstmals sind auf ihnen nicht der Prinzeps alleine dargestellt, sondern es sind Nero und Agrippina einander zugewandt abgebildet. Münzen waren das bedeutendste Propagandamittel jener Zeit; sie gelangten bis in die entferntesten Provinzen. Auch die Legende gibt Aufschluß über Agrippinas Stellung. Ihr Name erscheint im Nominativ, während Neros Titel im Dativ gehalten sind. Ihm sind die Münzen somit nur gewidmet, während sie als Trägerin der Münzhoheit bestätigt wird, was sonst dem Souverän alleine zusteht.
Allerdings nahmen die Dinge danach schnell einen anderen Lauf, als sie es sich erdacht hatte. Laut Fuhrmann hatte Agrippina geglaubt, sie habe sich mit der Rückberufung Senecas aus dem Exil und dem Einsatz von Burrus als Prätorianerpräfect, beide aus Dankbarkeit gefügig gemacht. Sie habe allerdings nicht damit gerechnet, daß beide von ihr unabhängig versuchten, auf den jungen Kaiser einzuwirken, um ein, den besten Traditionen des römischen Staates gehorchendes, Reichsregiment ins Werk zu setzten45.
Es brach somit ein Konflikt zwischen den beiden Parteien aus und Nero wurde zwischen den Fronten Agrippina sowie Seneca und Burrus hin- und hergerissen. Ausschlaggebend für Neros Bruch mit Agrippina soll zunächst seine Liebe zu einer Freigelassenen syrischer Herkunft namens Acte im zweiten Jahr seiner Regierung gewesen sein46. In entbrannter Eifersucht habe Agrippina laut Tacitus Nero damit gedroht, sie werde die Umstände, unter denen er auf den Thron gekommen sei, aufdecken und Britannicus seine, ihm zustehende, Position einnehmen lassen47. Daraufhin habe der Kaiser aus Furcht seinen Stiefbruder durch Gift, das erneut von der Giftmischerin Locusta angefertigt worden war, während eines Mahles vergiften lassen48.
Agrippina ließ währenddessen nicht nach, Octavia und verschiedene Offiziere auf ihre Seite zu bringen. Die Situation begann sich soweit zuzuspitzen, daß Nero ihr die Ehrengarde entzog und ihr eine neue Unterbringung fernab des Kaiserpalastes beschaffte49. Er soll sie durch Psychoterror von sich fernzuhalten versucht haben. Hielt sie sich in Rom auf, verwickelte er sie in zahllose Prozesse, zu deren Führung es ihr Kraft und Nerven kostete. Zog sie sich auf ihre Villa zurück, schickte er Gruppen vorbei, die sie beschimpften und ihr drohten50.
Als Agrippina eines Komplotts gegen den Kaiser bezichtigt wurde, wäre Nero beinahe bereit gewesen, sie ermorden zu lassen. Dem Einwirken des Burrus ist es zu verdanken, daß ihr am nächsten Tag die Gelegenheit zur Rechtfertigung geboten wurde, bei der sich ihre Unschuld herausstellte51. Dennoch stellte sie von diesem Zeitpunkt an eine akute Gefahr für Nero dar, derer er sich entledigen mußte, wollte er nicht Gefahr laufen, selbst eines Tages ermordet zu werden.
Sabina Poppea schließlich, die in erster Ehe mit dem späteren Kaiser Otho verheiratet war, und später Neros Frau werden sollte, stellte ihn vor die Wahl zwischen ihr und seiner Mutter52. Nero gab sicherlich nicht ohne das Mitwirken Senecas und Burrus den Befehl zu ihrer Ermordung. Es war allerdings ausgeschlossen, sie von seiner Garde umbringen zu lassen; zum einen, da diese der gesamten kaiserlichen Familie Treue geschworen hatten und zum anderen, weil bei ihr die Tochter des beliebten Germanicus in zu hohem Ansehen stand53. Auch das Volk hätte eine Ermordung der kaiserlichen Mutter nicht geduldet, so daß ihr Ableben als Unfall getarnt werden mußte. Der Befehlshaber der Flotte bei Misenum, ein Freigelassener namens Anicetus, arbeitete einen Plan aus, nach dem Agrippina ein Schiff betreten sollte, das nach dem Ablegen zum auseinanderbrechen gebracht werden konnte und sie, in den Trümmern eingeklemmt, in den Fluten versinken sollte. Nichts würde auf ein Verbrechen hinweisen und der Kaiser könnte ihr Tempel und Altäre weihen, ohne daß er in Verdacht geriet54.
Als alle Vorbereitungen zur Durchführung des Mordplanes getroffen waren, lud Nero seine Mutter nach Baiä ein, wo sie mit ihm gemeinsam das Fest der Quinquatrien, welches der Göttin Minerva zu Ehren abgehalten wurde, feiern sollte. Tacitus schreibt, Agrippina habe durch Gerüchte von dem Plan erfahren und habe sich deshalb aus Vorsicht in einem Tragesessel herbringen lassen55. Sueton zufolge soll sie mit ihrer Jacht gekommen sein, die als Teil des Plans nach der Ankunft seeuntüchtig gemacht wurde56. Beide Versionen hatten zur Folge, daß Nero seine Mutter durch einen Vorwand auf das eigens präparierte Schiff lockte, welches dann kurz nach der Abfahrt tatsächlich teilweise in sich zusammenstürzte. Der Plan schlug allerdings fehl und Agrippina gelang die Rettung. Aus dem Verhalten der Mannschaft, die mit Trümmer- teilen und Rudern auf ihre um Hilfe rufende Begleiterin, im Glauben es handele sich dabei um Agrippina, einschlugen, erkannte sie, daß es kein Unfall sondern ein gegen sie gerichteter Anschlag gewesen war57. Dennoch stellte sie sich zunächst unwissend, um auf diese Weise vielleicht doch noch mit dem Leben davonzukommen und schickte ihrem Sohn einen Boten, der ihm ausrichten sollte, daß sie wohlauf sei und in ihrer Villa Ruhe brauche. Nach Ansicht von Burrus und Seneca gab es keine andere Möglichkeit, als Agrippina endgültig aus dem Wege zu räumen, da nun die akute Gefahr bestand, daß sie wiederum einen Mordplan gegen Nero ausführen lassen könnte58. Als Tochter des Germanicus hatte sie weiterhin großen Einfluß auf die Prätorianergarde und Teile der Truppen. Während Agrippinas Kurier Nero ihre Botschaft überbrachte, ließ er neben ihm eine Waffe fallen und bezichtigte ihn, seine Herrin habe ihn geschickt, um den Kaiser zu ermorden. Dies war der Vorwand, der erforderlich war, um ihre Tötung zu befehlen, worauf Anicetus mit einer Mordgruppe in Agrippinas Landhaus geschickt wurde und sie niederstreckte59.
Vom Senat wurde diese Version der Umstände von Agrippinas Tode akzeptiert und es wurden Dankgebete verordnet. Ihr Geburtstag sollte fortan zu den Unglückstagen des Kalenders zählen und in der Curie wurde ein goldenes Standbild der Minerva und daneben eine Statue des Prinzeps aufgestellt. Dennoch hegten Nero zunächst große Sorgen, er habe den Rückhalt des Volkes verloren und wagte es daher nicht, nach Rom zurückzukehren. Durch großzügige Gesten versuchte er, die Gunst der Römer zurückzugewinnen. So amnestierte er mehrere Angehörige der Gesellschaft, die auf Agrippinas Befehl in die Verbannung geschickt worden waren. Unter ihnen waren auch zwei ehemalige Konsuln. Die erwünschte Wirkung blieb nicht aus und Nero wurde bei seiner Rückkehr wie ein Triumphator empfangen60.
In der Folgezeit sollte auch der Einfluß der beiden Lehrmeister Seneca und Burrus schwinden, so daß Nero schließlich die völlige Macht nicht nur offiziell, sonder auch tatsächlich alleine inne hatte.
3. Der Brand Roms und seine Folgen - Nero als Brandstifter?
Am 19. Juli des Jahres 64 kam es zu der folgenschwersten Brandkatastrophe, die Rom bis dato erlebt hatte. Zwischen dem Circus Maximus und dem Palatin war in einer eng bebauten Gegend ein Feuer ausgebrochen, das schnell auf die Kaiserpaläste und die übrige Stadt übergegriffen hatte. Nero, der sich zu dieser Zeit in seinem Anwesen bei Antium aufhielt, eilte nach Rom nachdem er von dem Brand in seinem Palast und der Stadt erfahren hatte. Dennoch konnte er wenig ausrichten. Nicht nur, daß seine Residenz, mit all ihren Kunstschätzen, ein Raub der Flammen wurde, ein Großteil der gesamten Stadt, mit ihren zahlreichen Tempeln und Monumenten, die mit unwiederbringlichen Kriegschätzen gefüllt waren, ging in den sechs Tage lang wütenden Feuern unter. Wie vielen Menschen der Brand das Leben gekostet hat, ist ungewiß. Zahllose verloren ihr Obdach und ihr gesamtes Hab und Gut. Am Ende der Katastrophe waren nur vier der vierzehn Verwaltungsbezirke Roms unversehrt geblieben, drei waren völlig niedergebrannt und sieben Stadtteile hatten schwere Schäden erlitten.
Hatte die Stadt dem Feuer völlig machtlos gegenübergestanden, so war die Katastrophen-bewältigung nach dem Brand um so besser organisiert. Einer drohenden Getreidepreisinflation wurde ein Festpreis von drei Sesterzen entgegengesetzt. Schiffe, die Getreide in die Stadt brachten, wurden bei der Rückfahrt zum Abtransport der gewaltigen Trümmermengen genutzt. Erstmals wurden großangelegte Brandschutzbestimmungen verordnet. Es gab Vorschriften bei den Baumaterialien, der Geschoßhöhe und der Architektur. Jedes Haus mußte von eigenen Mauern umgeben sein und die Straßenabstände wurden erweitert. Den Wiederaufbau und die Reinigung der Säulengänge finanzierte Nero sogar aus eigenen Mitteln und er versprach jedem Hauseigentümer einen, seiner Stellung und seinem Vermögen angemessenen, Betrag, den er nach dem Wiederaufbau seines Hauses erhalten sollte. Dieser war an eine Frist gebunden, um den Wiederaufbau zu beschleunigen. Vorsorglich wurde auch die Organisation der Wasserverteilung neu ausgearbeitet und Aufsehern unterstellt, ebenso die Pflicht, Löschwerkzeuge an zugänglichen Orten aufzubewahren.61
All diese fraglos weitsichtigen und großzügigen Maßnahmen des Kaisers verhinderten laut Tacitus indessen nicht, daß es Gerüchte gab, er selbst hätte den Brand legen lassen, um seinen Palast zu erweitern und Rom zu verschönern. Daraufhin habe Nero die Christen der Brand-stiftung bezichtigt und sie auf grausame Art und Weise bestrafen lassen. Der Legende nach sollen bei diesen ersten Christenverfolgungen auch Petrus und Paulus den Tod gefunden haben. Dennoch hält sich Tacitus bei der Beschuldigung Neros am Brand Roms zurück. Er schreibt, daß von beidem, einem Unglück und einer Hinterlist des Fürsten, berichtet worden sei und hält sich daher neutral62. Cassius Dio findet ein Jahrhundert später viel deutlichere Worte in seinen Anschuldigungen. In seiner Darstellung wollte Nero mit dem Brand Roms seinen Plan der Zerstörung der Stadt und des Reiches ausführen und habe daher Leute ausgeschickt, die, sich betrunken stellend, an verschiedenen Orten Feuer legten63. Auch Sueton ist sich in seinen Anschuldigungen gegen Nero ganz sicher. Weil dem Kaiser die Bauwerke und die engen krummen Straßen zuwider gewesen sein sollten, zündete er die Stadt an64.
Somit wird die Behauptung, Nero habe den Brand Roms befohlen, mit größerem zeitlichem Abstand immer eindeutiger und genauer. Massimo Fini sieht genau in diesen Motiven, die Nero zur Tat angeregt haben sollen, den größten Widerspruch. Ursache und Wirkung werden demnach vertauscht. Die Städtebaulichen Maßnahmen, die Brandschutzvorrichtungen und die Neugestaltung seines Palastes haben zweifellos auch zur Verschönerung der Stadt beigetragen, doch sind sie sicher kein Grund für ein vorsätzlich gelegtes Feuer gewesen. Nero hätte als Kunstliebhaber sicherlich nicht beinahe seine gesamte Sammlung mutwillig zerstört, ganz zu Schweigen von den unzähligen Kunstschätzen, die in den Tempeln und Schatzhäusern zerstört wurden.65 Die Vermutung liegt somit nahe, daß Nero tatsächlich am Brand Roms unbeteiligt war und dieser durch ein Unglück ausgebrochen ist. Der römische Kaiser war zugleich eine Art Schutzgott, der für alles Gute, aber auch für alles Schlechte, welches dem Reich widerfuhr, verantwortlich gemacht wurde. Daher ist es verständlich, daß Gerüchte im Umlauf waren, die den Kaiser als Schuldigen an dieser Katastrophe bezichtigten66. Die sich während der Jahrhunderte durchgesetzte Meinung, Nero sei der Brandstifter gewesen, resultiert somit aus der christlichen Negativeinstellung gegenüber dem heidnischen Kaiser unter dem es die erste bekannte Christenverfolgung gab.
3.1 Die Pisonische Verschwörung und ihre Auswirkungen - Der Wandel zum Tyrannen?
Für den 19. April 65 war ein Mordanschlag auf den Kaiser vorgesehen, dessen Drahtzieher der zu den höchsten Adelskreisen gehörende Gaius Calpurnius Piso war. Der Plan sah folgendes vor: Am Tag der Zirkusspiele, die zu Ehren des Sonnengottes Ceres abgehalten wurden, sollte sich der Senator Palutius Lateranus im Tempel des Sonnengottes am Circus Maximus Nero zu Füßen werfen und ihn dabei zu Boden reißen. Dann sollten die eingeweihten Tribunen und Centurionen mit einem im Tempel postierten Dolch auf ihn einstechen. Daraufhin sollte Piso, der vor Ort auf die Vollstreckung der Tat warten sollte, zum Prätorianerlager gebracht und in Belgeitung von Antonia, der ältesten Tochter Claudius, zum Kaiser ausgerufen werden.67
Die Verschwörer setzten sich aus einflußreichen Römern zusammen und hatten Mitglieder, die zu den engsten Kreisen des Kaisers zählten. Der Grund, aus dem Senatoren, Ritter und Offiziere an dem Komplott teilnahmen, lag darin, daß Nero durch seinen Muttermord, die Erschöpfung der Finanzen nach dem großen Stadtbrand, die Geldabwertung des Jahres 63/ 64 und wegen seiner für einen Kaiser unwürdigen Auftritte als Kitharöde, Schauspieler und Wagenlenker den Rückhalt beim Adel verloren hatte.
Das Attentat schlug fehl, bevor es überhaupt verübt werden konnte. Milichus, ein Sklave des Mitverschwörers Scaevinus, hatte am Vorabend des für den Machtwechsel vorgesehenen Tages durch das Auffällige Verhalten seines Herren Verdacht geschöpft und war mit der Aussicht auf Belohnung am nächsten Morgen zum Palast geeilt, um den Kaiser zu warnen. Daraufhin wurde der gesamte Komplott aufgedeckt und es kam zu einer Säuberungswelle, der schließlich auch Neros Lehrmeister und enger Berater Seneca zum Opfer fallen sollte. Piso hatte sich, als er die Ausweglosigkeit seiner Situation erkannte hatte, durch Selbstmord dem drohenden Strafgericht entzogen68. Gerüchten zu Folge soll es eine weitere Verschwörung innerhalb der Verschwörung gegeben haben, an deren Spitze der Tribun Subrius Flavus gestanden haben soll. Seiner Ansicht nach nützte es nichts, einen Kitharasänger abzusetzen und an dessen Stelle einen Tragöden einzusetzen, womit er auf Pisos gelegentliche Auftritte als Schauspieler anspielte. Demnach hatte er einen weit ehrwürdigeren und erfahreneren Mann für die Kaiserwürde vorgesehen: Seneca69.
Nach der Ansicht von Manfred Fuhrmann ist diese Version jedoch als unglaubwürdig anzusehen. Wegen seines hohen Alters hätte man ihn nicht mit einer aktiven Aufgabe betrauen können und seine bloße Mitwisserschaft hätte das Risiko, entdeckt zu werden, unnötig vergrößert. Daher schreibt Fuhrmann Seneca innerhalb der Verschwörung die Rolle des außenstehenden Mitwissers zu, der, ohne aktiv mitzuwirken, das Vorhaben gebilligt hat70.
Wie tief Seneca in dem Komplott auch verwickelt gewesen sein mag, er fand letzten Endes den Tod durch erzwungenen Selbstmord.
Doch die Bestrafung der mutmaßlichen Verschwörer entglitt entgegen der geläufigen Meinung nicht zum Blutbad, sondern bleib innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. So ließ Nero alle Anklageschriften und Geständnisse veröffentlichen und rechtfertigte sich vor dem Senat.71 Dabei verloren zwar zahlreiche adlige Römer den Tod, doch waren sie alle an einem Komplott gegen den Kaiser beteiligt gewesen und hatten sich eines Kapitalverbrechens schuldig gemacht. Im Vergleich zu seinem Vorgänger Claudius, der aus nichtigeren Gründen 30 Senatoren und 300 Ritter töten ließ, ist die Darstellung Neros als rachsüchtigen Tyrannen somit haltlos72.
3.2 Die Verschwörung und Neros Ende
Während sich Nero bei seiner großen Griechenlandreise, die sich vom 25. September 66 bis zum Beginn des Jahres 68 hinzog, als Künstler feiern ließ, wurden in Rom und in den Provinzen Vorbereitungen getroffen, den zwei Jahre zuvor mißlungenen Versuch, einen gewaltsamen Machtwechsel zu vollziehen, diesmal erfolgreich auszuführen. In den letzten Jahren nach dem Stadtbrand und nach der Aufdeckung der Pisonischen Verschwörung hatte Nero zwischen ständiger Verfolgungsangst und einer übertriebenen künstlerischen Selbstdarstellung getaumelt73. Den Rückhalt beim Senat und der adligen Oberschicht hatte er bereits durch seine Steuer- und Währungsreformen, die zu ihren Ungunsten ausgefallen waren, verloren. Nun sollte sich auch die breite Masse von ihm abwenden. Dazu hatten Engpässe bei der Getreideversorgung, die leeren Staatskassen und die unregelmäßige Auszahlung des Soldes geführt. Auf das Drängen seiner Berater kehrte er Anfang 68 nach Italien zurück und fuhr über Umwege in Rom wie ein Triumphator ein.74
Mitte März erhielt er dann die Nachricht, daß der Statthalter von Gallien, Julius Vindex, sich gegen ihn erhoben hatte. In einem Brief an den Senat ließ Nero Vindex darauf zum Staatsfeind erklären75. Währenddessen hatte Vindex den 73 jährigen Statthalter von Spanien Sulpicius Galba in Briefen aufgefordert, ihn bei seiner Sache gegen Nero zu unterstützen und sich als Kaiser zur Verfügung zu stellen. Galba erteilte nach anfänglichem Zögern Vindex schließlich seine Zusage an und rebellierte offen gegen Nero, worauf dieser ihn ebenfalls vom Senat zum Staatsfeind ausrufen ließ und sein Vermögen konfiszierte76. Dennoch wirkten Neros Gegenmaßnahmen unüberdacht und träge, als hätte er den Ernst der Lage nicht erkennen wollen. Als er von Galbas Aufstand erfuhr, soll er zwar in Ohnmacht gefallen sein, verhielt sich aber anschließend überraschend ruhig und fand sogar noch Zeit für Theaterbesuche77. Schließlich reagierte er doch, indem er das Konsulat alleine antrat und einen Feldzug vorbereitete. Dafür, daß er zu dieser Zeit zunehmend an Realitätsverslust litt, deutet zum einen, daß er laut Sueton vorhatte, den gallischen Truppen unbewaffnet entgegenzutreten und sie einzig durch Weinen zur Aufgabe zu bringen und zum anderen, daß seine Hauptsorge bei den Vorbereitungen des Feldzuges darin lag, auf welche Weise seine Theaterutensilien mitgenommen werden konnten78. Den verstärkten Unmut beim Volk erreichte er durch hohe Abgaben, die er für die Finanzierung des Feldzuges vom Volk verlangte. Der Statthalter von Germania superior besiegte zunächst Vindex Truppen, worauf sich dieser das Leben nahm. Auch Galba rechnete mit seinem unausweichlichen Ende, doch dazu kam es nicht, weil in der Zwischenzeit auch die übrigen Heere von Nero abgefallen waren und sich auf Galbas Seite gestellt hatten. Für weitere Gegenmaßnahme war es nun zu spät und der Kaiser spielte mit den Gedanken, freiwillig den Thron zu räumen und die Statthalterschaft in Ägypten zu übernehmen, oder sogar als Künstler weiterzuleben.79 Doch dabei handelte es sich um unrealisierbare Wunschvorstellungen, denn ein Kaiser konnte nicht einfach abdanken, sondern hatte nur die Möglichkeit, durch seinen Tod den Thron freizumachen. Währenddessen ließ sich Galba durch großzügige Geldversprechungen an die Soldaten, die sie jedoch niemals erhalten sollten, zum Kaiser ausrufen. In der Nacht zum 9. Juni des Jahres 68 schreckte Nero aus dem Schlaf und bemerkte, daß er fast vollkommen verlassen und beraubt worden war. Selbst die Goldbüchse, in der er ein für den Notfall von Locusta angefertigtes Gift aufbewahrte, war gestohlen. Er floh mit einigen wenigen Begleitern zu dem Landhaus seines Freigelassenen Phaon. Auf dem Weg dorthin hörte er, daß Galba von den Prätorianern zum Kaiser ausgerufen wurde. Nach der hastigen und beschwerlichen Flucht erreichten sie schließlich das Landhaus, wo sich Nero in einer armseligen Kammer versteckte. Doch das Ende war unausweichlich und er versuchte es hinauszuzögern. Von einem Eilboten Phaons erfuhr er, daß er vom Senat zum Staatsfeind erklärt worden sei und auf besonders grausame Weise hingerichtet werden sollte. Als schließlich Truppen näherten, die sein Versteck entdeckt hatten, blieb ihm keine andere Wahl mehr, als sich der drohenden Strafe durch Selbstmord zu entziehen. Mit Hilfe seines Kabinett-sekretärs Epaphroniditus stieß er sich einen Dolch in die Kehle, worauf er nach 14 jähriger Regentschaft mit nur 32 Jahren verstarb.80 Sein Leichnahm wurde nicht etwa geschändet, sondern in einem 200.000 Sesterzen teuren Prunkgrab in der Familienbegräbnisstätte der Domitier beigesetzt81.
4. Fazit
Betrachtet man allein die Verbrechen, die Nero vorgeworfen werden, findet man keine Antwort auf die Frage, worin die Gründe für seine herausragende Rolle liegen, als bösartigster unter den römischen Kaisern angesehen zu werden. Was unterscheidet ihn so sehr von den Grausam-keiten unter seinen Vorgängern Tiberius und Caligula oder zahlreichen seiner Nachfolger? Was legitimiert die Verbrechen des heiligen Konstantin, der seine zweite Frau und seinen Sohn umbringen ließ, als er von ihrem Verhältnis erfahren hatte? Bei genauerem Hinsehen kommen Zweifel an einigen, Nero vorgeworfenen, Morden auf.
Durch einen Fußtritt soll er seine schwangere Frau Sabina Poppäa getötet haben. Sueton gibt zu, daß Nero sie leidenschaftlich liebte und sie krank war82. Möglichweise starb sie auch an Komplikationen, die bei dem damaligen Stand der Medizin nicht behandelt werden konnten. Auch seine Tante Domitia Lepida, soll er ermordet haben83. Doch auch sie litt an einer Krankheit und wünschte sich sehnlichst seinen Bartschnitt. Er erfüllte ihr diesen Wunsch und es ist nicht auszuschließen, daß sie darauf eines natürlichen Todes starb. Außer diesen, finden sich noch weitere Hinweise für möglicherweise natürliche Ursachen von ihm angelasteten Morden. Um auf die eigentlichen Ursachen für diese Negativverzerrung zu stoßen, die von den Quellen hinterlassen worden sind, muß man nach den Motivationen fragen, welche die antiken Autoren veranlaßt haben, seinen Ruf zu schädigen.
Zum einen ist festzustellen, daß alle drei Autoren Tacitus, Sueton und Cassius Dio aus jener ritterlichen Oberschicht stammten, denen Nero von Anfang an mehr und mehr Einfluß entzogen hatte. Er betraute meist Freigelassene, also ehemalige Sklaven, die dem niedrigsten Stand in der römischen Gesellschaft angehörten, mit Aufgaben, die gewöhnlich der Adelsschicht vorbehalten waren. Ebenfalls führten Neros Steuerreformen zu empfindlichen Einbußen gerade bei jener Schicht, so daß sie in ihren Einstellungen ihm gegenüber negativ vorgeprägt waren. Darüber hinaus schickte es sich nicht für einen Kaiser, als Kitharöde, Wagenlenker und Schauspieler öffentlich aufzutreten. Er hatte eine starke Zuneigung für die hellenistische Welt, was besonders seine lange Griechenlandreise zum Ausdruck bringt. So schenkte er der griechischen Provinz nach seinen künstlerischen Erfolgen die Freiheit und ließ sich bei seiner Rückkehr in Rom wie ein Triumphator feiern. Was für ihn zählten, waren künstlerische Erfolge im starken Gegensatz zu kriegerischen Auseinandersetzungen und Gladiatorenspielen, die er verachtete und abschaffen ließ. Auch seine Vorliebe für die Juvinalien und seine Einführung der Neronia lassen seine große Vorliebe für die hellinistische Kultur erkennen. Dies waren allerdings Tugenden, die bei den Römern eher auf Verachtung stießen. Für sie zählten Härte, Disziplin und Siege; übertriebene Vorliebe für das Griechentum hielten sie für weichlich.
Zum anderen haben die frühchristlichen Schreiber möglicherweise zu einer weiteren Negativverzerrung Neros beigetragen. Unter ihm hatten schließlich die ersten bekannten Christenverfolgungen stattgefunden und der Tod des Petrus und Paulus, der sich dabei zugetragen haben soll, führten wahrscheinlich dazu, daß Textstellen, die gute Taten Neros beschrieben und die nicht in das allgemeine Negativbild paßten, schlicht weg beim Abschreiben ausgelassen wurden. Da mittlerweile keine Originale aus der Antike mehr erhalten sind, sondern es sich bei allen bekannten Werken um Abschriften aus dem Mittelalter handelt, kann dies nicht ausgeschlossen werden.
Wie ist Nero aber wirklich zu beurteilen? Daß unter ihm Verbrechen begangen wurden, die nach heutigen Maßstäben gegen die Menschenwürde verstoßen, ist nicht zu verleugnen. Doch sollte ihm mehr Verständnis entgegengebracht werden. Zum einen war er gerade 17 Jahre alt, als er die mächtigste Position der damaligen Welt einnahm. Eine unglaubliche Verantwortung muß auf ihm gelastet haben und er war sich sicherlich den Gefahren, die ihm ständig drohten, bewußt. Die Konsequenzen aus der erdrückenden Dominanz seiner Mutter sind bekannt und wie sehr es einen jungen Menschen prägt, der ständig als Spielball von einflußreichen Beratern mißbraucht wird, ist kaum abzusehen. Er war gewiß kein Unschuldslamm, doch das Monster, als das er Jahrhunderte lang angesehen wurde, hat wohl niemals existiert. Sein wahres Antlitz hingegen ist durch die Manipulationen in der Geschichtsschreibung auf immer verloren gegangen.
5. Bibliographie
Quellen:
- Cornelius Tacitus: Annalen, Band III Buch 11 - 13 und Band IV Buch 14 - 16 Heidelberg (1967)
- Cassius Dio: Römische Geschichte, Buch 58 - 63 Zürich (1987)
- Sueton: Caesarenleben, S.326 - 384 Stuttgart (1986)
- Plutarch: Große Griechen und Römer Zürich - Stuttgart (1965)
Sekundärliteratur:
- Barrett, Anthony A.: Agrippina - Mother of Nero (1996)
- Bergmann, Marianne: Der Koloß Neros - Die Domus Aurea und der Mentalitätswechsel im Rom der frühen Kaiserzeit Mainz (1994)
- Braund, David: Augustus to Nero - A sourcebook on Roman history 31 BC - AD London (1985)
- Cizek, Eugen: Néron - L’empereur maudit Paris (1982)
- von Domeszewski, Alfred: Geschichte der römischen Kaiser Leipzig (1909)
- Duruy, Victor: Caligula und Claudius, Messalina und Agrippina in Wort und Bild Leipzig (1894)
- Eck, Werner: Agrippina - Die Stadtgründerin Kölns - Eine Frau in der frühkaiserlichen Politik Köln (1993)
- Elsner, Jás und Masters, Jamie: Reflections of Nero - Culture, history and representations London (1994)
- Erdle, Hans: Persius - Augusteische Vorlage und neroische Überformung Pfaffenhofen (1968)
- Fini, Massimo: Nero - Zweitausend Jahre Verleumdung München (1994)
- Fuhrmann, Manfred: Seneca und Kaiser Nero Frankfurt (1999)
- Grant, Michael: Nero London (1970)
- Heinz, Kurt: Das Bild Kaiser Neros bei Seneca, Tacitus, Sueton und Cassius Dio Bern (1946)
- Henderson, Bernhard William: The life and principate of the empereor Nero London (1905)
- Jakob-Sonnabend, Waltraud: Untersuchungen zum Nerobild in der Spätantike Hildesheim (1990)
- Kierdorf, Wilhelm: Sueton - Leben des Claudius und Nero - Textausgabe mit Einleitung, kritischem Apparat und Kommentar Paderborn (1992)
- Malitz, Jürgen: Nero München (1999)
- Robichon, Jacques: Nero - Sonderausgabe München (1998)
- Rudich, Vasily: Dissidence and literature under Nero - the price of rhetoricization London (1997)
- Schubert, Christoph: Studien zum Nerobild in der lateinischen Dichtung der Antike Stuttgart (1998)
- Shotter, David: Nero London (1997)
- Smallwood, E. Mary: Documents illustrating the principates of Gaius, Claudius and Nero Cambridge (1967)
- Sorensen, Villy: Seneca - Ein Humanist an Neros Hof München (1984)
- Stoever, Hanz Dieter: Der Fall Nero Würzburg (1992)
- Vandenberg, Philipp: Nero - Kaiser und Gott, Künstler und Narr Bergisch-Gladbach (2000)
- Warmington, B.H.: Nero - Reality and legend London (1969)
- Wickert, Lothar: Entstehung und Entwicklung des römischen Herrscherideals Berlin - Dahlem (1954)
[...]
1 Der Vorname ist laut DkP unsicher; häufig wird Publius angegeben.
2 Laut DkP ist der Vorname auch hierbei unsicher, möglicherweise Gaius.
3 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.1
4 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.1
5 Fini, Nero - 2000 Jahre Verleumdung, S.17
6 den Namen Nero erhielt er erst bei seiner Adoption von Claudius im Jahre 50
7 Tacitus, Annalen, Buch IV, Kap.75
8 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.5
9 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.5
10 Tacitus, Annalen, Buch I, Kap.35-36. Sueton, Caesarenleben, Tiberius, Kap.25,2. Cassius Dio, Buch 57, Kap.5,1
11 Gemeint ist Agrippina minor, die Mutter Neros.
12 Vergleiche Vandenberg, Nero - Kaiser und Gott, Künstler und Narr, S.34
13 Sueton, Caesarenleben, Caligula, Kap. 24
14 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap. 6,2
15 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap. 6,2
16 Vergleiche Fuhrmann, Seneca und Kaiser Nero, S.158
17 Vergleiche Fuhrmann, Seneca und Kaiser Nero, S.158
18 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.6,2
19 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.7,1. Tacitus, Annalen, Buch XI, Kap.11
20 Fuhrmann, Seneca und Kaiser Nero, S.158
21 Tacitus, Annalen, Buch XI, Kap.5-7
22 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.7,1. Tacitus, Annalen, Buch XII, Kap.8
23 Tacitus, Annalen, Buch XII, Kap.9
24 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.7,1. Tacitus, Annalen, Buch XII, Kap.25
25 Von hier an wird er auch im Text Nero genannt.
26 Tacitus, Annalen, Buch XII, Kap.26
27 Tacitus, Annalen, Buch XII, Kap.41
28 Tacitus, Annalen, Buch XII, Kap.58
29 Tacitus, Annalen, Buch XII, Kap.66
30 Tacitus, Annalen, Buch XII, Kap.67
31 Sueton, Caesarenleben, Claudius, Kap.45
32 Tacitus, Annalen, Buch XII, Kap.69. Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.8
33 Vergleiche: Fuhrmann, Seneca, S.175. Fini, Nero, S.47. Beide beziehen sich auf die Quelle Aurelius DeCaesaribus, Kap.5,2.
34 Vergleiche: Fini, Nero - 2000 Jahre Verleumdung, S.47
35 Vergleiche: Cassius Dio, Römische Geschichte, Buch 61, Kap.4,1-3
36 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.10
37 Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.4
38 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.10
39 Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.4
40 Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.50
41 Vergleiche: Fini, Nero - 2000 Jahre Verleumdung, S.50ff
42 Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.31-33
43 Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.34-41
44 Sueton, Caesarenleben, Nero, 18
45 Vergleiche: Furhmann, Seneca und Kaiser Nero, S.176
46 Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.12
47 Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.14
48 Massimo Fini und andere Autoren sehen hingegen in einem Aneurysma, einer häufigen Neben- erscheinung bei epileptischen Anfällen, den Grund für einen natülichen Tod des Britannicus. Aus den Quellen geht hervor, daß er Epileptiker war. Vergleiche hierzu: Fini, Nero - 2000 Jahre Verleumdung, S.119, Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.16, Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.33,2
49 Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.18, Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.34,1
50 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.34,1
51 Tacitus, Annalen, Buch XIII, Kap.20-21
52 Tacitus, Annalen, Buch XIV, Kap.1
53 Tacitus, Annalen, Buch XIV, Kap.7
54 Tacitus, Annalen, Buch XIV, Kap.3
55 Tacitus, Annalen, Buch XIV, Kap.4
56 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.34,2
57 Tacitus, Annalen, Buch XIV, Kap.5.
58 Tacitus, Annalen, Buch XIV, Kap.7
59 Tacitus, Annalen, Buch XIV, Kap.8
60 Tacitus, Annalen, Buch XIV, Kap.12-13
61 Tacitus, Annalen, Buch XV, Kap.38-43
62 Tacitus, Annalen, Buch XV, Kap.38
63 Cassius Dio, Römische Geschichte, Buch 62, Kap.16
64 Sueton, Caesarenleben, Nero, 38
65 Fini, Nero - 2000 Jahre Verleumdung, S.152 f.
66 Fini, Nero - 2000 Jahre Verleumdung, S.154
67 Tacitus, Annalen, Buch XIV, Kap.53
68 Tacitus, Annalen, Buch XV, Kap.59
69 Vergleiche: Vandenberg, Nero - Kaiser und Gott, Künstler und Narr, S.248
70 Vergleiche: Fuhrmann, Seneca und Kaiser Nero, S.316
71 Tacius, Annalen, Buch XV, Kap.73
72 Vergleiche: Fini: Nero - 2000 Jahre Verleumdung, S.202
73 Vergleiche: Fuhrmann, Seneca und Kaiser Nero, S.325
74 Vandenberg, Nero - Kaiser und Gott, Künstler und Narr S.308ff.
75 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.41
76 Plutarch, Große Griechen und Römer, Galba, Kap.5
77 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.42
78 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.43-44
79 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.47,1-2
80 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.48-49
81 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.50
82 Sueton, Caesarenleben, Nero, Kap.35
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument über Nero?
Dieses Dokument ist eine umfassende Analyse des Lebens und der Herrschaft von Kaiser Nero. Es untersucht seinen familiären Hintergrund, seine Jugend, den Einfluss seiner Mutter Agrippina, die politischen Ereignisse während seiner Herrschaft (wie den Brand von Rom und die Pisonische Verschwörung), sowie die Gründe für sein negatives Image in der Geschichte.
Welche Hauptquellen werden für die Analyse von Neros Leben verwendet?
Die wichtigsten Quellen für Neros Lebensbeschreibung sind P. Cornelius Tacitus, C. Suetonius Tranquillus und Cassius Dio.
Wer war Agrippina und welchen Einfluss hatte sie auf Nero?
Agrippina war Neros Mutter. Sie hatte großen Einfluss auf ihn und forcierte seine Kaisererhebung, um selbst Macht auszuüben. Das Dokument beleuchtet ihre Rolle bei der Beseitigung von Rivalen und der Festigung von Neros Position.
Was sind die "fünf goldenen Jahre" von Neros Herrschaft?
Die ersten fünf Regierungsjahre Neros werden oft als "fünf goldene Jahre" bezeichnet. Dies bezieht sich auf die Periode, in der Seneca und Burrus, Neros Berater, angeblich einen positiven Einfluss auf ihn ausübten und Rom zu Frieden und Wohlstand verhalfen.
Was war der Brand von Rom und war Nero dafür verantwortlich?
Der Brand von Rom war eine verheerende Katastrophe, die im Jahr 64 n. Chr. stattfand. Es gab Gerüchte, dass Nero den Brand legen ließ, um die Stadt zu verschönern und seinen Palast zu erweitern. Das Dokument untersucht diese Behauptungen und die möglichen Motive hinter ihnen.
Was war die Pisonische Verschwörung?
Die Pisonische Verschwörung war ein Komplott, angeführt von Gaius Calpurnius Piso, um Nero zu ermorden und ihn durch einen anderen Kaiser zu ersetzen. Die Verschwörung wurde aufgedeckt, was zu einer Reihe von Hinrichtungen und dem Tod von Seneca führte.
Wie endete Neros Herrschaft?
Neros Herrschaft endete mit einer Revolte, angeführt von Julius Vindex und Sulpicius Galba. Nero wurde vom Senat zum Staatsfeind erklärt und beging Selbstmord, um der Hinrichtung zu entgehen.
Welche Faktoren trugen zu Neros negativem Image bei?
Mehrere Faktoren trugen zu Neros negativem Image bei. Dazu gehören sein autoritäres Verhalten, seine angeblichen Verbrechen (wie der Mord an seiner Mutter), seine Vorliebe für künstlerische Aktivitäten, die von vielen Römern als unwürdig für einen Kaiser angesehen wurden, und die Christenverfolgungen während seiner Herrschaft.
Welche Quellen werden in der Bibliographie aufgeführt?
Die Bibliographie enthält eine Liste von Primär- und Sekundärquellen, die für die Analyse von Neros Leben und Herrschaft verwendet wurden. Dazu gehören Werke von Tacitus, Suetonius, Cassius Dio sowie moderne wissenschaftliche Arbeiten über Nero.
Was ist das Fazit der Analyse?
Das Fazit der Analyse argumentiert, dass Neros Bild in der Geschichte möglicherweise durch die Vorurteile antiker Autoren und frühchristlicher Schreiber verzerrt wurde. Es wird betont, dass Nero zwar Verbrechen begangen hat, er aber auch ein komplexer Charakter war, der in einer schwierigen politischen Situation agierte.
- Arbeit zitieren
- Alexander Paizanos (Autor:in), 2001, Das Prinzipat Neros - Ein Überblick, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107416