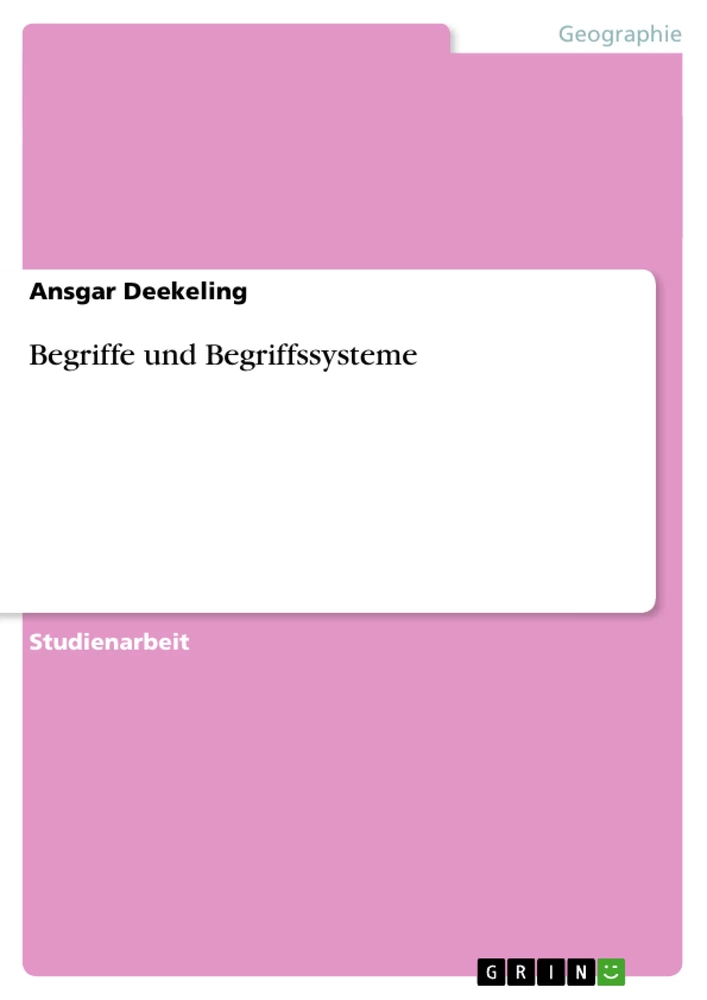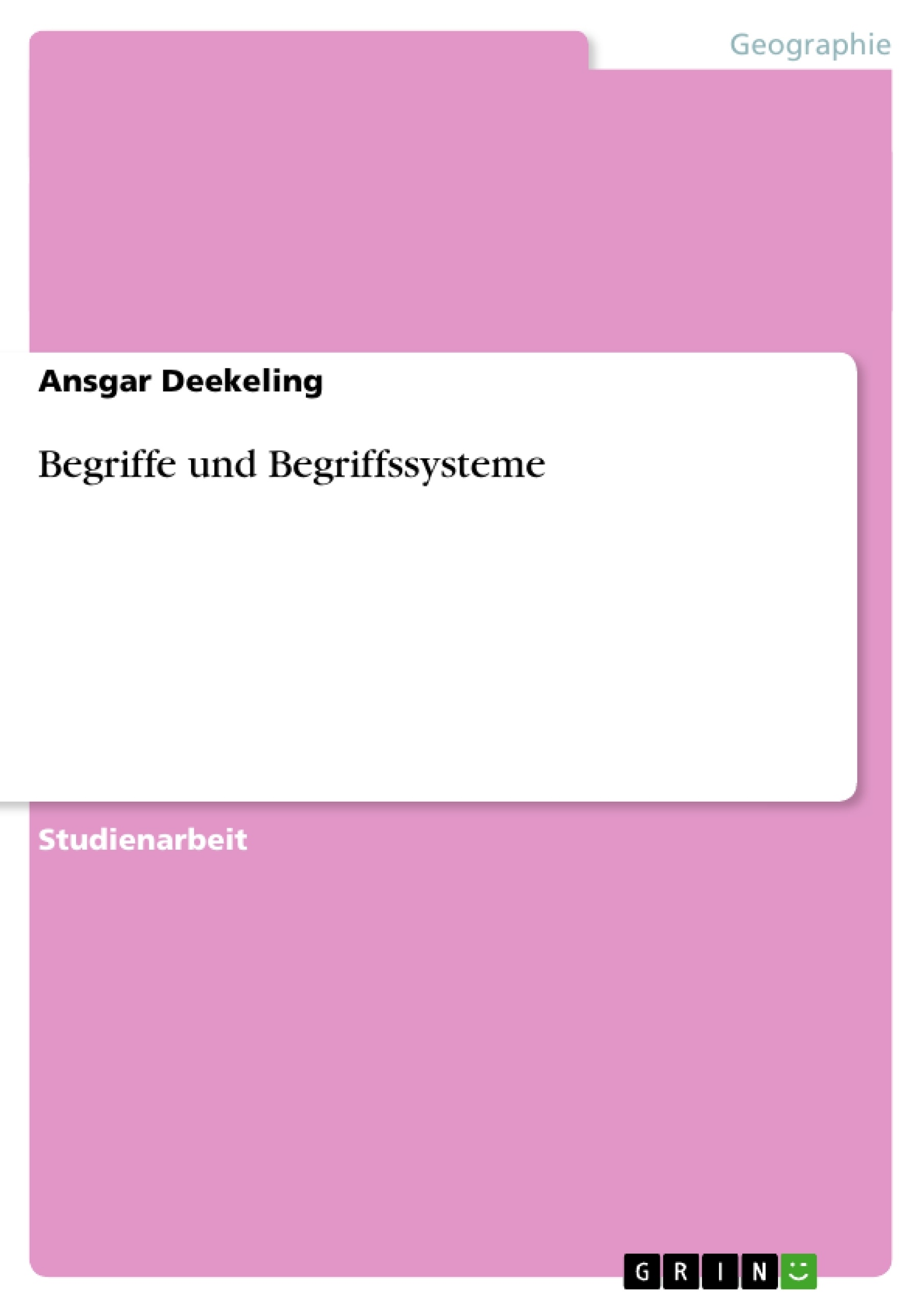Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Was ist ein Begriff ?
3. Die Bedeutung von Allgemein-, Basis- oder Grundbegriffen
3.1 Problematische Eigenschaften von Begriffen bzw. allgemeingeographischen Begriffen
4. Das Erlernen von Begriffen
4.1 Hierarchie von Begriffen
4.2 Möglichkeiten zum Erlernen von Begriffen
4.3 Die Verwendung von Begriffen im Unterricht
5. Geographische Begriffe in Schulbüchern-Probleme und Lösungsansätze
5.1 Die Darstellung von Begriffen in verschiedenen Schulbüchern der Sekundarstufe I
6. Eigener Unterrichtsentwurf für den zehnten Jahrgang Einführung des Begriffs „Treibhauseffekt“ in einer Doppelstunde
7. Literaturverzeichnis
Anhang
1. Einleitung
Das Thema der Arbeit lautet „Begriffe und Begriffssysteme im Geographieunterricht der Klassen 5-10 “. Der Autor wird dieses Thema schrittweise behandeln. Den Anfang bildet ein Kapitel, welches die Bedeutung von Begriffen im allgemeinen Sinne erläutert, d.h. unterschiedliche Positionen auch nichtgeographischer Herkunft dienen hierbei der Annäherung an das Thema. Diesem folgt ein Kapitel über die Bedeutung von Allgemeinbegriffen in der Geographie. Auch dabei gilt es, verschiedene Ansätze unterschiedlicher Geographen und Geographie-didaktiker miteinander in bezug zu setzen oder abzugrenzen. Im Abschlußteil beschäftigt sich der Verfasser mit den „Nachteilen“ von Begriffen und allgemeingeographischen Begriffen. Ein Begriff bezeichnet einen Sachverhalt, aber gleichfalls reduziert sich im Prozeß des „Sich einen Begriff von etwas machen“ die so erfaßte Wirklichkeit. Sie wird unter Umständen subjektiv, unvollständig oder nicht mehr überprüfbar.
An diesem Punkt knüpft der Autor im Kapitel „Hierarchie von Begriffen“ an. Begriffe werden immer eingebracht in Strukturen. Eine mögliche Struktur ist die Hierarchie; in diese ordnen wir einem komplexen Oberbegriff Unterbegriffe zu. Somit umfaßt ein Oberbegriff immer mehrere Unterbegriffe(Beispiel: Niederschlag-> Hagel, Regen, Schnee, Graupel...).
Das folgende Kapitel analysiert den Prozeß des Erlernens von Begriffen. Auf welchen Ebenen lernen wir Begriffe und wie muß begriffsbezogener Unterricht konzipiert sein ? Wiederum wird dabei der Verfasser auf die vorangegangenen Kapitel zurückgreifen, da die hierarchische Struktur gleichfalls wesentliches Element zum Erlernen und Lehren von Begriffen im Unterricht ist.
Daran anschließend soll eine kritische Betrachtung verschiedener Schulbücher Aufschluß über Möglichkeiten zur Gestaltung in Hinblick auf das Erlernen von Begriffen geben. Den Abschluß dieser Arbeit bildet ein Unterrichtsentwurf zum Begriff „Treibhauseffekt“.
2. Was ist ein Begriff ?
Im „Mackensen Deutsches Wörterbuch“ (11.Aufl. 1986) nennt der Verfasser (Dr. Lutz Mackensen) mehrere Bedeutungen des Wortes „Begriff“. Begriffe können als „Allgemeinvorstellung(Begriff von etwas haben)“ oder als „Ahnung“ und „Fassungsvermögen“ interpretiert werden. Begriffe geben zudem den „Gedanken-, Bedeutungsgehalt“ eines Wortes wieder. Unter „Begriffsbestimmung“ definiert der Autor eine „klare Umschreibung und Definition“. Des weiteren wird „Begriffsbildung“ als „Zuordnung von Begriff und Sache“ definiert(Mackensen 1986, S. 137).
Der Autor nennt wichtige Voraussetzungen, die ein Begriff erfüllen muß, setzt diese aber leider nicht in den ausreichenden Zusammenhang. Um welche Begriffe handelt es sich und wie stehen diese Begriffe zueinander? Beruhen Begriffe auf Erfahrung oder müssen wir diese als nicht empirische Voraussetzung anerkennen ? Hier erfolgt ein kurzer Abschnitt über Verständnismöglichkeiten von Begriffen und deren Bildung. „Denn die Struktur der Begriffe, die Über-Empirisches nur analog darstellen, weist deutlich auf ihren tatsächlichen Ursprung aus der Erfahrung... . Erstbegriffe(ursprüngliche Begriffe) werden an Hand äußerer oder innerer Erfahrungsgegebenheiten gewonnenZweitbegriffe(abgeleitete Begriffe) erarbeiten wir in bewußten diskursivem Denken, indem wir aus mehreren, wie immer vorher gewonnenen Begriffen das ihnen Gemeinsame durch Vergleich und Relationserfassung herausheben und es ohne das Unterscheidene darstellen, oder es-bei analogen Begriffen..teilweise verneinen.“(Brugger, W.(Hrsg.)1992, S. 42)
Unsere Vorstellung vom Wesen der Begriffe scheint nicht so selbstverständlich wie es uns so häufig vorkommt. Wir legen den Ursprung unserer Begriffswelt nicht zufällig in den Schoß der gemachten Erfahrungen und sehen darin die einzig mögliche Variante des Verständnisses unserer Umwelt. Brugger beschreibt sehr genau das klassische Verständnis von Begriffen als eine im Menschen schon vorgezeichnete, nur zu erweckende Begabung. In Abgrenzung dazu sieht er das „moderne „ Verständnis in der Erlernbarkeit durch Erfahrung und Auseinandersetzung mit der Umwelt und der Welt unserer Sprache und Sprachen. Das dies natürlich Folgen für das Erlernen von Begriffen in schulischen Situationen hat, darf man hierbei voraussetzen. Die Erziehung und damit Heranbildung des Menschen korrespondiert somit zwangsläufig auch mit der zu entwickelden Fähigkeit, die begrifflichen Ordnungen zu „begreifen“. „Nicht irrationalistische Geringwertung des begrifflichen Denkens zugunsten verschwommener Phraseologien, sondern Erziehung zur Klarheit begrifflichen Erfassens objektiver Wahrheit ist darum Aufgabe der Menschformung.“(Brugger 1992, S. 43)
Der so formulierte aufklärerische Gedanke klingt sehr idealistisch in seiner Forderung. Der Geographieunterricht und mit diesem das Erlernen von Begrifflichkeiten bedeutet im engen Sinne nichts anderes als die Fähigkeit zum Diskurs mit der Umwelt., die uns durch die Medien sekundär in Form von Sprache entgegentritt. Das Instrument zur kritischen Auseinandersetzung ist das Wissen um die Bedeutung von Begriffen (selbstverständlich auch die Fähigkeit zur Erweiterung des Wissens und deren Methodik). Josef Birkenhauer erweitert und bestätigt die Bedeutung des Erlernens von Begriffen und insbesondere die Aufgabe der Didaktik in diesem Bereich. „Begriffe als didaktischesAufgabenfeld zu nennen, scheint eng mit dem Prinzip der Wissenschaftsorientierung verbunden, geradezu eine Konsequenz aus diesem Prinzip zu sein. Tatsächlich ist dieses Prinzip(d.h. die Wissenschaftsorientierung) nichts als ein Resultat von Überlegungen, auf welchen Wegen Mündigkeit erreicht werden kann.“ (Birkenhauer 1996, S. 2) Zudem weist Birkenauer auf das Verhältnis von Begriffen und Wissenschaftsorientierung hin, betont dabei ausdrücklich die Anforderung an die Didaktik, aus dem schier unendlichem Wissensfeld zu reduzieren und geeignete Methoden des Lernens zu entwickeln. Wissen sei nicht bloße Information, sondern müsse dem Denken des Menschen unterworfen sein. Er müsse den Sinn der Worte durchdringen lernen, d.h. nicht die reine Aufnahme, vielmehr die Weiterverarbeitung stehe in diesen Lernprozessen im Vordergrund.[1]
In einem älteren Aufsatz aus dem Jahre 1980 definiert Gudrun Ringel sehr präzise die Eigenschaften von Begriffen und betont besonders deren grundlegende Bedeutung für den Geographieunterricht.
„Ein Begriff ist die gedankliche Widerspiegelung einer Klasse von Objekten oder von Klassen auf der Grundlage ihrer Merkmale. Unter wesentlichen Merkmalen verstehen wir diejenigen invarianten Merkmale, die unter bestimmter Zwecksetzung(Erfüllung der Lehrplanziele) und unter Berücksichtigung der didaktischen Vereinfachung ausgewählt wurden.“(Ringel 1980, S.422)
„Die Gesamtheit der wesentlichen Merkmale spiegelt den Begriffsinhalt wider. ...Der Begriffsumfang - die Extension - gibt an, welche der Objekte der Klasse angehören, die durch den Begriff abgebildet werden.“(z.B. zur Extension des Begriffs Hafen gehören alle Häfen der Welt) (Ringel 1980, S.422)
Begriffe sind strukturiert, sie repräsentieren einen Objektbereich durch Zuweisung bestimmter relevanter und damit prägender Merkmale(z.B. der Begriff Säugetier in Abgrenzung zur Begriffsklasse Insekt). Die Didaktik vereinfacht durch Reduktion, darf aber keinesfalls den Begriffsinhalt und den Begriffsumfang verzerren oder leugnen. Ringel betont die Relevanz von Begriffen und deren richtige, bzw. zweckmäßige Verwendung im Geographieunterricht in der Einleitung eines neueren Aufsatzes. „Zu den wesentlichen Elementen jeden Erdkundeunterrichts gehören die geographischen Begriffe. Dabei stellen sich dem Lehrer zwei grundlegende Fragen: -Welche Begriffe sollen Schüler wann lernen ? -Wie sollen diese Begriffe verwendet werden ?“ (Ringel 1997, S. 40) Ringel nimmt in ihrem Aufsatz von 1997 eine weitere Differenzierung von Begriffen vor. Sie unterteilt diese nach ihrer „Bedeutung“ und unterscheidet als Ansatz Grundbegriffe von „anderen Begriffen“.(Ringel 1997, S. 40)
Diese Grundbegriffe sind nun die Begriffe, ...die systematisch im Unterricht eingeführt werden müssen und die die Schüler sicher beherrschen sollen.“(Ringel 1997, S.40) Was dürfen wir uns unter solchen „Grundbegriffen“ vorstellen und welchen Stellenwert haben sie ? Durchaus problematisch ist auch die Frage nach der Auswahl solcher Grundbegriffe ?
Diese Fragen bilden nun den Ausgangspunkt für das folgende Kapitel.
3. Die Bedeutung von Allgemein- , Basis- oder Grundbegriffen
„Allgemeinbegriffe sind Begriffe, mit deren Hilfe man sich...eine ganze Klasse gleichartiger Objekte oder Erscheinungen vorstellt, die sich einer gemeinsamen Kategorie unterordnen lassen (Fluß, Klima). ...In der Definition eines Allgemeinbegriffs sind die wesentlichen Merkmale enthalten, die zu dem jeweiligen Begriff gehören.“ (Stroppe, Werner 1980, S.290)
Stroppe unterscheidet von den Allgemeinbegriffen die „Individualbegriffe“. Nach seiner Auffassung handelt es sich bei diesen um „..Begriffe von bestimmten Objekten oder Erscheinungen, die einen geographischen Eigennamen tragen.“ (Stroppe 1980, S.290) Ein Beispiel für einen Individualbegriff wäre die Hansestadt Bremen. Allgemein-begriffe(Grundbegriffe) sind somit die entscheidenen Begriffe für den Unterricht, da allein durch sie eine Ordnungsfunktion(dazu ausführlicher in den Kapiteln Hierarchie von Begriffen und Das Erlernen von Begriffen) eintritt. Dies betont Hartmut Leser auch besonders für die Geographie und den Geographieunterricht. „Nur sie (allgemeingeographischen Begriffe) lassen eine theoretisch begründete Ordnung und Systematik zu, und streng genommen wird nur mit ihnen in den geographischen Theorien gearbeitet... .“ (Leser 1986, S.26) Leser beschränkt jedoch die Menge allgemeingeographischer Begriffe, indem er diesen ein spezifisches Charakteristikum zuschreibt.
„Allgemeingeographische Begriffe im streng theoretischen Sinne können nur jene Begriffe sein, die in allen geographischen Teildisziplinen Verwendung finden und von denen sich die teildisziplinären allgemeingeographischen Begriffe, also die der Einzelgeographien, ableiten.“ (Leser 1986, S.279)
Eine Beschränkung findet durch dieses Vorgehen statt. Die Frage nach der Auswahl und der Gewichtung geographischer Begriffe im Unterricht bleibt jedoch weiterhin(ähnlich bei Ringel 1997) offen. Leser betont jedoch auffallend, daß es sich bei allgemeingeographischen Begriffen um „Basis- oder Ausgangsbegriffe“ handelt (Leser 1986, S.27), diese ihrem Wesen nach zwangsläufig im Erdkundeunterricht wiederzufinden sein müssen. Gleichsam charakterisiert Leser geographische Basisbegriffe als „Raum-bzw. Raumstrukturbegriffe“ und betont deren hierarchische Struktur.(Leser 1986, S.27) Dieter Böhn formuliert diesen Ansatz noch deutlicher aus und präzisiert diesen sehr „extrem“.
„Ein Grundbegriff ist dabei eine axiomatisch festgelegte abstrakte Bezeichnung, die in einem System zur Definition weiterer Begriffe verwendet wird.“(Böhn 1999, S.16) Kritisch sollte hier angemerkt werden, daß Sprache sich wandelt und ebenso der Kontext ihrer Verwendung variiert. Begriffsinhalte und Begriffsumfänge verändern sich. Theoretische Konzepte werden widerlegt und/oder modifiziert. Die von Hartmut Leser betonte „theoretisch begründete Ordnung und Systematik“, welche nur allgemeingeographische Begriffe erlauben, erhält dadurch ein wenig bitteren Beigeschmack. Selbst die Bedeutung allgemeinster Begriffe kann sich ändern, erweitern oder sogar ins Gegenteil drehen. Sicherlich sind Allgemein-, Basis oder Grundbegriffe wesentlich im Unterricht. Der Lehrer muß dabei jedoch die Methodik der Begriffsbildung „mitservieren“. Da der Schüler die Gewichtung und „Entwichtung“ theoretischer Konzepte kennenlernt, z.B. der Verlauf von der Idee der Industriegesellschaft zur Idee der Informationsgesellschaft; auch hier darf die kritische Untersuchung der tragenden Vokabeln nicht fehlen. Aus diesem Grund gehört die Reflektion zu erlernder Begriffe und Begriffssysteme in den Unterrichts.
3.1 Problematische Eigenschaften von Begriffen bzw. allgemeingeographischen Begriffen
„Begriffsbildung bedeutet Einordnung in Klassen und Kategorien. Dadurch wird zwar eine Verständigung untereinander möglich, es geht aber gleichzeitig Information verloren...“(Hantschel 1986, S.33) Wir erleben und kennen unsere Begriffe nur aus den Kontexten aus denen wir sie schöpfen. Diese Kontexte können der reale Lebensumstand, Theorien oder sonstige Informationsquellen sein(z.B Medien, TV, Literatur, Internet...) Je abstrakter und komplexer Begriffe sind, umso schwieriger wird es, ihren Wahrheitsgehalt, ihre logische Richtigkeit zu überprüfen. Der Begriff „Zentralität“ aus der Geographie ist beispielsweise ein sehr komplex-abstrakter Begriff. Erst durch gezieltes methodisches Wissen über seinen theoretischen und geschichtlichen Hintergrund gelingt partiell die Überprüfung des Begriffs am „Objekt“(Fallbeispiel). Die Überprüfung von komplexen und abstrakten Begriffen an der Realität ist zumindest für den Schüler kaum möglich. Die Weiterentwicklung und damit der Fortschritt der Wissenschaften entpuppt sich ebenfalls als Schwierigkeit. Begriffe modifizieren ihre Bedeutung und sind dadurch zeitlich bedingt. Hantschel drückt dies sehr treffend aus.
„Sowohl sich verändernde Fragestellungen und Weltbilder als auch Forschungsmethoden und -verfahren wirken sich darauf aus, welcher Ausschnitt aus der Realität betrachtet und wie er in Begriffe gefaßt und dargestellt wird.“(Hantschel 1986, S.33)
Die zeitliche Bedingtheit von Begriffen muß also Bestandteil des Unterrichts sein. Was bedeuetet Zentralität im Mittelalter, in der Neuzeit und in der Moderne mit ihren Datenautobahnen(Kommunikation) und schnelleren Transporttechniken. Der Lehrer bzw. die Lehrerin müssen in der Lage sein, solche Zusammenhänge den Schüler anhand begrifflicher Entwicklungen zu spannen, so daß die Lernenden diese erkennen und selbst die Fähigkeit zur Suche nach solchen Bedingtheiten entwickeln. Begriffe zeigen immer nur einen Ausschnitt einer Idee, von Realität oder das, was wir dafür halten. Ihre Zuordnung wird dadurch wesentlich erschwert. Auch hier muß der Unterricht so gestaltet sein, daß die Grenzen und Hürden begrifflicher Definitionen deutlich werden. Hantschel drückt diesen Gedanken sehr genau aus. Man sollte Begriffe danach als „...symbolische Repräsentation einer reduzierten Vorstellung...“ deuten.
Das „Erlernen von Begriffen“ ist der Schwerpunkt des folgenden Kapitels. Der Autor wird in diesem Kapitel Möglichkeiten des Erlernens von Begriffen und Ansätze der Fachdidaktik diskutieren.
4. Das Erlernen von Begriffen
4.1 Hierachie von Begriffen
Die Hierarchie von Begriffen als System zur Einordnung ist ein wesentliches Element des Unterrichts. Doch was verstehen wir genau darunter. Hartmut Leser definiert diesen Hierarchiebegriff wie folgt: „Dieser(der Hierarchiebegriff [2] ) drückt eine vertikales Zuordnungsgefüge innerhalb bestimmter Raumsysteme bzw. damit korrespondierender Begriffssysteme aus, und zwar so, daß die betreffenden systemzugehörigen Sachverhalte hierarchieaufwärts zunehmend komplexer werden.“(Leser 1986, S.30)
Küste
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Begriffssysteme zur Küste(Ringel 1997, S.41)
Das oben abgebildete Schaubild stellt ein typisches Schulbeispiel dar. Die Lernenden erkennen sehr schön, wie sich die einzelnen Küstenausprägungen unter dem Oberbegriff Küste zusammenfassen lassen.
Leser betont, daß es bei geographischen Basisbegriffen um „Raum- bzw. Raumstrukturbegriffe“(Leser 1986, S. 27) handele. Ordne ich solche Begriffe in ein hierarchisches System, so erhalte ich ein „vertikales Zuordnungsgefüge“ innerhalb meines „Raumsystems“. Durch Verknüpfung erreiche ich immer höhere Grade von Komplexität und unter Umständen von Genauigkeit. Der Psychologe Gerd Mietzel[3] untersuchte die hierarchische Struktur von Begriffen auf ihre Bedeutung für das menschliche Lernen. „Nachdem man das Wahrgenommene als Beispiel für einen bekannten Begriff klassifiziert hat, lassen sich weitere Informationen erschließen. Dies ist möglich, weil die im Gedächtnis gespeicherten Begriffe miteinander in Beziehung stehen.“(Mietzel 1994, S. 206) Mietzel führt diesen Gedanken noch weiter aus. „Durch diese Anordnung ist es einem Menschen möglich, Merkmale eines Begriffs zu erschließen, die gar nicht unmittelbar mit diesem in Verbindung stehen.“(Mietzel 1994, S. 207) Die Unterrichtsinhalte sollten gleichfalls nach Altersstufen der Schüler und Schulform differenziert Begriffe einführen und für den Lernenden verständlich in Begriffssysteme verorten(vgl. Abb. I). Mit zunehmenden Alter und damit korresspondierender gesteigeter kognitiver Fähigkeiten steigert sich auch die Komplexität der Begriffe(vgl 4.2). Ersetze ich in diesem Sinne das Wort „Verknüpfung“ in Lesers Definition[4] von Hierarchie durch das Wort „Transferwissen“, so entwickelt der Schüler angeleitet durch den Lehrer die Kompetenz, zunächst teilselbstständig, später selbstständig komplexe Begriffsysteme zu begreifen.
4.2 Möglichkeiten zum Erlernen von Begriffen
Auf welchen Ebenen lernen wir Begriffe und wie läßt sich ein solches Wissen für den Unterricht an Schulen verwerten.
Tabelle 1: Ebenen und Operationen beim Begriffserwerb( nach Arbinger 1980)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Hantschel, R. 1986: Fachmethodologische Prinzipien. In: Köck, H. (Hrsg): Handbuch des Geographieunterrichts. Bd.1. Grundlagen des Geographieunterrichts. München. S. 91
Arbinger (Tab.1) unterscheidet vier zunehmend komplexere Ebenen und Operationen beim Begriffserwerb. Dadurch steigen mit jeder Ebene auch die Ansprüche an den Lernenden, wobei durch dessen Heranbildung kognitiver Fähigkeiten(z.B. mit zunehmenden Alter) diese sich relativieren. Hantschel betont in bezug auf Arbingers Ansatz zwei zu beachtende Sachverhalte. „Begriffe müssen auf jeder Ebene neu gelernt werden. ...zu jedem Begriff ein Bedeutungsfeld gehört, das in bestimmte Dimensionen gegliedert werden kann.“(Hantschel 1986, S.91
Abbildung II: Begriffslernen beim Thema „Steigungsregen“, aus: Haubrich; H. u.a.(Hrsg.) 1997. Didaktik der Geographie . Konkret. München.
Einen ähnlichen Zugang zum Begriffserwerb formuliert Kaminske(Abb. II)[5] in seinem Beispiel aus der Physischen Geographie. Gleich Arbinger werden die Ebenen zunehmend komlexer. Der feine Unterschied besteht in der Ausgestaltung des Lernprozesses. In den Jahrgangsstufen 5/6 sind Einzelbegriffe Gegenstand des Unterrichts und werden (wie in jedem folgenden Jahrgang) wahrnehmungsnah bis theorienah bearbeitet. Die Steigerung wird durch die Erweiterung des „Geltungsbereiches“ (Dimension) der Begriffe erreicht. Sind es in den Unterstufen überwiegend Einzelbegriffe, steigert sich die Anforderung über „Erweiterte Begriffe“ bis zu den „Allgemeinen Begriffen“. Deutlich wird durch eine solche Konstruktion, daß Kaminske die hierarchische Struktur von Begriffen als System des Erlernens verwendet. Mit jeder erreichten Jahrgangsstufe wird es dem Schüler so möglich, aufgebautes „Begriffswissen“ in Strukturen einzuordnen. Ringels 1980 verfaßter Aufsatz „Begriffe im Geographieunterricht und ihre Einführung“ enthält dazu eine sehr gelungene schematische Darstellung.
Abbildung III: Schematische Darstellung der Abfolge der Phasen bei der Einführung von Begriffen, aus: Ringel, G. 1980: Begriffe im Geographieunterricht und ihre Einführung. In: Zeitschrift für den Erdkundeunterricht, 32 Jg.,H. 11, S.425.
Ringel stuft den Ablauf in sieben Hauptphasen und einigen Nebenphasen(variieren je nach Anzahl der zu untersuchenden Objekte und des gewählten Zugangs) ab. Die erste Phase dient der Benennung des Objektes bzw. mehrerer Objekte anhand eines Oberbegriffs. Die zweite Phase unterteilt Ringel in drei mögliche „Wege“. Diese dienen dem „Vertrautmachen mit der Abbildungsart“(Photo, Zeichnung...). Dabei unterscheidet Ringel nur die Anzahl der zu untersuchenden Objekte. Die dritte Phase sieht die „Herausarbeitung von Merkmalen unter bestimmten Gesichtspunkten“ vor. Entscheidend dabei ist, ob ein Objekt oder mehrere Objekte untersucht werden. Untersucht die Schulklasse mehr als ein Objekt, so arbeitet diese gemeinsame Merkmale heraus. Dieser Schritt ist vergleichbar mit der Klassifikationsebene bei Arbinger. „Man kennt das Merkmal, das für die Gemeinsamkeit relevant ist, und verwendet es für die Klassifikation;...“(Arbinger 1980, in: Hantschel 1986, S.91) Ringel stellt die gemeinsamen dann mit den wesentlichen Merkmalen gleich. Zu betonen gilt hier, daß die Herausarbeitung von Merkmalen einer gezielten Aufgabenstellung bedarf. Das Herausheben der wesentlichen Merkmale eines Objektes bezeichnet die vierte Phase(vgl. Arbinger-Formale Ebene). Ringel kennzeichnet diesen Vorgang als Abstraktion. Problematisch ist dabei die Rolle des Lehrers; dieser übernimmt bei nur einem zu bearbeitenden Objekt vollständig die Herausarbeitung der wesentlichen Merkmale. Diese Lehrerzentrierung scheint unangemessen und läßt sich wahrscheinlich nur durch das Alter des Aufsatzes erklären. Da es sich bei der Einführung von Begriffen um teilweise sehr formalen Stoff handelt, müssen Materialien und Lernsituation möglichst handlungsorientiert ausgestaltet sein. Das passive Aufnehmen gestellter Formulierungen in lehrerzentrierten Arbeitschritten entspricht diesem nicht im geringsten.
Die vierte Phase wird ergänzt durch eine Nebenphase, in welcher durch Wiederholung das Erarbeitete gefestigt wird. In der fünften Phase folgt die Definition, d.h. die Zuschreibung der wesentlichen Merkmale an das Objekt oder die Klasse von Objekten(denn diese Merkmale sind immer gültig für eine Klasse von Objekten). Dieser Phase folgt die „Einordnung ins Begriffssystem“(Ringel 1980, S.427). Dabei unterstreicht Ringel besonders die Grenzen solcher Systeme. Es handle sich immer um „Begriffsteilsysteme“(Ringel 1980, S.427). Auch hierbei muß immer die Bezugsebene angegeben und für den Schüler ersichtlich sein. Ansonsten drohe die Gefahr der Vermengung von Begriffen unterschiedlicher Teilsysteme. Die siebte Phase beendet das Schema. Ein anderes Objekt der gleichen Klasse wird ausgewählt und das Erlernte angewendet.(wesentliche Merkmale erkennen und der erlernten Klasse(System) zuordnen.
4.3 Die Verwendung von Begriffen im Unterricht
Welche Voraussetzungen müssen Lehrende schaffen, um Begriffe möglichst nachhaltig und effektiv den Schülern beizubringen ? Birkenhauer unterscheidet sieben Grundsätze für die Verwendung von Begriffen im Unterricht in seinem 1995 publizierten Aufsatz „Sprache und Begriffe als Barrieren im Erdkundeunterricht“[6].
1. Es ist generell eine Sensibilisierung der Lehrer für ihre Aufgabe als Übersetzer notwendig.
2. Sprache und Begriffe müssen so nah wie möglich an konkreten Phänomen bleiben.
3. Verstehen Schüler einen Begriff nicht, eliminieren sie ihn sofort(und zu recht).
4. Die spezifische Fachsprache ist so gering wie möglich zu halten. Begriffe sind dosiert einzuführen und zu verwenden.
5. Diese dosierten Begriffe sind durch alle Jahrgangsstufen hindurch immer wieder zu verwenden(damit sie vertraut bleiben und damit selbstverständlicher werden).
6. Einsichten sind als einfach gestaltete Regeln zu formulieren(zum Beispiel nach der „Wernn-dann“-Struktur).
7. Volle sprachliche und begriffliche Kompetenz kann erst ab der 11. Jahrgangsstufe erwartet werden.
Die Lehrenden sollten nach Birkenhauer dieses „Handwerkzeug“ bei der Gestaltung des Unterrichts beherzigen (angemessenes Sprachniveau, gezielter(reduzierter) Einsatz von Begriffen, die Formulierung prägnanter Merksätze und die Wiederholung gelernter Begriffe zur Ergebnissicherung). Dieter Böhn unterstreicht die Forderung Birkenhauers an die Unterrichtsgestaltung, aber er weitet sie durch eigene Vorschläge noch aus. Böhn betont die Notwendigkeit „emotionaler Nähe“ bei der Einführung neuer Begriffe, da dieses das Interesse des Schülers wecke. Begriffe sollten unbedingt an konkreten Beispielen, möglichst widerspruchsfrei erarbeitet und in ihrer Bedeutung hervorgehoben werden.(Böhn 1999, S.16-17)
Dieter Böhn faßt dies sehr anschaulich zusammen. „Ein Begriff müsse in seinen Merkmalen an einem konkreten Beispiel induktiv erarbeitet werden, dann sei er als vereinfachende intersubjektive Bezeichnung eines komplexen Sachverhalts einzuführen.“(Böhn 1999, S.17)
Ringel betont neben diesen Faktoren die Notwendigkeit der „Systematisierung“ von Begriffen.(Ringel 1980, S.423)
„Dieser Gedanke der Systematisierung von Begriffen ist bei der Begriffsbildung besonders zu beachten, da das regionalgeographische Vorgehen in den Klassen 5 bis 8 dazu führt, daß eine Reihe von Begriffen ..., die zu einem Begriffssystem gehören, zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingeführt wird.“(Ringel 1980, S.423) Ringel kritisiert in diesem Sinnen die fehlende Systematik im Unterricht(besonders in Form von Begriffshierarchien). Volker Kaminske betont insbesondere die Bedeutung der Heranbildung eines ordnenden Grundwissens. Er stützt sich dabei auf Ergebnisse der Lernpsychologie, welche das Grundwissen als unabdingbare Voraussetzung jeglicher Lernprozesse bewerte[7]. „Dabei ist...klar zu entnehmen, daß es nur dann zu dauerhaften Lernergebnissen kommen kann, wenn der Lernstoff in schon bestehende Wissensfelder eingebaut bzw. damit assoziiert wird und somit zusätzlich neue Begriffe mit den schon bekannten einen... Zusammenhang schaffen können.“ (Kaminske 1994, S.21) Die Darstellung der notwendigen didaktischen Ausgestaltung des Unterrichts in bezug auf die Einführung von Begriffen und deren systematische Verankerung führt dazu, die weiterführende Frage zu stellen. Wie sind die Schulbücher ausgearbeitet, um solchen Ansprüchen zu genügen? Das folgende Kapitel beinhaltet eine kurze Diskussion verschiedener Didaktiker/innen. Dem fügt der Verfasser eine eigene kleine kritische Untersuchung über verschiedene Schulbücher der Sekundarstufe I (unterschiedliche Schulformen) an.
5. Geographische Begriffe in Schulbüchern-Probleme und Lösungsansätze
Die Ausgestaltung geographischer Lernmittel und hierbei insbesondere Erdkundebücher weisen in bezug auf das Erlernen von Begriffen typische Problemlagen auf. Da Lehrer sich häufig vollkommen auf die ihnen zugewiesenen Lehrbücher verlassen, kommt diesen eine Schlüsselrolle zu.(Ringel 1997, S.40)[8] „Untersuchungen zeigen, dass die Darstellungen in Schulbüchern die Aneignung von Begriffen wesentlich beeinflussen.“(Ringel 1997, S.40)
Ringel unterscheidet in ihrem 1997 publizierten Aufsatz „Geographische Begriffe in Schulbüchern“ drei Hauptprobleme der Ausgestaltung.
1. Es erfolgt keine oder eine nicht immer nachvollziehbare Hervorhebung wichtiger Begriffe.
2. Es werden zu viele unbekannte Begriffe verwendet, die im Lehrbuch überhaupt nicht, nur unzureichend oder erst in folgenden Kapiteln geklärt werden.
3. Die richtige Einordnung der Begriffe in hierarchisch aufgebaute Begriffssysteme wird nicht genügend beachtet.(Ringel 1997, S. 40-41)
Die Gewichtung und Auswahl von Begriffen in Schulbüchern sind nach Kaminske ein weiters Problem von „Begriffslernen“. Welche Begriffe sind wichtig und wieviele Begriffe können Schüler sinnvoll in einem bestimmten Zeitumfang überhaupt lernen ? Kaminske untersuchte verschiedene Schulbücher nach den Kriterien Häufigkeit und Analogie von Fachbegriffen.
Tabelle 2: Häufigkeiten von Grundbegriffen in Schulbücher der Klassen 5-8
Begriffshäufigkeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Kaminske, V. 1994: Begriffslisten als Rahmen für ein Grundwissen- wichtig oder nicht ? S.22.(leicht verändert)
Die untersuchten Schulbücher stammen aus dem Bundesland
Baden-Württemberg. Die Anzahl der Begriffe variieren zwischen den verschiedenen Büchern enorm. Darüber hinaus variieren die Zahlen auch bei den Schulbüchern verschiedener Jahrgänge einer Reihe. Die extremsten Abweichungen finden sich beim Vergleich in bezug auf die gemeinsamen Grundbegriffe. Setzt man die „Gemeinsamkeiten“ in Relation zur Gesamtzahl aller drei Bücher, so erschrecken die Ergebnisse noch deutlicher. Für die fünfte wären nicht einmal ganze 6%, für die sechste nicht ganze 7%, für die siebente gerade 7% und für die achte Klasse nur 6% aller verwendeten Begriffe gleich. Kaminske beurteilt die Ergebnisse seiner Untersuchung sehr kritisch. „Das bedeutet, auch den Schulbuchautoren fehlt eine Vorstellung darüber, wieviele und welche Fachbegriffe sie welchen Schülern zumuten können.“(Kaminske 1994, S. 22-23)[9]
Josef Birkenhauer kommt in seiner 1982 in Bayern durchgeführten Untersuchung zu ähnlichen Ergebnissen und bewertet diese entsprechend.
„Weder sind die Begriffe in dieser Anzahl zumutbar, noch sind sie im Sinne von Hentings vermittelbar. Sie werten sich wegen der großen Zahl zudem gegenseitig abAuch der im Fach ausgebildete Lehrer weiß angesichts solcher Fülle keine Antwort. Er wird vielmehr nach Gutdünken häufig eine subjektive Wahl treffen.“(Birkenhauer 1996, S.3) Die Lösungsansätze, die die hier genannten Autoren anbieten sind vielfältig. Ringel unterscheidet sechs „...bestimmte Klassen von Begriffen, je nach den Gegenständen oder Sachverhalten, die sie benennen.“(Birkenhauer 1996, S.8) Dadurch erhält Ringel schon eine gewisse Auswahl im Gegenstandsbereich(z.B. die Klasse geographischer Darstellungsformen). Das Problem der Gewichtung und damit Auswahl bestimmter Begriffe bleibt jedoch bestehen. Dieses Problem versucht Ringel, durch die Bildung von Hierarchieebenen zu lösen. Wiederum unterteilt sie die Begriffe in drei Klassen(Ebenen). Die erste Ebene bilden die grundlegenden, die zweite die wichtigen und die dritte die weiteren Begriffe. (Birkenhauer 1996, S.9) Anhand dieses Systems erstellt nun Ringel Begriffslisten. Birkenhauer kritisiert dieses Vorgehen, da für ihn die Zuordnung zu den verschiedenen Ebenen unlogisch sei. Als Beispiel nennt er den Begriff Vulkanismus, den Ringel der zweiten Ebene zuweise. Gleichzeitig sortiere sie aber die Begriffe Magmatismus und Plutonismus in die dritte Ebene ein, obwohl diese „inhaltlich vergleichbare Begriffe“ seien.(Birkenhauer 1996, S.9) Kaminske wählt demgegenüber einen anderen Ansatz. Er erstellt thematische „Begriffslisten und Beziehungslisten“. (Kaminske 1994, S.24) Nach Jahrgangsstufen unterteilt werden auf einer Seite Begriffe aufgelistet. Ergänzend dazu sind diesen Begriffen Beziehungen gegenübergestellt. Ein Beispiel für den siebten Jahrgang ist der Begriff Einstrahlwinkel. Diesem wird als Beziehung „Vom Einstrahlwinkel abhängige Wärmeentwicklung“ zugesellt. Dadurch erhält der Benutzer einer solchen Liste den konkreten inhaltlichen Rahmen zur Einführung bestimmter Begriffe. Abgestimmt mit den jeweiligen Richtlinien können Begriffs-mit Beziehungslisten den entsprechenden Orientierungsrahmen für Lehrer und Schulbuchautoren abgeben. Das Problem der inhaltlichen Gewichtung von Begriffen bleibt aber wiederum bestehen.(Kaminske 1994, S.24-25)
5.1 Die Darstellung von Begriffen in verschiedenen Schulbüchern der Sekundarstufe I
Tabelle 3: Vergleich der didaktischen Ausgestaltung verschiedener Schulbücher
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die untersuchten Schulbücher stammen alle aus dem Bundesland NRW. Die Schulbücher sind nur in bezug auf die Darstellung von Begriffen analysiert. Alle Schulbücher weisen zur Heraushebung bedeutender Begriffe den Fettdruck auf. Die Schulbuchautoren verwenden unterschiedliche Methoden, um die wichtigen „Grundbegriffe zu erläutern. In unteren Klassen überwiegen häufig Erklärungen in Form einfacher Zeichnungen oder Abbildungen. Infokästen listen Grundbegriffe nochmals auf und beinhalten kurze Erläuterungen, bzw. Definitionen(Geographie Mensch Raum 1997). Weitaus effektiver erscheinen demgegenüber Minilexika zur schnellen Orientierung durch Definitionen, welche leider nur in zwei Schulbüchern aufzufinden sind(vgl. Tab.3 Nr. 2,5). Die Erläuterung von Grundbegriffen im Text ist immer notwendig, jedoch nicht ausreichend, wenn Schüler in Wiederholungs- oder Lernphasen diese Begriffe schnell nachschlagen müssen. Das Auffinden durch Seitenangaben in Registern vereinfacht diese Suche,, doch bleibt das Auffinden der Definition im Text als Schwierigkeit erhalten. Der Autor beurteilt in diesem Sinne die „Zweigleisigkeit“ von Text- und Bilderläuterung in den jeweiligen Kapiteln und Abdruck schülergerechter Minilexika als bestmögliche Voraussetzung für den Lernerfolg.
6. Eigener Unterrichtsentwurf für den zehnten Jahrgang
Einführung des Begriffs „Treibhauseffekt“ in einer Doppelstunde
Das Thema der Stunde lautet „Der Treibhauseffekt“, ein Begriff der durch die Presse geht und den jeder Schüler schon einmal gehört haben dürfte. Es dürften auch die Folgen hinlänglich bekannt sein, doch was ist mit den Ursachen?
Die Unterrichtsstunde beginnt mit Material I(siehe Anhang). Abgebildet sind eine Reihe von Überschriften aus Zeitungen und Magazinen, in denen aber der Begriff „Treibhauseffekt“ nicht genannt wird. Die Schüler sollen nun anhand der abgedruckten Überschriften neugierig „rätseln“, um welches Problem es sich handeln könnte. Mit der Nennung des Begriffs läutet der Lehrende die nächste Phase ein. Die Lernenden bekommen einen Text ausgehändigt(M II, siehe Anhang)und sollen diesen lesen. Hinzu kommen zwei Leitfragen , die beantwortet werden müssen:
1. Wie funktioniert ein Treibhaus und was ist der natürliche Treibhauseffekt ?
2. Welche Folgen hat der zusätzliche Treibhauseffekt ?
Aufgabe: Lesen Sie den Text und beantworten Sie die gestellten Fragen stichwortartig .
Die Schüler erhalten 15-20 Minuten Zeit, um die Aufgabe zu erledigen. Im Anschluß daran werden die Aufgaben vorgetragen und besprochen.
Der zweite Teil der Doppelstunde beginnt mit der Verteilung von
Material III(Anhang) über die Ursachen/Verursacher des zusätzlichen Treibhauseffektes. Die Abbildung zeigt vereinfacht ein Glasdach als Atmosphäre, unter welchem sich eine Reihe von Bildern befinden (unterteilt in vier Blöcke). Die Schüler sollen im Plenum jeden dieser Blöcke beschreiben und daraus ableitend die jeweiligen Ursachen bzw. Verursacher benennen. Beispielsweise würde der erste Block (von links ausgehend) die Abholzung der Wälder als eine Ursache ausweisen.
Gemeinsam mit den Schülern entwirft der Lehrerende zur Ergebnissicherung ein zusammenfassendes Tafelbild.
Tafelbild: Ursachen und Verursacher des zusätzlichen Treibhauseffektes
Industrie und FCKW
Vernichtung des Waldes Industrieverbrennungen
Verursacher des zusätzlichen
Treibhauseffektes
Landwirtschaft sonstiges
PKW private Haushalte
(hoher Energieverbrauch)
Schüler und Lehrer haben nun gemeinsam die Ursachen und Verursacher des weltweit zu beobachtenden Treibhauseffektes vereinfacht aus den gegebenen Materialien herausgearbeitet. Der Lehrer/in leitet jetzt in eine weitere Phase über, welche mit dem Material M4(s. Anhang) ausgestattet wird. Diese Phase dient der Sensibilisierung des Schülers für dieses Thema im eigenem Lebensumfeld. Die Lernenden erkennen anhand von M4 „Energiebewußtsein im Haushalt“ ein Haus mit fünf Zimmern. Jedes Zimmer ist ausgestattet und wird unterschiedlich genutzt. Auffallend ist jedoch die verschwenderische Art der Nutzung der Gegenstände. So sitzt beispielsweise ein arbeitender Mensch in einem der Zimmer am Schreibtisch, hinter ihm läuft der Fernseher und das gut geheizte Zimmer wird gleichzeitig durch ein geöffnetes Fenster abgekühlt. Indem die Lernenden schrittweise jedes Zimmer untersuchen entdecken sie eine Vielzahl von Einsparmöglichkeiten an Energie. Gemeinsam mit den Schülern faßt der Lehrer diese Möglichkeiten des Einsparens an der Tafel zusammen, so daß diese von den Schülern in ihr Heft übertragen werden. Die Schüler sollen anhand dieses Hauses die Handlungsmöglichkeiten erkennen, die die eigene Umwelt bieten. Das globale Klimaproblem „Treibhauseffekt“, welches stark durch die Verschwendung von Energieressourcen gefördert wird, erhält eine kleine private Option. Das eigene Energiesparen tritt dieser Entwicklung in dem Maße entgegen, in dem die Schüler im kleinen Maßstab umdenken und bewußter mit Energie haushalten. Der komplexe Begriff „Treibhauseffekt“ wird nicht nur abstrakt verstanden und systematisch verortet, sondern handlungsorientiert ausgearbeitet.
7. Literaturverzeichnis
Baehde, A. 1995: Zur Festigung von Begriffe im Erdkundeunterricht. In: Erdkundeunterricht H.4, S. 182-184.
Birkenhauer, J. 1996: Begriffe im Erdkundeunterricht. In: Geographie und ihre Didaktik, 24. Jg.H. 1, S. 1-15.
Birkenhauer, J. 1995: Sprache und Begriffe als Barrieren im Erdkundeunterricht. In: Erdkundeunterricht. H. 11, S.458-462.
Böhn, Dieter(Hrsg.) 1999: Didaktik der Geographie Begriffe. München.
Brugger, W.1992: Philosophisches Wörterbuch. 21 Aufl. Freiburg.
Hantschel, R. 1986: Fachmethodologische Prinzipien. In: Köck, H.(Hrsg.) : Handbuch des Geographieunterrichts. Bd. 1. Grundlagen des Geographie-unterrichts. München, S.31-35.
Kaminske, V. 1994: Begriffslisten als Rahmen für ein Grundwissen-wichtig oder nicht ? In: Geographie und ihre Didaktik, 22 Jg.,H.1, S. 20-26.
Kirchberg, G. 1997: Begrifflernen. In: Haubrich, H.; u.a.(Hrsg): Didaktik der Begriffe konkret. München, S.58-59.
Kromrey, H. 1991: Empirische Sozialforschung. 5. Aufl.. Opladen.
Mackensen, L. 1986: Deutsches Wörterbuch. 11.Aufl. München
Mietzel, G. 1994: Wege in die Psychologie. 7.Aufl. Stuttgart.
Leser, H. 1986: das geographische Begriffssystem. In: Köck, H. (Hrsg.) Handbuch des Geographieunterrichts. Bd. 1. Grundlagen des Geographie-unterrichts. München. S.27-31.
Ringel, G. 1980: Begriffe im Geographieunterricht und ihre Einführung. In: Zeitschrift für den Erdkundeunterricht, 32. Jg., H.11, S.421-434.
Ringel, G. 1997: Geographische Begriffe in Schulbüchern. In: geographie heute, 18. Jg.,H. 153, s.40-41.
Stroppe, W. 1980: Die Begriffsbildung. In: Kreutzer, G.(Hrsg): Didaktik des Geographieunterrichts. Hannover, S.290.
[...]
[1] vgl.: Birkenhauer 1996, S.3 ff
[2] Verweis vom Autor selbst eingefügt
[3] vgl. dazu auch Kap. 6. Psychologie des Gedächtnisses. in: Mietzel G. 1994: Wege in die Psychologie. 7.Aufl. Stuttgart.
[4] Leser folgt in seiner Gedankenstruktur weitesgehend dem Ansatz K..R. Poppers -Kritischer Rationalismus vgl. dazu Kromrey, H. 1991: Empirische Sozialforschung. 5.Aufl. Opladen.(hier besonders Kapitel 1.3.1 und 1.3.2)
[5] aus: Haubrich , H.; u.a.(Hrsg.) 1997: Didaktik der Geographie konkret. München. S.58.
[6] Birkenhauer , J. 1995: Sprache und Begriffe als Barrieren im Erdkundeunterricht. Zu einigen Untersuchungsbefunden an geographischen Beispielen. In: Erdkundeunterricht, H. 11, S.458-462.
[7] siehe dazu bei 3
[8] vgl. dazu auch die Ausführungen von V. Kaminske 1994, hier besonders S.23ff
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Begriffe und Begriffssysteme im Geographieunterricht der Klassen 5-10"
Was ist ein Begriff laut diesem Text?
Laut dem "Mackensen Deutsches Wörterbuch" kann ein Begriff eine "Allgemeinvorstellung", eine "Ahnung", "Fassungsvermögen" oder den "Gedanken-, Bedeutungsgehalt" eines Wortes wiedergeben. Eine Begriffsbestimmung ist eine "klare Umschreibung und Definition", und Begriffsbildung ist die "Zuordnung von Begriff und Sache".
Was sind Allgemein-, Basis- oder Grundbegriffe in der Geographie?
Allgemeinbegriffe sind Begriffe, mit deren Hilfe man sich eine ganze Klasse gleichartiger Objekte oder Erscheinungen vorstellt, die sich einer gemeinsamen Kategorie unterordnen lassen (z.B. Fluss, Klima). Sie enthalten die wesentlichen Merkmale, die zu dem jeweiligen Begriff gehören. Hartmut Leser betont, dass allgemeingeographische Begriffe eine theoretisch begründete Ordnung und Systematik ermöglichen und als Basis- oder Ausgangsbegriffe im Erdkundeunterricht unerlässlich sind.
Welche problematischen Eigenschaften haben Begriffe?
Begriffsbildung bedeutet Einordnung in Klassen und Kategorien, wodurch zwar Verständigung möglich wird, aber gleichzeitig Information verloren geht. Begriffe können abstrakt und komplex sein, wodurch ihre Überprüfung erschwert wird. Ihre Bedeutung kann sich im Laufe der Zeit verändern und ist somit zeitlich bedingt. Begriffe zeigen immer nur einen Ausschnitt der Realität.
Wie kann man Begriffe im Unterricht effektiv erlernen?
Der Text beschreibt verschiedene Ebenen und Operationen beim Begriffserwerb, wie sie Arbinger darstellt. Begriffe sollten auf jeder Ebene neu gelernt werden, und zu jedem Begriff gehört ein Bedeutungsfeld. Die hierarchische Struktur von Begriffen ist ein wesentliches Element, um Wissen in Strukturen einzuordnen. Es werden außerdem konkrete Beispiele zur Veranschaulichung des Lernprozesses gegeben, z.B. "Steigungsregen". Ringel stuft den Ablauf in sieben Hauptphasen bei der Einführung von Begriffen ein.
Welche Grundsätze gibt es für die Verwendung von Begriffen im Unterricht?
Birkenhauer nennt sieben Grundsätze: Sensibilisierung der Lehrer als Übersetzer, Nähe zu konkreten Phänomenen, Vermeidung unnötiger Fachsprache, dosierte Einführung und Verwendung von Begriffen, wiederholte Verwendung über Jahrgangsstufen hinweg, einfache Formulierung von Einsichten und die Erkenntnis, dass volle sprachliche Kompetenz erst ab der 11. Jahrgangsstufe erwartet werden kann. Böhn betont die Notwendigkeit "emotionaler Nähe" und die Erarbeitung an konkreten Beispielen.
Welche Probleme gibt es bei der Darstellung von Begriffen in Schulbüchern?
Ringel nennt drei Hauptprobleme: keine oder nicht nachvollziehbare Hervorhebung wichtiger Begriffe, zu viele unbekannte Begriffe ohne ausreichende Klärung und unzureichende Beachtung der Einordnung in hierarchische Begriffssysteme. Kaminske bemängelt die fehlende Vorstellung der Schulbuchautoren, wie viele und welche Fachbegriffe den Schülern zugemutet werden können, basierend auf der Analyse der Häufigkeit von Grundbegriffen in Schulbüchern.
Welchen Unterrichtsentwurf zur Einführung des Begriffs "Treibhauseffekt" wird vorgeschlagen?
Der Unterrichtsentwurf beginnt mit der Neugier der Schüler, die Überschriften lesen, ohne den Begriff "Treibhauseffekt" zu kennen. Anschließend wird ein Text gelesen mit Leitfragen. Danach werden die Ursachen und Verursacher mit Bildern des Treibhauseffekts behandelt, um schliesslich Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Energiebewusstsein im Haushalt wird anhand eines Hauses diskutiert, so dass die Lernenden Energiesparmöglichkeiten entdecken.
- Quote paper
- Ansgar Deekeling (Author), 2003, Begriffe und Begriffssysteme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107620