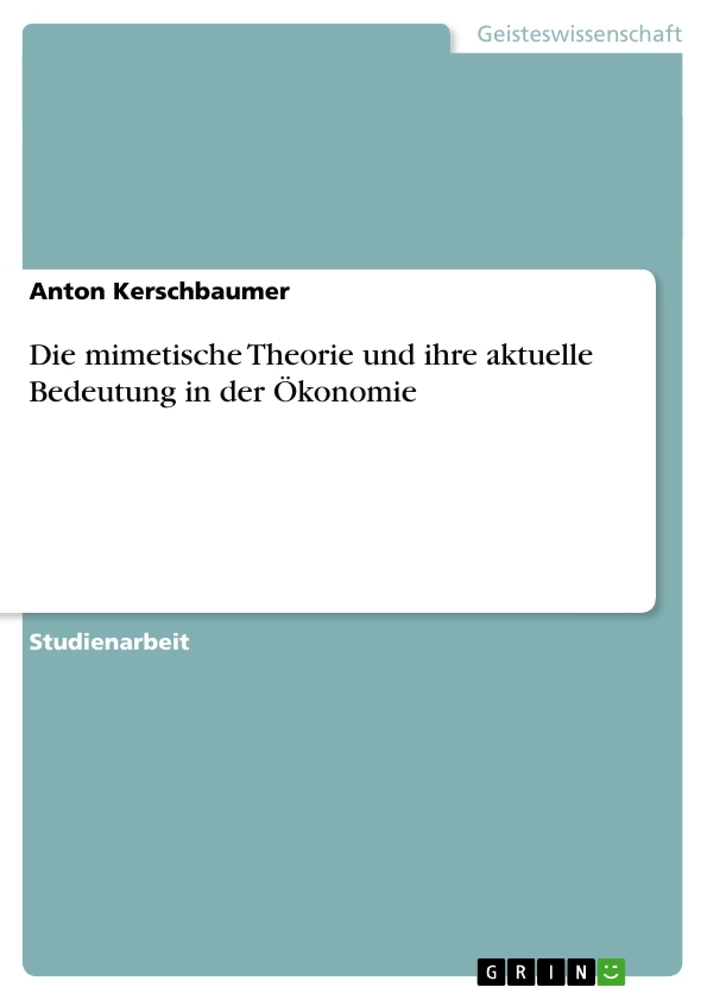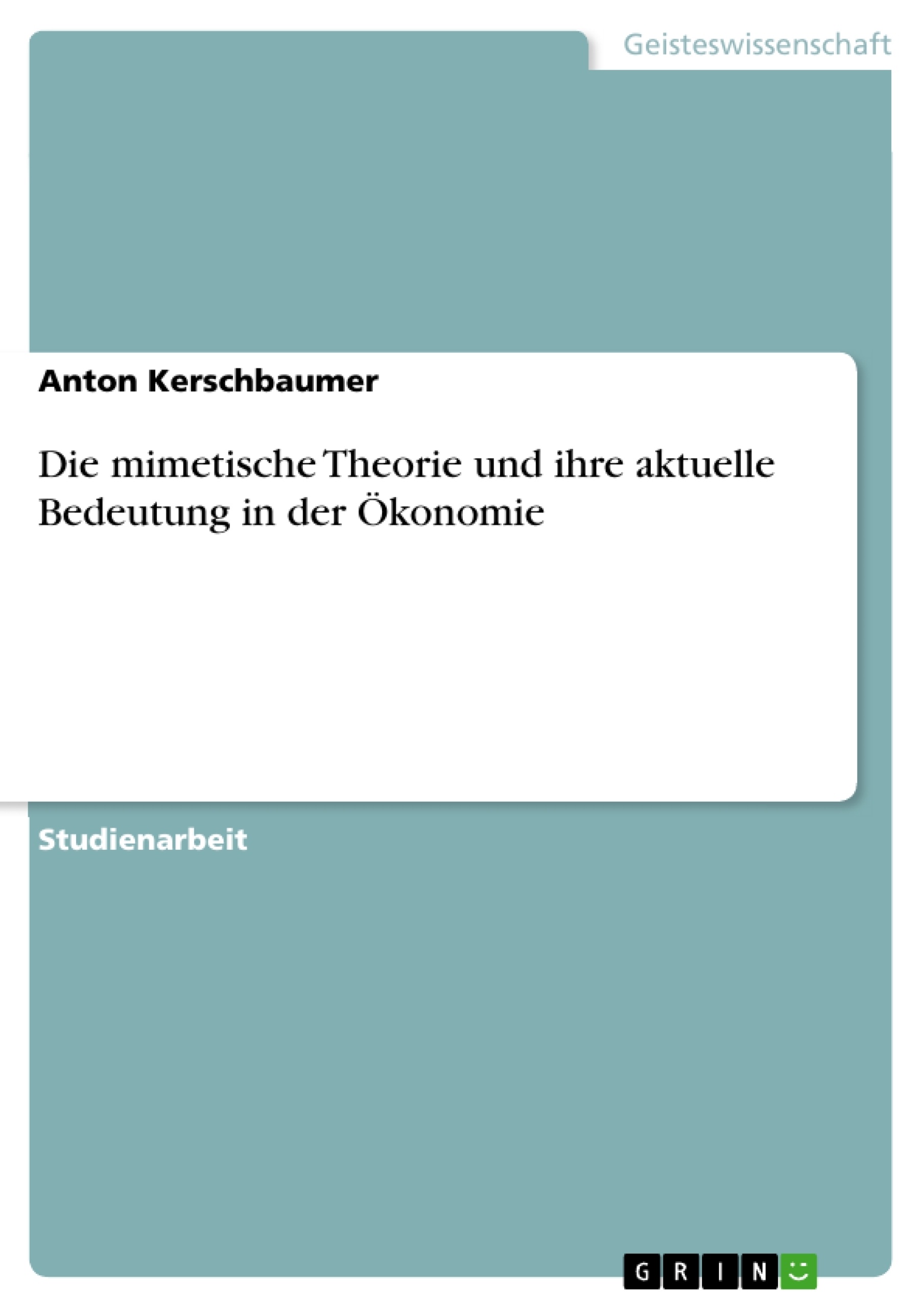Stellen Sie sich vor, die Weltwirtschaft wäre ein gigantischer Spiegel, in dem wir nicht unsere eigenen Bedürfnisse, sondern die der anderen reflektiert sehen. Was, wenn unser Streben nach Erfolg, unser Konsumverhalten und sogar unsere tiefsten Wünsche nicht authentisch, sondern das Ergebnis einer unbewussten Nachahmung sind? Dieses Buch enthüllt die verborgenen Mechanismen der "mimetischen Theorie", die unser wirtschaftliches Handeln und unsere sozialen Beziehungen grundlegend prägen. Anhand von Beispielen aus der Weltliteratur, von Stendhal bis zu modernen Wirtschaftstheorien, wird aufgedeckt, wie Neid, Rivalität und das Streben nach Autonomie uns in eine "mimetische Hölle" führen können, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Die Analyse der Armenkrise während der industriellen Revolution Englands zeigt auf erschreckende Weise, wie Wirtschaftswachstum die Ungleichheit verschärfen und zu sozialer Ausgrenzung führen kann. Doch die mimetische Theorie bietet nicht nur eine düstere Diagnose: Sie eröffnet auch neue Perspektiven auf das Börsengeschehen, die Finanzmärkte und die Möglichkeit, durch ein tieferes Verständnis unserer eigenen Motivationen und der Dynamik sozialer Interaktion, einen Ausweg aus dem Teufelskreis der Nachahmung zu finden. Dieses Werk ist eine provokante und tiefgründige Auseinandersetzung mit den Triebkräften des Kapitalismus, die uns dazu anregt, unsere eigenen Werte und Ziele kritisch zu hinterfragen und nach Wegen zu suchen, eine gerechtere und nachhaltigere Wirtschaft zu gestalten. Es analysiert die Rolle von Mimesis, Neid und Begehren in der modernen Gesellschaft und bietet einen neuen Blickwinkel auf Themen wie soziale Ungleichheit, Konsumverhalten und die Dynamik der Finanzmärkte. Eine fesselnde Lektüre für alle, die verstehen wollen, wie unsere Wünsche und unser Handeln von den unsichtbaren Fäden der Nachahmung beeinflusst werden und wie wir uns aus den Fängen der "mimetischen Hölle" befreien können. Entdecken Sie die revolutionäre Kraft der mimetischen Theorie und gewinnen Sie neue Einsichten in die komplexen Zusammenhänge von Wirtschaft, Gesellschaft und menschlichem Verhalten. Ein Muss für Wirtschaftswissenschaftler, Soziologen, Philosophen und alle, die sich für die tieferen Ursachen unserer wirtschaftlichen und sozialen Probleme interessieren.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Vorwort
Das Lesen des Buches „Die Hölle der Dinge“ war im Gegensatz zur subjektiven Einschätzung einer Kollegin, die es als leicht verständlich beschrieb, für mich keine eine einfache Aufgabe. Ich musste mehrere Passagen mehrmals lesen und durfte meine Konzentration nicht abschweifen lassen, um vieles was darin beschrieben wird zu verstehen.
Das zeigt wiederum wie unterschiedlich subjektive Wahrnehmen, subjektives Begreifen sind und wie sehr die Wahrnehmung von den kognitiven Strukturen des Lesers abhängt.[1]
Doch muss ich hinzufügen, dass mich das Werk sehr interessierte, da es eine von den betriebswirtschaftlichen Ansätzen abweichende Analyse des Handelns der Subjekte im Wirtschaftsleben bietet. Deshalb war es der Mühe Wert dieses soziologische Wert doch durchzukämmen und nicht wie die letzten beiden soziologischen Bücher von Bourdieu und Habermas, die ich mir vornahm zu lesen, nach kurzem Versuch etwas zu verstehen beiseite zu legen.
2. Gang der Arbeit
Nach einer Einleitung möchte ich die Grundaussagen des Buches zur mimetischen Theorie möglichst kurz zusammenfassen und mit persönlichen Statements ergänzen.
Danach möchte ich mein Augenmerk auf den Begriff der Mimetische Hölle und der Möglichkeit dieser zu entkommen richten.
Das nächste Kapitel ist dann Geschichten aus den Romanen, die Girard zur Erklärung der mimetischen Theorie heranzieht, gewidmet. Durch praktische literarische Beispiele kann man, so glaube ich, am besten Zugang zur Relevanz dieser Theorie finden.
Daran anschließend möchte ich noch kurz über Armenprobleme zu Beginn der Industrialisierung und deren nicht ganz gelungene Lösung zu sprechen kommen. Der nachfolgende Teil ist dem Verhältnis von Mimetischer Theorie und Börse gewidmet, einen Bereich auf den meines Erachtens die mimetische Theorie sehr gut angewandt werden kann.
Zum Abschluss will ich in einem Resümee die Erkenntnisse meiner Arbeit zusammenfassen.
3. Einleitung
Beginnen möchte ich meine Arbeit mit einer Definition von MIMESIS, einem zentralen Begriff dieses Aufsatzes. Mimesis hat laut Duden drei ähnlich Bedeutungen. Die erste Definition bringt den aus dem Griechischen stammenden Begriff mit nachahmender Darstellung der Natur im Bereich der Kunst in Verbindung. Der zweite Definitionsvorschlag beschreibt Mimesis als spottende Rede, die in einer überzeichneten Art eine andere Person nachahmt (antike Rhetorik). Zum Schluss wird Mimesis auch noch mit der unterschiedlichen den Umweltbedingungen angepassten Schutztracht der Tiere in Beziehung gesetzt.[2]
Aus allen diesen Definitionen geht hervor, dass es sich bei der Mimesis um nachahmendes, nachäffendes Verhalten handelt, das sowohl in der Kunst, der Rede und bei Tieren angewandt wird. Der Mensch ist wie viele anderen Lebewesen sehr stark von Nachahmung geprägt. Das Baby lernt vieles durch Nachahmen, wie Sprache, Gestik, Mimik usw. Dem Hinweis, dass diese grundsätzlich positive Eigenschaft des Menschen, die unser Überleben in der und den Bestand der Gemeinschaft sichert, auch mit Problemen versehen ist, soll ein Hauptteil meiner Arbeit gewidmet sein.
Wir leben heute in einem von freier Marktwirtschaft geprägten Wirtschaftssystem, in dem die Gegensätze zwischen arm und reich beständig größer werden, die Natur vermehrt ausgebeutet wird und dies geschieht, obwohl eigentlich gestiegene Produktivität und Effizienz eine entgegengesetzte Entwicklung erwarten ließen. Das Vermögen der reichen Bevölkerungsgruppen wächst, während die ärmeren Schichten mit einem immer kleineren Anteil vorlieb nehmen müssen. Mit den neuen Technologien werden auch viele Arbeitskräfte, die sich von schlecht bezahlten Jobs ernähren, überflüssig und somit arbeitslos.
Die gegenwärtige Krise des Kapitalismus ist keine Krise der Leistungsfähigkeit des kapitalistischen Systems. Durch die Ausrichtung auf den maximalen Profit jedes einzelnen gelingt es auch meist die Gesamtwirtschaftsleistung zu steigern, jedoch geschieht dies zulasten des sozialen Ausgleichs und der Umwelt. Diejenigen die sich im System bewähren, also zu den Gewinnern zählen profitieren von der immer größer werdenden Anzahl an Verlierern. Doch wie lange kann das anhalten? Wie lange werde es sich die Verlierer noch gefallen lassen? Diese Frage ist schwer zu beantworten, wie alles was in die Zukunft reicht, Spekulation ist. Jedoch ist zu bemerken, dass ein Zunehmen von Ungleichheiten und eine Verschlimmerung der Situation der Globalisierungsverlierer auf die Dauer den Gewinnern dieses Systems nicht egal sein kann, da eine friedliche Koexistenz aller nur unter lebenswürdigen Bedingungen für alle längerfristig vorstellbar ist.
4. Mimesis und Wirtschaft
Was hat die heutige Ökonomie mit der mimetischen Theorie zu tun? Inwieweit lassen sich Parallelen erkennen. Zu diesem Zweck habe ich das Buch „Die Hölle der Dinge“ von Paul Dumouchel und Jean-Pierre Dupuy herangezogen und darin einige überzeugende Erklärungen der aktuellen Vorgänge in der Wirtschaft gefunden.
In modernen Gesellschaften sind Eigenschaften wie Neid, Eifersucht, Gier, Ehrgeiz nicht nur nicht verpönt, sondern sogar erwünscht. Diese Eigenschaften sorgen für Wirtschaftswachstum und fleißiges Arbeiten der Bevölkerung. In primitiven Gemeinschaft war das anders, da galten diese Eigenschaften als äußert gefährlich für den Zusammenhalt der Gemeinschaft und durften nicht überhand nehmen. Warum ist das so? Wieso führen diese Eigenschaften heute zu keiner Eskalation der Gewalt?
Die Marktwirtschaft kanalisiert die Gewalt dieser in primitiven Gemeinschaften so gefährlichen Leidenschaften. Die mimetische Gewalt entlädt sich in einem unbegrenzten Aneignungs- und Verbrauchsprozess über das Medium des Geldes. Die mimetische Energie wird in Produktion und Konsum gelenkt. Die Gewalt verschwindet aber nicht, sie bleibt im Markt und häuft sich an.[3] Dies funktioniert so lange gut, so lange die Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht eskalieren und es zu keinem Ausschluss vieler kommt. Das Problem ist ja vor allem auch, dass sich die Ausgestoßenen, die Ungebildeten, die Ausländer, Kranke nicht gegenseitig unterstützen, sondern es auch zwischen ihnen zu verheerenden Rivalitäten kommt.
a) Mimesis als Triebkraft der Wirtschaft
Es geht bei der Mimesis nicht um die Frage: Gesehen oder nicht gesehen werden? Entscheidend ist vielmehr die Frage: Sehen oder gesehen werden? Es geht dabei um zwei Blicke. Zuerst geht der Blick vom Subjekt zum Anderen; dann vom Anderen zum Subjekt. Der wirklich entscheidende Blick ist der zweite, derjenige der zum Subjekt wandert. Das Begehren, das in diesem zweiten Blick liegt, begründet den ersten, dieser Blick sichert dem Objekt Erfüllung.[4]
Dafür, dass sich in dem Blick der Anderen eine Mischung aus Bewunderung und Hass zeigt, dafür opfert das Subjekt wichtige Momente seines Wohlbefindens, wie die Verfügung über seine Zeit und seinen Geist. Das Verhalten ist hier nur im Sinne der zwischenmenschlichen Beziehungen erklärbar. Beneiden kann man keine Sache sondern nur jemand anderen, eine andere Person.
Interessant ist hierzu auch die gleichartige Wortherkunft der umgangssprachlich so gegensätzlich verstandenen Wörter invidia, invidere, das heißt, jemanden mit Misstrauen beobachten, boshaft beäugen und invitare, das heißt rivalisieren, kämpfen, herausfordern, einladen.[5] Invidious hat auch im Englischen eine doppelte Bedeutung: - „der beneidet“ und „der Neid auslöst“. Dazu passt auch ein Zitat von Fontenelle: „Jeder strahlt im falschen Glanz in den Augen des anderen; jeder wird beneidet während er selbst beneidet.“ [6]
Neid wird von Menschen aber nur sehr ungern zugegeben, da es sich ja dabei praktisch um ein Zugeständnis der eigenen Minderwertigkeit handelt. Man hat es in unserer konkurrenzorientierten Marktwirtschaft nicht geschafft sich durchzusetzen und wird nun von den anderen nicht beachtet und nicht bewundert.
Es wird heute nicht der Beneidete zu einem Fest genötigt, an dem er seinen Überschuss der Gemeinschaft opfert, damit das Gleichgewicht wieder hergestellt ist. Nein, in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem hat jeder die Chance sich selbst mit seinen eigenen Fähigkeiten durchzukämpfen und vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Vom Neider zum Beneideten, dieser Weg steht im Kapitalismus jedem Tüchtigen und Fleißigen offen. Doch ist das wirklich so? Und ist man dabei autonom?
b) Sehen Schizophrene die Realität deutlicher?
Bei der Mimesis handelt es sich um eine doppelte Beziehung zum Anderen, zum Vorbild. Einerseits bewundert das Subjekt den Anderen, andererseits hasst es ihn, da es ihm selbst nicht gelungen ist das Beneidenswerte zu erreichen, das der andere geschafft hat. Das Subjekt hat eine Hass-Liebe zum Anderen, die der gespaltenen Persönlichkeit eines Schizophrenen ähnelt, der diese Realität oft viel klarer wahrnimmt.
Das Ich ist gespalten in ein narzistisches, solipsistisches und ein schwaches, zentrifugales Ich. Das narzistische Ich ist nötig für die Wirkmacht der Zeichen (Objekte der Begierde), das zentrifugale Ich für die Wirkmacht des Neides.[7]
5. Die mimetische Hölle
Dieser double bind[8] des mimetischen Begehrens ergibt einen unlösbaren Widerspruch. Je mehr ich dem Gesetz entkommen will, desto mehr versklavt es mich, und je mehr ich zu seinem Sklaven werde, desto mehr versuche ich seinem Gesetz zu entkommen.
In der mimetischen Theorie ist das Begehren ein Begehren gemäß dem Begehren des anderen. Es kommt darauf an, was der andere begehrt. Die Dinge und Sachen die der andere begehrenswert findet, will man auch selbst haben.
Alle versuchen der mimetischen Hölle zu entkommen. Dies soll gelingen indem man das begehrt, was von den Anderen besessen oder begehrt wird, weil die anderen sich an etwas erfreuen, was man selbst am meisten auf dieser Welt haben möchte, und das ist Autonomie.[9] Es will einfach niemand einsehen, dass der Mensch als Beziehungswesen nicht autonom sein kann. Bis auf wenige Einsiedler, die sich an der Natur und ihr Leben in der Einöde oder im Wald erfreuen und sich dabei selbst erhalten, sind die Menschen aufeinander angewiesen. Diejenigen die am lautesten schreien: „Ich bin autonom.“ – sind es nicht, sie brauchen jemanden der ihnen zuhört.
Die mimetische Hölle ergibt sich daraus, dass niemand diesem Nachahmungskreislauf entkommen kann. Die Rivalen sind Doppelgänger, die sich gegenseitig nachahmen und versuchen sich irgendwie zu übertrumpfen. Dabei bleiben Dritte die nicht mitmachen können auf der Strecke und werden mit Gleichgültigkeit bestraft. Diese Gleichgültigkeit in Bezug auf die auf der Strecke gebliebenen ist ein Ergebnis des mimetischen Begehrens. Nicht Knappheit ist verantwortlich für das Entstehen dieser Dritten sondern der Kampf der Doppelgänger (Rivalen, die sich immer ähnlicher werden, da sie dasselbe begehren), der unweigerlich auch zu Ausgestoßenen führt. Ganz problematisch ist es, wenn sich die Ausgestoßenen wiederum als Doppelgänger bekämpfen und nicht in solidarischem Verhalten gegenseitig ihre Not lindern.
6. Auszüge aus Romanen der Weltliteratur über mimetische Beziehungen und deren Entwicklung
Rene Girard führt in seinen Werken, welche die Grundlage der mimetischen Theorie bilden, viele Geschichten aus Werken der Weltliteratur an, die das mimetische Begehren beinhalten.
Auch der Kölner Literat Dieter Wellershoff ist der Überzeugung, dass die Bücher von literarischen Romanschriftstellern im Laufe ihres Schriftstellerlebens einen Metatext hervorbringen, der ihre fortschreitende und sich wiederholende Auseinandersetzung mit der Welt widerspiegelt. Es sind also in allen Romanen in gewissem Maß autobiographische Züge enthalten.[10] Diese autobiographischen Züge sowie die große Bedeutung der Mimesis in den Romanen zeigen die praktische Relevanz der Analyse.
Ich möchte mich nun auf zwei Romanausschnitte beschränken, die den Einfluss der Mimesis auf persönliches Handeln im Leben zeigen.
Zuallererst möchte ich die Dreiecksgeschichte Rot und Schwarz von Stendhal schildern. Die Hauptpersonen sind der Bürgermeister Renâl, der bürgerliche Edelmann Valenod und Julien, der Dorflehrer. Renâl nimmt Julien als Lehrer seiner Kinder auf, indem er dem von ihm vorgestellten Begehren von Valenod zuvorkommt. Es ist nicht herauszulesen, ob dieses Begehren real oder nur in Einbildung von Renâl vorhanden ist. Wenn nun Valenod nachdem Renâl Julien eingestellt hat, das Begehren nach dessen Diensten hat, ist die vorhergehende Illusion Realität geworden. Derjenige der zuerst träumte, hat nun den Beweis seines Traums in der Wirklichkeit.[11]
An diesem Beispiel ist schön ersichtlich, dass ein vermutetes, gar nicht sicher gewusstes Begehren des anderen zukünftige Realität konstituiert. Dieses vermutete Begehren führt dann erst später zu einem wirklich vorhandenen Begehren. Es ist wirklich schön zu sehen, dass auch der Bürgermeister Renâl, wie man ohne die Hintergründe zu kennen vielleicht meinen mag, in seinem ursprünglichen Begehren nach den Diensten von Julien nicht autonom war.
Daran anschließend möchte ich eine Stelle aus Lucien Leuwen, auch einem Werk von Stendhal, erwähnen. In der doppelten Lüge des Docteur Du Poirier erkennt man, dass selbst der reiche Adel in seiner Wahl nicht frei ist und von der Mimesis geleitet wird. Docteur Du Poirier sagt, dass jemand der als Millionär oder Herzog zur Welt kommt, alles zu tun hat, um seine Stellung zu behaupten oder zu verbessern, da ansonsten ihn die öffentliche Meinung als Dummkopf oder Feigling bezeichnen würde.[12]
Auch der Adelige mit seinen Reichtümern ist nicht autonom und muß sich um die Meinung der anderen zu kümmern. Zu sehen, dass die anderen seine Privilegien begehren und das Verteidigen dieser Vorrechte zählen zu seinen Lebensaufgaben. Es ist also keineswegs eine völlig freie und autonome Existenz sondern eine in Beziehung verwickelte Abhängigkeit zu erkennen.
7. Die Armenkrise der Industriellen Revolution Englands und ihre nicht ganz perfekte Lösung
Zur Zeit der Industriellen Revolution (18. Jahrhundert) gab es in England auch gewaltige Armutsprobleme. Die Großteil der Landbevölkerung wanderte in die Städte und konnte nicht gänzlich in den neuen Fabriken, die auch schreckliche Arbeitsbedingungen boten, aufgenommen werden. Viele vagabundierten umher, ohne kaum die geringsten Lebensbedürfnisse decken zu können. Diese Armut der Landbevölkerung war in der Auflösung der Allmende begründet zu sehen. Gemeindeeigentum wurde privatisiert, die Landwirtschaft umgestaltet, produktiver und kommerzieller gemacht, so dass für viele Armen kein Platz mehr am Land war. Es war nicht mehr möglich sich am Wald der Allmende für Bauholz zu bedienen, seine kleinen Viehbestände dort weiden zu lassen und in einem kleinen Haus, das gemeinschaftlich errichtet wurde, zu wohnen.
Bemerkenswert ist, dass die Landreform zu einer Verdoppellung und Vervierfachung der landwirtschaftlichen Produktion führte und sich gleichzeitig die Lage der Ärmsten drastisch verschlimmerte. Besonders schlimm habe ich empfunden wie gleichgültig die Reichen und Machthabenden größtenteils diesen Veränderungen begegneten. An diesem Beispiel sieht man auch, dass Wirtschaftswachstum das Problem der Knappheit keinesfalls lösen kann und es oft sogar noch weiter verschärft. Besonders eigentümlich erschien mir die Meinung vieler Engländer, dass es ein Anstieg der Zahl der Armen in der Entwicklung zu einem sehr reichen Land eine Naturnotwendigkeit darstellte.
Bald sahen sich die Engländer von soviel Elend und Armut umgeben, dass die allgemeine Ordnung bedroht wurde, so wurde 1795 der Edikt von Speenhamland, also ein neues Armengesetz erlassen. Dieses versprach jedem Armen einen unabhängig von einem Arbeitslohn bestehendes Mindesteinkommen, des weiteren wurde jeder Arme zur Arbeit gezwungen. Die Fonds zur Bezahlung wurden von Großgrundbesitzern und Pächtern finanziert, die sich damit einen Teil der Lohnzahlungen ersparten. Da der Arbeitslohn oft unter dem Mindesteinkommen lag, bestand kaum mehr Anreiz mit vollem Einsatz zu arbeiten und die Arbeiterschaft war sehr unmotiviert. Doch diesen die Faulheit vermehrenden Folgen kann entgegengehalten werden, dass es in England in Gegensatz zu Frankreich zu keinem Ausbruch in Form einer Revolution kam, da man sich der Notlage der Armen annahm.
Später wurden diese Gesetze auf Druck der Liberalen Bewegung wieder aufgehoben, jedoch habe ich dieses Beispiel vor allem auch vor dem heutigen wirtschaftlichen Hintergrund erwähnt, wo vom Sozialstaat in Richtung vermehrtem Wirtschaftsliberalismus abgegangen wird. Sollte es in den nächsten Jahrzehnten auch bei uns wieder zu einer Verschärfung der Lage der Armen kommen, wird man um etwaige Gewalteskalationen zu vermeiden, wohl auch nicht darum herum kommen für eine Verbesserung der Situation der Marktwirtschaftsverlierer zu sorgen.
8. Die Mimetische Theorie und das Börsengeschehen – ein möglicher Erklärungsansatz?
Die Entwicklungen an der Börse können mit fundamentalen Analysen von Aktienkursen nicht erklärt werden. Unternehmen können in so kurzen Abständen in denen sich Kurse verdoppeln, verdreifachen, ja verzehnfachen, nicht einen entsprechenden Wertzuwachs erwirtschaften. Eben sowenig ist ein solcher fundamentaler Werteinbruch bei drastisch fallenden Kursen zu beobachten.
Die Kurse an den Aktienbörsen fluktuieren stark und Zyklen von Hausse und Baisse wechseln einander ab. Dies ist nicht mit der meist beständig in nicht so unregelmäßigen Bahnen verlaufenden Steigerung von Unternehmensgewinnen zu vergleichen. Ein niedriges KGV ist kein Garant dafür, dass die fundamental als billig einzustufende Aktie steigen wird. Ebenso kann es bei Unternehmen, die jahrelang Verluste machen, infolge positiver Zukunftsprognosen zu schwindelerregenden Kurssteigerungen kommen.
Ich bin der Meinung gerade für das Börsengeschehen liefert die mimetische Theorie eine gute Erklärung vieler Vorgänge. Viele Hausse und Baisse Bewegungen sind nur unter dem Gesichtspunkt der Nachahmung zu erklären.
Ein schönes Beispiel das zeigt, was nötig ist, um am Spiel der Börse zu den Gewinnern zu zählen, stammt von J. M. Keynes. Es handelt sich dabei um ein Preisausschreiben, bei dem man die 6 Gesichter wählen muss, die von 100 Lesern einer Zeitschrift am schönsten gefunden werden. Um dabei möglichst richtig zu liegen ist nicht wichtig, welche Gesichter mir am besten gefallen, auch nicht welche die meisten wirklich am schönsten finden, entscheidend ist vielmehr welche Meinung die meisten Leute über die Meinung der meisten Leute haben. Die besonderen Experten können das ganze noch aus einer vierten oder fünften Ebenen praktizieren.[13]
Dem Beispiel entsprechend ist es auch an der Börse entscheidend zu wissen welche Meinung die meisten Leute über die Meinung der meisten Leute haben. Diese Meinung wird dann oft zur selbsterfüllenden Prophezeiung und lässt die Kurse dann in die eine oder andere Richtungen ausschlagen.
Was mir auch immer besonders bemerkenswert erscheint ist die selektive Aufmerksamkeit, die mit der Durchsetzung einer Überzeugung meist einhergeht. Sind die Kurse im Steigen und ist die Stimmung positiv werden negative Meldungen kaum wahrgenommen und erscheinen nur als Randnotiz und führen kaum zu Kurssenkungen, hingegen kommt bei fallenden Kursen jeder negativen Unternehmensmeldung zusätzliche Bedeutung zu und weitere Kurskorrekturen sind die Folge.
Eine Studie in einer Dissertation eines Klagenfurter Psychologiestudenten hat auch gezeigt, dass Fachwissen nicht eng mit Börsenerfolg verbunden ist. Sowohl in Hausse als auch in Baisse Zeiten zeigte sich, dass Laien erfolgreichere Aktienanleger als Fachleute waren.
9. Resümee
Mimesis – das ist die Tatsache, dass dasjenige begehrt wird, was die anderen begehren. Es wird das Begehren der anderen nachgeahmt. Es geht nicht so sehr was wir begehren, sondern es geht um das Begehren eines Vorbildes.
Damit wird die direkte Beziehung Subjekt-Objekt der Wirtschaftswissenschaften für nur eingeschränkt gültig erklärt. In der Wirtschaftstheorie geht es ja um die Bedürfnisse die aus Mangel entstehen und befriedigt werden müssen, dabei spielt der Blick zum anderen und das Sehen des Begehrens in diesem Blick keine Rolle.
Ich muss sagen, dass die Mimesis meiner Meinung nach nicht ein allgemeines Erklärungsschema für Wirtschaften darstellt. Sicherlich lassen sich nicht alle Vorgänge unter diesem Gesichtspunkt verstehen. Jedoch gibt die mimetische Theorie auch wenn ich sie mit meinen persönlichen Erfahrungen in der Privatwirtschaft und öffentlichen Wirtschaft vergleiche, für vieles verständliche Erklärungen.
10. Literaturverzeichnis
Dumouchel P. und Depuy J.-P.: Die Hölle der Dinge, LIT Verlag, 1999
Huffschmied, J.: Politische Ökonomie der Finanzen, 1999
Varela, F.: Ethisches Können, 1992
Wellershoff, D.: Double, Alter ego und Schatten-Ich, Literaturverlag Droschl Graz, 1991
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Vorworts?
-
Das Vorwort beschreibt die Schwierigkeit des Autors beim Lesen des Buches „Die Hölle der Dinge“ im Gegensatz zur Einschätzung einer Kollegin. Es betont die subjektive Wahrnehmung und kognitive Strukturen des Lesers. Trotz der Schwierigkeit fand der Autor das Werk interessant, da es eine von betriebswirtschaftlichen Ansätzen abweichende Analyse des Handelns der Subjekte im Wirtschaftsleben bietet.
Was beschreibt der Abschnitt "Gang der Arbeit"?
-
Dieser Abschnitt beschreibt die Struktur der Arbeit. Es werden die Grundaussagen zur mimetischen Theorie zusammengefasst, der Begriff der Mimetische Hölle und die Möglichkeit, dieser zu entkommen, betrachtet. Des Weiteren werden Geschichten aus Romanen, die Girard zur Erklärung der Theorie heranzieht, behandelt. Auch die Armenprobleme zu Beginn der Industrialisierung und deren Lösung sowie das Verhältnis von Mimetischer Theorie und Börse werden thematisiert.
Was ist Mimesis laut der Einleitung?
-
Laut Duden hat Mimesis drei ähnliche Bedeutungen: nachahmende Darstellung der Natur in der Kunst, spottende Rede und die an die Umwelt angepasste Schutztracht der Tiere. Generell handelt es sich um nachahmendes Verhalten, das in Kunst, Rede und bei Tieren vorkommt. Der Mensch lernt vieles durch Nachahmung, doch diese positive Eigenschaft kann auch Probleme verursachen.
Wie hängt Mimesis mit der Wirtschaft zusammen?
-
In modernen Gesellschaften sind Eigenschaften wie Neid, Eifersucht, Gier und Ehrgeiz erwünscht, da sie für Wirtschaftswachstum sorgen. Die Marktwirtschaft kanalisiert die Gewalt dieser Leidenschaften. Die mimetische Gewalt entlädt sich in einem Aneignungs- und Verbrauchsprozess über das Medium des Geldes. Entscheidend ist die Frage: Sehen oder gesehen werden? Das Begehren, das im Blick des Anderen liegt, begründet den ersten Blick und sichert dem Objekt Erfüllung.
Was ist die mimetische Hölle?
-
Die mimetische Hölle ergibt sich daraus, dass niemand dem Nachahmungskreislauf entkommen kann. Die Rivalen sind Doppelgänger, die sich gegenseitig nachahmen und versuchen sich zu übertrumpfen. Dabei bleiben Dritte, die nicht mitmachen können, auf der Strecke. Es will niemand einsehen, dass der Mensch als Beziehungswesen nicht autonom sein kann.
Welche Beispiele aus der Weltliteratur werden zur Erklärung der mimetischen Theorie angeführt?
-
Es werden Beispiele aus Rot und Schwarz von Stendhal und Lucien Leuwen von Stendhal angeführt, die zeigen, wie das vermutete Begehren des anderen zukünftige Realität konstituiert und selbst reiche Adelige in ihrer Wahl nicht frei sind und von der Mimesis geleitet werden.
Wie wird die Armenkrise der Industriellen Revolution Englands im Zusammenhang mit der mimetischen Theorie betrachtet?
-
Die Landreform führte zu einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, verschlimmerte aber gleichzeitig die Lage der Ärmsten. Viele Engländer sahen es als Naturnotwendigkeit an, dass es einen Anstieg der Zahl der Armen in der Entwicklung zu einem sehr reichen Land gab. Das Edikt von Speenhamland sollte die Notlage der Armen lindern. Das Beispiel wird vor dem Hintergrund des heutigen wirtschaftlichen Liberalismus erwähnt, um auf die Notwendigkeit einer Verbesserung der Situation der Marktwirtschaftsverlierer hinzuweisen.
Wie kann die mimetische Theorie das Börsengeschehen erklären?
-
Die mimetische Theorie kann viele Vorgänge an der Börse erklären. Hausse- und Baisse-Bewegungen sind oft nur unter dem Gesichtspunkt der Nachahmung zu verstehen. Entscheidend ist zu wissen, welche Meinung die meisten Leute über die Meinung der meisten Leute haben. Diese Meinung wird dann oft zur selbsterfüllenden Prophezeiung.
Was ist das Resümee der Arbeit?
-
Mimesis ist die Tatsache, dass dasjenige begehrt wird, was die anderen begehren. Es wird das Begehren der anderen nachgeahmt. Die direkte Beziehung Subjekt-Objekt
- Citar trabajo
- Anton Kerschbaumer (Autor), 2002, Die mimetische Theorie und ihre aktuelle Bedeutung in der Ökonomie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107834