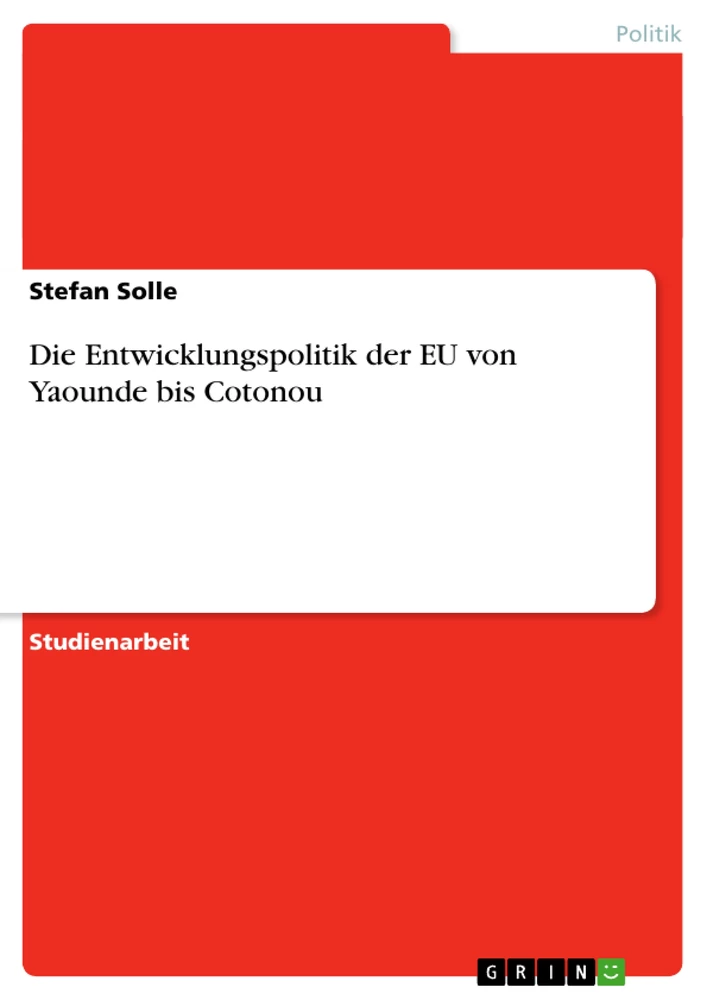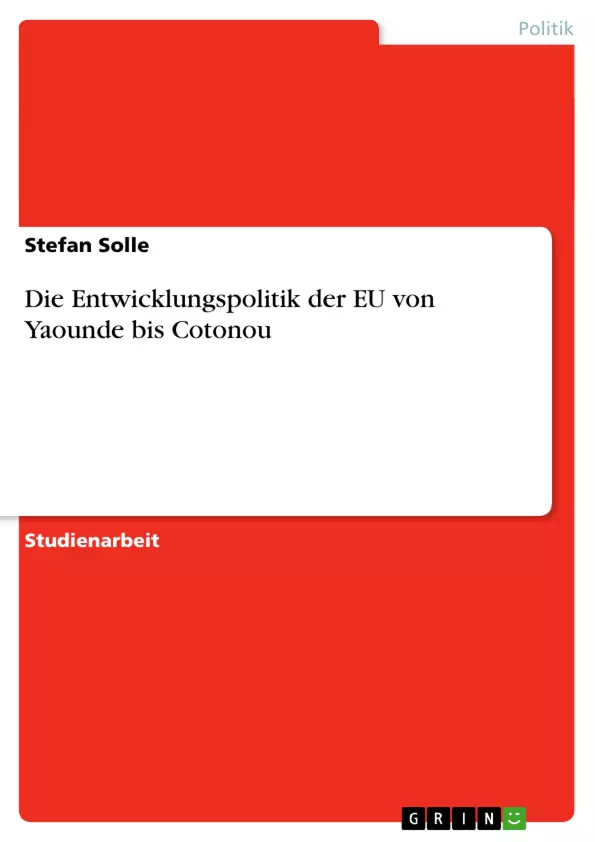INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Die Genese der AKP-EU-Beziehungen
2.1. Das Zeitalter des Kolonialismus
2.2. Die APK-EWG-Zusammenarbeit bis zum ersten Lomé-Vertrag
2.3. Die Verträge von Lomé
3. Aktuelle Probleme der APK-EU-Zusammenarbeit
4. Der Vertrag von Cotonou
5. Fazit
Literaturliste
1. EINLEITUNG
Mit dem Ende des Ost-West-Antagonismus und dem daraus resultierenden Wegfall der zwei großen Blöcke als die die gesamte Welt dominierenden Kräfte, kam es nach 50 Jahren Kalten Krieges zu einer völlig neuen globalen außen- und sicherheitspolitischen Situation. Die sich im Rahmen der Globalisierung ständig verändernde Welt blickt heute sicherheitspolitisch nicht mehr vorrangig auf die Gefahr eines atomaren Krieges, sondern auf eine Vielzahl neuer Risikoquellen; durch die Globalisierung nehmen Migrationsströme in aller Welt zu, die Umweltzerstörung und die bedrohlich anschwellende Knappheit an Rohstoffen bei gleichzeitiger Bevölkerungsexplosion stellen uns vor komplexe Aufgaben[1]. Im Juni 2000 ist das aktuelle Abkommen der EU mit den AKP-Staaten[2] unterzeichnet worden, was den veränderten Bedingungen Rechnung tragen soll. Damit wird eine 40 Jahre währende Zusammenarbeit weitergeführt, die auf sieben verschiedenen Verträgen beruht.
Im Rahmen dieser Hausarbeit soll zunächst die Geschichte der EU-AKP-Kooperation ausführlich dargestellt werden, bevor auf aktuelle Problemlagen und Diskrepanzen eingegangen wird. Im Anschluss daran erfolgt eine erste Einordnung des noch sehr neuen Vertrages von Cotonou. Zur Literaturlage zum Cotonou-Abkommen ist zu sagen, dass mir aufgrund der hohen Aktualität der Thematik noch keine politikwissenschaftlichen Texte zur Verfügung standen und die Behandlung dieses Punktes demzufolge ausschließlich auf der Internetrecherche beruht.
2. DIE GENESE DER AKP-EU-BEZIEHUNGEN
2.1. Das Zeitalter des Kolonialismus
An dieser Stelle soll geschichtlich weit ausgeholt werden, um die Entwicklung der heutigen globalen Lage verdeutlichen zu können. Der Beginn der Nord-Süd-Beziehungen ist im 15. bzw. 16. Jahrhundert, mit den Anfängen der kolonialen Expansion zu setzen. Hierbei waren besonders europäische Staaten, allen voran Großbritannien und die Niederlanden, welche zu dieser Zeit über die leistungsfähigsten Flotten verfügten, federführend im Errichten von Fremdherrschaften – der sogenannten Kolonisation. Den Höhepunkt des Kolonialismus markierte die Epoche des Imperialismus von 1875 bis 1914 mit dem Beginn des 1. Weltkrieges. In dieser Zeit kam es zu einem regelrechten „Run“ auf überseeische Besitztümer. Man kann sogar sagen, dass die restliche Welt unter Europa und den Vereinigten Staaten aufgeteilt wurde. Auch Deutschland beanspruchte damals seinen „Platz an der Sonne“, was beispielsweise mittels der deutschen Kolonien Deutsch-Südwest-Afrika oder Togo belegt werden kann. Ermöglicht wurde diese unerhörte Anmaßung unter anderem durch die technische Überlegenheit der westlichen Staaten – von der Industrialisierung begünstigt – gegenüber der übrigen Welt.[3] Die wichtigsten Motive für das Streben nach kolonialem Besitz waren vor allem natürlich der Profit, der aus der Ausbeutung von Land und Menschen (zum Beispiel durch Rohstoffabbau oder die Sklaverei) zu gewinnen war, allerdings gab es daneben auch christlich geprägte Motive, womit die Missionierung der „Heiden“ angestrebt wurde, und ein „zivilisatorisch-humanitäres Sendungsbewußtsein“[4] der westlichen Staaten, welches bis heute spürbar ist. Dieser historische Prozess der Kolonialisierung führte laut Müller zur „Entstehung der modernen Weltwirtschaft mit ihrer internationalen Arbeitsteilung, welche die Dritte Welt zu Rohstofflieferanten (Monokulturen) und Absatzmärkten für die Industrieländer machte und ihnen wenig Chancen zu einer eigenständigen industriellen Entwicklung bot.“[5] Weiterhin kritisiert Müller die Oktroyierung westlicher Strukturen auf die betreffenden Kolonien ohne Berücksichtigung der dortigen, historisch gewachsenen Strukturen, was für viele heutige Probleme in den „Entwicklungsländern“ verantwortlich ist: „Der forcierte Anbau agrarischer Exportgüter und die Schaffung industrieller Enklaven führten häufig zu ländlicher Verarmung, vernichteten zahllose traditionelle Arbeitsplätze und schufen ein zunehmendes Stadt-Land-Gefälle. In Jahrhunderten gewachsene Agrokulturen und Ökosysteme wurden zerstört, eine wichtige Ursache vieler heutiger ökologischer Probleme (z.B. im Sahel)“[6].
Mit diesem Hintergrund, dass der Norden viel zu der andauernden Krise im Süden selbst beigetragen hat, haben Deutschland, eine der bedeutendsten Industrienationen, und die EU sicherlich mehr als nur eine „ethische[ ] Verantwortung“[7] gegenüber den Entwicklungsländern, wie es vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung formuliert wurde.
2.2. Die APK-EWG-Zusammenarbeit bis zum ersten Lomé-Vertrag
Zwischen den Jahren 1945 und 1960 kam es zu massiven Unabhängigkeitsbestrebungen in den Kolonialländern Afrikas und Asiens und somit zur Dekolonisation – aus Kolonien wurden souveräne Staaten. Müller erklärt diese Entwicklung mittels der Selbstbekämpfung des Nordens in den beiden Weltkriegen und der „innere[n] Dynamik der westlichen werte und Menschenrechte“[8]. Allerdings blieben die neuen Nationalstaaten häufig bis in die heutige Zeit politisch und wirtschaftlich stark an die ehemaligen „Mutterländer“ gebunden, wie beispielsweise das Verhalten Belgiens in Kongo belegt[9]. Besonders der entstehende Ost-West-Antagonismus und das daraus resultierende Streben nach Machtsphären im Süden von Seiten der Blöcke erschwerte den Entwicklungsländern eine eigenständige Entwicklung[10]. Aus dieser Zeit stammte auch der Begriff der „Dritten Welt“, die sich jedoch gegen die Interessen der „Ersten“ und „Zweiten Welt“ nie wirklich durchsetzen konnte.
In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts setzte dann graduell eine finanzielle, technische und personelle Entwicklungshilfe von Seiten der westlichen Staaten in Form von zunächst bilateralen und später multilateralen Abkommen ein, es entwickelte sich erstmals ein „weltweites entwicklungspolitisches Bewustsein“[11]. Hier beginnt die Entwicklungspolitik der EWG, deren Behandlung im Mittelpunkt des Interesses dieser Hausarbeit steht.
Während den Verhandlungen zu den EWG-Verträgen (1957) strebte Frankreich mit dem „Konzept einer gesamteuropäischen Kolonialpolitik“[12] die Assoziierung der Überseegebiete – die meisten heutigen AKP-Staaten waren damals noch in kolonialen Verhältnissen – an. Trotz anfänglichem Widerstand Deutschlands wurden die Überseegebiete Frankreichs, Belgiens, Italiens und der Niederlande mit der Unterzeichnung der Verträge von Rom am 25.03.1957 assoziiert.[13] Als Ziel dieser einseitigen Erklärung wurde die „Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung“[14] mittels Handelserleichterungen und Hilfeleistungen proklamiert. So wurden die Zölle zwischen den assoziierten Gebieten und der EWG abgebaut, also ein weitestgehender Freihandel angestrebt, und die mengenmäßigen Beschränkungen für Handelswaren abgeschafft. Zur Realisierung der finanziellen Hilfeleistungen richtete die EWG den EEF (den E uropäische E ntwicklungs f onds) ein, „das zentrale Finanzierungsinstrument der [späteren] Lomé-Politik“[15], mit einem anfänglichen Umfang von etwa 580 US$, der von allen sechs EWG-Ländern getragen wurde. Dieses Abkommen wurde vor allem vom Commonwealth als „kollektiver Neokolonialismus“ kritisiert, da es eine Zwangsassoziierung darstellte und die Assoziierungsgegner eine neue Form von politischer Vormundschaft in Afrika befürchteten.[16]
Mit der Unabhängigkeit der assoziierten Staaten verlor die Assoziierung ihre Rechtsgrundlage, weshalb ein neues Abkommen der EWG mit den 18 A ssoziierten A frikanischen S taaten und M adagaskar (die sogenannten AASM) ausgehandelt wurde. Der 1963 unterzeichnete Vertrag von Yaoundé stellte einen Vertrag gleichberechtigter Staaten dar, allerdings die Tatsache, dass das Abkommen realpolitisch nahezu im Alleingang von den EWG-Staaten entwickelt wurde, und die AASM-Staaten diesem nur zustimmen oder es ablehnen konnten, zeigt den wahren Charakter der „Gleichberechtigung“ der Vertragspartner[17]. Am Wesen des vorherigen Abkommens wurde wenig geändert, das Zwangssystem der Gegenpräferenzen blieb bestehen, ein neuer EEF wurde eingerichtet und der zollfreie Warenausfuhr der eingebundenen Entwicklungsländer an den EWG-Markt – außer bei Konkurrenz dieser Produkte mit EWG-Waren – gewährt[18]. Das Abkommen hatte eine Laufzeit von fünf Jahren, und wurde 1969 vom Yaoundé-II-Abkommen abgelöst. Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass beide Verträge die Intention der Entwicklungsförderung bei gleichzeitiger Festigung des wirtschaftlichen Einflusses der EWG auf die AKP-Staaten vereinigten. Demzufolge dominiert wirtschaftliches Kalkül über ethisches Hilfedenken, die Yaoundé-Abkommen sind noch immer „kolonial[] gefärbt“[19]. Als Kritik und Forderungen nach einer grenzenlosen Marktöffnung Europas, vor allem für Produkte der weiterverarbeitenden Industrie, von Seiten der AKP-Staaten (mit Nigeria in einer Vorreiterrolle) laut wurden, reagierte die EWG 1966 mit dem nie in Kraft getretenen Kompromissabkommen von Lagos, und dann, 1968 mit dem Arusha-Abkommen für Ostafrika, worin die mengenmäßigen Beschränkungen für zollfreie Exporte aufgehoben wurden[20]. Da dieser Vertrag keine Finanzielle und Technische Zusammenarbeit vorsah, soll an dieser Stelle auch nicht weiter darauf eingegangen werden.
Trotz der enttäuschenden Resultate im Bereich der gegenseitigen Handelspolitik lässt sich auch Positives aus den ersten 18 Jahren vertraglich festgelegter Entwicklungspolitik der EWG konstatieren: der Ausbau des EEF bot für die angeschlossenen AKP-Staaten eine „willkommene Kompensation“[21].
2.3. Die Verträge von Lomé
Der Beitritt Großbritanniens zur EWG im Jahr 1973 und die daraus resultierende Frage nach Behandlung der Commonwealth-Länder, die sich für einen Anschluss zu den bereits assoziierten Ländern entschlossen hatten, implizierte neue Vorraussetzungen in der Entwicklungspolitik, was sich in dem ersten Vertrag von Lomé bemerkbar machte. Auch die gestärkte Position der AKP-Staaten durch den Schock der Ölkrise von 1973/1974 für die Industrienationen und ein neuerdings bemerkenswert homogenes Auftreten dieser änderten die Vertragssituation deutlich[22]. So wurde mit dem ersten Vertrag von Lomé von 1975, dem ersten einheitlichen Vertrag für alle Bereiche der Zusammenarbeit, der von nunmehr 9 EG- und 46 AKP-Staaten unterzeichnet wurde, der bisherige Grundsatz der „Reziprozität der Handelsvereinbarungen“[23] aufgegeben, was ein bedeutendes Zugeständnis an die Entwicklungsländer bedeutete. Als Hauptziel des Kooperationsabkommen wurde die „Organisation eines großen Wirtschaftsraumes mit einem Höchstmaß an Freizügigkeit und eine wirksame finanzielle Unterstützung der assoziierten Länder“[24] angestrebt. Das gesamte assoziierte Gebiet war durch Lomé I zu einer Art Freihandelszone geworden, allerdings mit den Einschränkungen, dass die Produkte der europäischen Agrarmarktordnung ausgenommen wurden, um das EG-interne landwirtschaftliche Gefälle nicht zu gefährden, und dass bei ökonomischen Schwächen der EG-Wirtschaft der Freihandel begrenzt werden konnte (die sogenannte Schutzklausel)[25]. Die Ergebnisse des Abkommens wurden auch von wissenschaftlichen Kreisen wohlwollend aufgenommen – Brüne beispielsweise bezeichnete die mit diesem Vertrag beginnende Lomé-Politik als „das langjährige Kern- und Vorzeigestück europäischer Südpolitik“[26]. Als wichtigste Neuerung kann die Einführung des Stab ilisierungsfonds für landwirtschaftliche Ex portprodukte (kurz: STABEX) gelten. Durch das STABEX-System sollten Mindereinnahmen der AKP-Staaten bei Exporterlösen oder Ernteausfällen und damit also unvorhersehbare Schwankungen ausgeglichen werden[27], die Budgetplanung der betroffenen Staaten bekam demzufolge eine stabilere Grundlage. Allerdings müssen die betroffenen AKP-Staaten einen Anteil der Ausfälle selbst tragen und die Anwendung des Systems wurde auf Einbußen bei EU-Exporten und auf bestimmte Rohstoffe beschränkt. Weiterhin musste das Erzeugnis mindestens einen Anteil von 5% am Gesamtexport des Landes ausmachen. Da STABEX nur etwa 10-12% des gesamten Lomé-Budgets ausmachte, waren die Unterstützungen in Form von zinsgünstigen, langfristigen Krediten häufig „nicht mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein“[28]. STABEX kann also nur kurzzeitige Probleme abfangen, langanhaltenden Rohstoffpreisrückgängen ist das System finanziell nicht gewachsen[29]. Die unbestreitbaren Vorteile des Systems liegen in den „große[n] Spielräume[n] bei der Verwendung“[30] und der – für Lomé-Verhältnisse – relativ schnellen Auszahlung der Mittel (ein Jahr nach dem Verlust). Zur gesamten EG-Entwicklungspolitik dieser Zeit, besonders im Bezug auf die Debatte über eine neue Weltwirtschaftsordnung und zu geringer Einflussmöglichkeiten der AKP-Staaten selbst, kritisiert Müller das Verhalten der EG auf das Schärfste, indem er schreibt, „dass die Länder des Nordens jeder wirklichen Veränderung des Weltwirtschaftssystems erfolgreich Widerstand leisteten.“[31]
Bei der wiederum fünfjährigen Laufzeit des ersten Lomé-Abkommens stand 1981 die Erneuerung an, Lomé II. Dieses Abkommen wird aufgrund von Rezessionen in den Geberländern, von Arbeitslosigkeit und Haushaltsdefiziten von Sparmaßnahmen bestimmt[32]. Im wesentlichen blieben die Regelungen des ersten Vertrages bestehen. Nach dem Motto „etwas ist besser als nichts“[33] wurden die STABEX-Vereinbarungen um sieben Mineralien erweitert, die unter dem unabhängigen Sonderfonds für Bergbauerzeugnisse (SYSMIN) festgehalten wurden. SYSMIN dient wie STABEX dazu, die nachteiligen Auswirkungen vorübergehender schwerwiegender Störungen des Bergbausektors auf die Einnahmen der AKP-Staaten abzufangen. Ein SYSMIN-Antrag ist dann gerechtfertigt, wenn der Anteil der fraglichen Erzeugnisse an den Gesamtausfuhren vier Jahre in Folge im Schnitt mehr als 15%, oder der Anteil der Ausfuhrerlöse für sämtliche Bergbauerzeunisse 20%[34] bzw. mehr ausmacht. Allerdings muss angemerkt werden, dass das Hauptmotiv für SYSMIN das „Interesse der EG-Staaten an einer stabilen Rohstoffversorgung (...) darstellt“[35]. Neben SYSMIN wäre als Ergebnis von Lomé II nur die Anhebung der EEF-Mittel um etwa 50% - bei angekündigten 200% ist dies jedoch auch eher ein Misserfolg – erwähnenswert. Weidmann sieht diese mehr als enttäuschende Entwicklung als „Spiegelbild des angespannten Nord-Süd-Verhältnisses Ende der 70er Jahre. (...) Am Ende der Verhandlungen war völlig offen, ob es jemals ein Lomé III geben wird.“[36]
Diesen düsteren Prognosen zum Trotz, gab es eine dritte Auflage des Lomé-Abkommens, der Vertrag trat 1986 in Kraft. Das Verhältnis zwischen EG und AKP-Staaten verschlechterte sich weiter, da von einer Erweiterung der Hilfestellungen kaum die Rede sein konnte. Die einzige wirkliche Neuerung bildete die Formulierung der entwicklungspolitischen Zielsetzung, mit der Entwicklungszusammenarbeit eine „autonomere und sich selbsttragende Entwicklung“[37] voranzutreiben. Das vorrangige Ziel war, mit dem Hintergrund der aktuellen „tiefsten Wirtschaftskrise seit Erlangung der Unabhängigkeit“[38] und der dramatischen Ernährungs-situation in Afrika, die Selbstversorgung und Ernährungssicherheit[39] – die vielzitierte „Hilfe zur Selbsthilfe“. Weiterhin wurde erstmals eine gemeinsame Erklärung in das Vertragswerk aufgenommen, die ein Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte, zur demokratischen Kontrolle und zur Partizipation der Bevölkerung enthielt.
Das vierte Lomé-Abkommen von 1990 hatte als augenscheinlichstes Novum eine Laufzeit von zehn Jahren, wobei der mittlerweile siebente EEF, der sich auf etwa 12 Milliarden ECU belief, allerdings bereits nach den ersten fünf Jahren neu ausgehandelt werden musste. Wurden im Dritten Lomé-Abkommen Menschenrechte und Demokratiebestrebungen in der Vertragstext aufgenommen, so wurde jetzt dieser Passus noch verschärft. „Der Wunsch der EG, die Frage der Menschenrechte in das Vertragswerk einzubeziehen, ist in Lomé IV bisher am stärksten berücksichtigt worden. (...) Sanktionsmaßnahmen bei Menschenrechts-verletzungen sieht der Lomé-Vertrag allerdings nicht vor.“[40] Auch die „Anerkennung der Rolle der Frau“ (Lomé-IV-Vertrag, Kap.I, Art.4), also die Gleichberechtigung der Geschlechter, wurde bekräftigt, ein noch immer großes Problem des Alltages in vielen AKP-Staaten, betrachtet man nur die Unterschiede in den Scheidungsmöglichkeiten in der islamischen Welt. „So reicht männlichen Muslimen das dreimalige Aussprechen der Formel ‚Ich verstoße Dich’ [der sogenannte Talak – der Autor], um eine lästig gewordene Beziehung zu beenden. (...) Während die durch den Mann bewirkte Scheidung nur amtlich festgehalten wird, muß die Frau, um die Scheidung zu erlangen, ein Gerichtsverfahren anstrengen.“[41]
Des weiteren wurde das Prinzip der Rechtstaatlichkeit der AKP-Staaten als Kriterium der Zusammenarbeit verankert. Handelspolitisch änderte sich an der vorherigen Situation kaum etwas, die vorgeschlagene Liberalisierung der EG-Importpolitik scheiterte am inneren Widerstand der EU, da die neuen südlichen EU-Mitglieder die Konkurrenz von Südfrüchten aus Entwicklungsländern zu ihren eigenen Erzeugnissen fürchteten[42]. Weidmann fasst das Dilemma stagnierender Vertragsinnovationen treffend zusammen: „Die AKP-Gruppe (...) hat nur noch die Möglichkeit, eine von der EG bestimmte Grundkonzeption der Lomé-Politik und damit Minimalangebote der Europäer zu akzeptieren. (...) Lomé IV besiegelt endgültig eine Abkehr von der umstrittenen handelspolitischen Zusammenarbeit und die Hinwendung auf die Entwicklungshilfe als das klassische Kernstück wirtschaftlicher Entwicklungszusammenarbeit.“[43]
3. AKTUELLE PROBLEME DER AKP-EU-ZUSAMMENARBEIT
Ein sehr großes Problem in der Entwicklungszusammenarbeit stellt noch immer das Ungleichgewicht der Partner dar, was sich auf unterschiedlichste Weise äußert. „Dem relativ geschlossenen Block der EG-Länder steht eine eher auseinanderstrebende Gruppe von Ländern gegenüber mit sehr unterschiedlichem politischen und kulturellen Hintergrund, sehr unterschiedlicher Wirtschaftskraft, Bevölkerungszahl und flächenmäßiger Ausdehnung.“[44] Eine in sich weitgehend homogene, und in dem Fall sogar als ein einheitliches politisches Gebilde auftretende Gruppe hat viel bessere Verhandlungsmöglichkeiten und kann somit ihre Interessen außerdem effizienter durchsetzen. Die Dominanz der EU-Staaten zeigt sich besonders deutlich darin, dass die Höhe der Finanzmittel allein von den Geberländern bestimmt wird, und den AKP-Staaten nur die notgedrungene Akzeptierung dieser blieb, was dazu führte, dass „noch kein Lomé-Abkommen annähernd in seinem Finanzvolumen den Wünschen der Empfängerländer entsprach.“[45] Allerdings ist es mit der Einheit in Fragen der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit aufgrund zu großer einzelstaatlicher Interessenverfolgung der EU-Mitgliedsstaaten und der mangelnden Bereitschaft, nationale Kompetenzen an die EU abzugeben, auch nicht zum Allerbesten bestellt. „Daß die zur Zeit 16 Politiken (fünfzehn EU-Länderpolitiken und die Entwicklungspolitik der Union) zu einem kohärenten Ganzen verzahnt werden und letztlich zu einer vergemeinschafteten Politik zusammenwachsen (Europäisierung), ist zumindest für die nahe Zukunft nicht zu erwarten.“[46] Weiterhin ist das gegenseitige Abhängigkeits-verhältnis ungleich gewichtet. „Die Bedeutung der AKP-Staaten als Absatzmärkte für EG-Produkte ist gering, die Bedeutung der EG für den Absatz der Produkte der AKP-Staaten ist jedoch groß.“[47]
Mit dem Ende des Ost-West-Antagonismus stehen die Länder des ehemaligen Ostblockes vor ähnlichen Problemen wie die Entwicklungsländer, was zu einer „spürbare[n] Verlagerung der politischen und öffentlichen Aufmerksamkeit im Westen von der Dritten Welt auf den europäischen Osten“[48] einer Konkurrenzsituation zwischen diesen Staaten im Wettbewerb um Märkte oder westliche Investitionen führen kann. Ein gewichtiger Vorteil dieser Länder ist die geographische, geschichtliche und kulturelle Nähe zu Westeuropa. Müller sieht eine möglicherweise entstehende neue Weltordnung zum einen als Chance für „verbesserte[ ] Ost-West- sowie Nord-Süd-Beziehungen“[49], warnt jedoch gleichzeitig vor der Gefahr einer neuen „strukturellen Dreiteilung der kapitalistischen Weltwirtschaft in reiche Industrieländer (OECD), strategisch für sie wichtige ‚Schwerpunktländer’ (Russland, einige osteuropäische Staaten und etwa 30 große Entwicklungsländer) und der Rest der Welt, weit über 100 arme und ärmste, meist kleinere Länder, die weltpolitisch und geostrategisch keine Bedeutung darstellen und für das Gedeihen der Weltwirtschaft ‚überflüssig’ sind.“[50] Diese pessimistische Prognose wird beispielsweise durch den Rückgang von Entwicklungshilfeleistungen bestätigt. So kam es zu einem Absinken der Entwicklungshilfe der 21 westlichen Industrieländer[51] seit Mitte der 90er Jahre und zur Stagnation bei durchschnittlich etwa 0,3% des Bruttosozialproduktes des jeweiligen Landes[52] (angestrebt werden 0,7% des BSP) – wenn man bedenkt, dass diese Länder 90% der gesamten Entwicklungshilfe aufbringen, zeigt sich erst die wahre Bedeutung dieses Rückgangs[53]. Auch Deutschland bildet hierbei keine Ausnahme, 1996 flossen 0,32% des BSP in Entwicklungshilfe, 1998 waren es schon nur noch 0,26%[54], und auch für den Bundeshaushalt für 2002 sieht Herr Eichel Kürzungen von etwa 5,3% im Etat des BMZE vor[55]. Deutscher sieht darin bereits „die internationale politische Glaubwürdigkeit [ ] betroffen“[56]. Sicherlich bringt Geld allein keine Entwicklung, aber die Zahlungsbereitschaft der Industrieländer ist dennoch ein signifikantes Merkmal für abnehmendes Interesse der Öffentlichkeit an entwicklungspolitischen Problemen.
4. DER VERTRAG VON COTONOU
Der am 23.06.2000 unterzeichnete Vertrag von Cotonou, der die Kooperation der Union mit inzwischen 77 APK-Staaten regelt, hat erstmals eine Laufzeit bis 2020, also von 20 Jahren. Diese verdoppelte Gültigkeitsdauer des Abkommens im Vergleich zu Lomé IV soll die Planungssicherheit gewährleisten, damit die notwendig gewordenen Reformen umgesetzt werden können. Dabei wurde von den EU-Mitgliedern versichert, in Zukunft verstärkt auf landesspezifische Probleme eingehen zu wollen, eine „für jedes Land (...) individuell angepasste Entwicklungsstrategie“[57] soll die Kooperation flexibler und effizienter werden. Das überholte System der einseitigen Handelspräferenzen soll, nach einer unterstützungsintensivierten Übergangsphase, einer Handels-liberalisierung weichen, um eine „schrittweise Integration der AKP-Staaten in die Weltwirtschaft“ (Vertrag v. Cotonou, Kap.I, Art.1) zu erreichen. Neu sind ebenso finanzielle Zuwendungen an NGO`s und deren verstärkte Einbeziehung bei Dialogen und Ausführung von Programmen, womit der „komplementäre[n] Rolle der nichtstaatlichen Akteure“ (Vertrag v. Cotonou, Kap.I, Art.4) bei der Partizipation der gesamten Gesellschaft Rechnung getragen wird.
5. FAZIT
Die von der EU angestrebte „grundlegende Revision der Lomé-Verträge“[58] ist meiner Meinung nach nicht realisiert worden, Cotonou steht dazu viel zu sehr in der Tradition von Lomé. Die angestrebte handelspolitische Liberalisierung ist die einzige revolutionäre Komponente des Abkommens. Die Formulierung der „behutsamen Liberalisierung“[59] lässt die Hoffnungen auf wirklich gleichberechtigte Kooperation unter Partnern allerdings schwinden. Unter diesem Aspekt betrachtet, erscheint der Weg zur Entwicklungs zusammenarbeit noch lang zu sein.
Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Heidemarie Wieczorek-Zeul ist vom Erfolg des größten Vertragswerks zwischen Nord und Süd überzeugt: "Es ist gelungen, ein zeitgemäßes Abkommen zu formulieren, das den "Geist von Lomé" wahrt und gleichzeitig die unumgänglichen tiefgreifenden Neuerungen einvernehmlich regelt."[60] Was das Vertragswerk jedoch in der Praxis der Entwicklungspolitik leisten wird, kann nur die Zukunft zeigen.
LITERATURLISTE
Sekundärliteratur
Arbeitskreis Entwicklungspolitik im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (Hg.): EG-Entwicklungspolitik. Stabex – Sysmin – Subventionen, Moderne Formen des Kolonialismus? Stuttgart 1991.
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hg.): Journalistenhandbuch Entwicklungspolitik, überarb. Neuaufl., Berlin 1999.
Deutsche Welthungerhilfe (Hg.): Lomé III: Kritische Analysen zum Verhältnis der Europäischen Gemeinschaft gegenüber der Dritten Welt, Bd. 1, Bonn 1984.
Eßer, Klaus: Partnerschaft mit Schwellenländern. Aufgaben der Entwicklungspolitik, Berlin 1999.
Fanon, Frantz: Die Verdammten dieser Erde, Frankfurt 1981.
Holtz, Uwe (Hg.): Probleme der Entwicklungspolitik, Bonn 1997.
Holtz, Uwe / Deutscher, Eckhard: Die Zukunft der Entwicklungspolitik. Konzeptionen aus der entwicklungspolitischen Praxis, Bonn 1995.
Kevenhörster, Paul / Woyke, Wichard (Hg.): Europa und die Dritte Welt. Dokumentation des Symposions vom 24. und 25. November 1989, Bochum 1990.
Krauß, Stefan: Parlamentarisierung der europäischen Außenpolitik. Das Europäische Parlament und die Vertragspolitik der Europäischen Union (=Forschung Politikwissenschaft, Bd. 62), Opladen 2000.
Müller, Johannes: Entwicklungspolitik als globale Herausforderung. Methodische und ethnische Grundlegung, Stuttgart / Berlin / Köln 1997.
Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon Dritte Welt. Länder Organisationen Theorien Begriffe Personen, Hamburg 2000.
Nuscheler, Franz (Hg.): Entwicklung und Frieden im Zeichen der Globalisierung, Bonn 2000.
Nuscheler, Franz / Schmuck, Otto (Hg.): Die Süd-Politik der EG. Europas entwicklungspolitische Verantwortung in der veränderten Weltordnung, Bonn 1992.
Schmuck, Otto (Hg.): Die Entwicklungspolitik der EG: Vom Paternalismus zur Partnerschaft (=Materialien zur Europapolitik, Bd. 11), Bonn 1992.
Schubert, Klaus / Müller-Brandeck-Bocquet, Gisela (Hg.): Die Europäische Union als Akteur der Weltpolitik, Opladen 2000.
Weidmann, Klaus: Die EG-Entwicklungspolitik in Afrika. Hungerhilfe oder Elitenförderung? (= Nomos Universitätsschriften Politik, Bd. 15), Baden-Baden 1991.
Wellershoff, Dieter (Hg.): Die Europäische Union und ihre Stellung in der Welt, Hamburg / Berlin / Bonn 1996.
Woyke, Wichard (Hg.): Handwörterbuch Internationale Politik, 7. akt. Aufl., Bonn 1998.
Quellen:
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften (Hg.): Viertes AKP-EWG-Abkommen, unterzeichnet am 15.Dezember 1989 in Lomé, Luxemburg 1991.
Das EU-AKP-Abkommen von Cotonou, unterzeichnet am 23.06.2000 in Cotonou, in: <http://www.europa.eu.int/comm/development/cotonou/ agreement_de.htm> am 26.06.2001.
[...]
[1] Vgl. Woyke, Wichard, Internationale Sicherheit. in: Woyke, Wichard (Hrsg.), Handwörterbuch Internationale Politik, 7., aktualisierte Aufl., Bonn 1998, S. 177-183, hier S. 180f.
[2] Die Staaten A frikas, der K aribik und des P azifischen Raumes.
[3] Vgl. Müller, Johannes: Entwicklungspolitik als globale Herausforderung. Methodische und ethnische Grundlegung, Stuttgart / Berlin / Köln 1997, S.31.
[4] Ebd., Dieses Bewusstsein im ausgehenden 19. Jahrhundert zeigt sich besonders deutlich in den zeitgenössischen Reiseerzählungen Karl Mays, in denen die Zivilisierung des „edlen Wilden“ eine zentrale Rolle spielt.
[5] Ebd.
[6] Ebd., S.32.
[7] <http://www.bmz.de/themen/motive/index.html> am 26.06.2001.
[8] Müller, Entwicklungspolitik, 1997, S.33.
[9] Vgl. Scheen, Thomas: Die Belgier spielen das Spiel. In Kongo betreibt die ehemalige Kolonialmacht handfeste Politik – mit hohem Risiko, in: FAZ vom 7.3.2001, S.16.
[10] Vgl. Müller, Entwicklungspolitik, 1997, S. 33.
[11] Ebd., S. 34.
[12] Weidmann, Klaus: Die EG-Entwicklungspolitik in Afrika. Hungerhilfe oder Elitenförderung? (= Nomos Universitätsschriften Politik, Bd. 15), Baden-Baden 1991, S.43.
[13] Vgl. ebd., S. 43f.
[14] Ebd., S.44.
[15] Klingebiehl, Stephan: Fünfzehn Jahre AKP-EWG-Zusammenarbeit: Zielsetzungen, Instrumente, Ergebnisse, in: Nuscheler, Franz / Schmuck, Otto (Hg.): Die Süd-Politik der EG. Europas entwicklungspolitische Verantwortung in der veränderten Weltordnung, Bonn 1992, S. 111-125, hier S. 113.
[16] Vgl. Weidmann, EG-Entwicklungspolitik in Afrika, 1991, S.45f.
[17] Vgl. Arbeitskreis Entwicklungspolitik im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (Hg.): EG-Entwicklungspolitik. Stabex – Sysmin – Subventionen, Moderne Formen des Kolonialismus? Stuttgart 1991, S. 24.
[18] Vgl. ebd.
[19] Ebd.
[20] Vgl. Weidmann, EG-Entwicklungspolitik in Afrika, 1991, S. 52f.
[21] Ebd., S. 54.
[22] Vgl. ebd., S. 58.
[23] Ebd., S. 59.
[24] Köhler, Volkmar: Die Entwicklungspolitik der Europäischen Gemeinschaft, in: Kevenhörster, Paul / Woyke, Wichard (Hg.): Europa und die Dritte Welt. Dokumentation des Symposions vom 24. und 25. November 1989, Bochum 1990, S. 20-33, hier S. 21.
[25] Vgl. Weidmann, EG-Entwicklungspolitik in Afrika, 1991, S. 59.
[26] Brüne, Stefan: Gibt es eine Zukunft für Lomé? Die EU-AKP-Beziehungen auf dem Prüfstand, in: Internationale Politik, 11/1998, S. 37-40, hier S. 37.
[27] Für eine detailliertere Darstellung der Funktionsweise von STABEX verweise ich den interessierten Leser auf Arbeitskreis Entwicklungspolitik, EG-Entwicklungspolitik, 1991, S. 32-34.
[28] Klingebiehl, Fünfzehn Jahre AKP-EWG-Zusammenarbeit, 1992, S. 122.
[29] Vgl. ebd., S. 124.
[30] Ebd., S. 123.
[31] Müller, Johannes: Entwicklungspolitik als globale Herausforderung, 1997, S. 35.
[32] Arbeitskreis Entwicklungspolitik, EG-Entwicklungspolitik, 1991, S. 25.
[33] Weidmann, EG-Entwicklungspolitik in Afrika, 1991, S. 62.
[34] Für die am härtesten betroffenen Länder liegen die Prozentzahlen entsprechend niedriger (bei 10 bzw. 12%.
[35] Arbeitskreis Entwicklungspolitik, EG-Entwicklungspolitik, 1991, S. 35.
[36] Weidmann, EG-Entwicklungspolitik in Afrika, 1991, S. 62f.
[37] Vgl. ebd., S. 67.
[38] Ebd., S. 72.
[39] Vgl. ebd., S.67.
[40] Klingebiehl, Fünfzehn Jahre AKP-EWG-Zusammenarbeit, 1992, S. 117f.
[41] Ulfkotte, Udo: Scheidung per SMS. Rechtsgelehrte in Dubai erkennen die elektronische Trennung an, in: FAZ vom 29.06.2001.
[42] Vgl. Weidmann, EG-Entwicklungspolitik in Afrika, 1991, S. 69f bzw. Arbeitskreis Entwicklungspolitik, EG-Entwicklungspolitik, 1991, S. 25f.
[43] Weidmann, EG-Entwicklungspolitik in Afrika, 1991, S. 71.
[44] Arbeitskreis Entwicklungspolitik, EG-Entwicklungspolitik, 1991, S. 21.
[45] Köhler, Volkmar: Die Entwicklungspolitik der Europäischen Gemeinschaft, 1990, S. 25.
[46] Holtz, Uwe: Probleme und Perspektiven der Entwicklungspolitik, in: ders. (Hg.): Probleme der Entwicklungspolitik, Bonn 1997, S. 11-97, hier S.53. Vgl. zu dieser Problematik auch Deutscher, Eckhard: Entwicklungspolitische Konzeptionen – eine Einführung, in: Holtz, Uwe / Deutscher, Eckhard: Die Zukunft der Entwicklungspolitik. Konzeptionen aus der entwicklungspolitischen Praxis, Bonn 1995, S.47-69, hier S. 54.
[47] Ebd., S.22.
[48] Müller, Entwicklungspolitik, 1997, S.37.
[49] Ebd., S. 38.
[50] Ebd., S. 39.
[51] Gemeint sind USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Schweiz, Norwegen und die EU ohne Griechenland.
[52] Die einzigen Ausnahmen bildeten Norwegen, Dänemark, Schweden und die Niederlande mit Anteilen von 1,05% bis 0,76%. Besonders unrühmlich ist der Anteil der USA, sie geben nur 0,15% ihres Bruttosozialproduktes für Entwicklungshilfezahlungen aus (Zahlen von 1994).
[53] Vgl. Holtz, Uwe: Probleme und Perspektiven, 1997, S. 34.
[54] Zahlen aus: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hg.): Journalistenhandbuch Entwicklungspolitik, überarb. Neuaufl., Berlin 1999, S.57.
[55] Vgl. Reiermann, Christian: Gebremster Sparzwang, in: Der Spiegel, Nr. 24 vom 11.06.2001, S. 24.
[56] Deutscher, Entwicklungspolitische Konzeptionen, 1995, S. 68.
[57] <http://www.bmz.de/medien/misc/eu_akp.html> vom 26.06.2001.
[58] Brüne, Gibt es eine Zukunft für Lomé?, 1998, S. 37.
[59] <http://www.bmz.de/medien/misc/eu_akp.html> vom 26.06.2001.
Häufig gestellte Fragen zu "INHALTSVERZEICHNIS"
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument befasst sich mit der Genese und aktuellen Problemen der AKP-EU-Zusammenarbeit, einschließlich der Verträge von Lomé und des Vertrags von Cotonou.
Was sind die AKP-Staaten?
AKP steht für die Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Raumes.
Welche Rolle spielt der Kolonialismus in den AKP-EU-Beziehungen?
Das Dokument beleuchtet, dass die Nord-Süd-Beziehungen ihren Ursprung im Kolonialismus haben und dass die Ausbeutung der Kolonien durch europäische Staaten die wirtschaftliche Entwicklung der AKP-Staaten beeinträchtigt hat.
Was waren die Verträge von Yaoundé?
Die Verträge von Yaoundé (1963 und 1969) waren Abkommen zwischen der EWG und den Assoziierten Afrikanischen Staaten und Madagaskar (AASM), die darauf abzielten, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der AASM-Staaten durch Handelserleichterungen und Hilfeleistungen zu fördern.
Was waren die Verträge von Lomé?
Die Verträge von Lomé (Lomé I, II, III und IV) waren Kooperationsabkommen zwischen der EG/EU und den AKP-Staaten, die unter anderem auf die Organisation eines großen Wirtschaftsraumes, finanzielle Unterstützung und die Stabilisierung der Exporterlöse durch STABEX abzielten.
Was ist STABEX?
STABEX ist der Stabilisierungsfonds für landwirtschaftliche Exportprodukte, ein System, das eingerichtet wurde, um Mindereinnahmen der AKP-Staaten bei Exporterlösen oder Ernteausfällen auszugleichen.
Was ist SYSMIN?
SYSMIN ist ein Sonderfonds für Bergbauerzeugnisse, der dazu dient, die nachteiligen Auswirkungen vorübergehender schwerwiegender Störungen des Bergbausektors auf die Einnahmen der AKP-Staaten abzufangen.
Was sind die aktuellen Probleme der AKP-EU-Zusammenarbeit?
Zu den aktuellen Problemen gehören das Ungleichgewicht der Partner, der Wettbewerb durch die Länder des ehemaligen Ostblocks um westliche Investitionen und die Stagnation bzw. der Rückgang der Entwicklungshilfeleistungen.
Was ist der Vertrag von Cotonou?
Der Vertrag von Cotonou, unterzeichnet im Jahr 2000, ist ein Kooperationsabkommen zwischen der EU und den AKP-Staaten, das eine Laufzeit bis 2020 hat und auf eine stärkere Berücksichtigung landesspezifischer Probleme sowie eine schrittweise Integration der AKP-Staaten in die Weltwirtschaft abzielt.
Welche Kritik wird an der EU-AKP-Zusammenarbeit geübt?
Die EU-AKP-Zusammenarbeit wird kritisiert, da der Weg zur gleichberechtigten Entwicklungszusammenarbeit noch lang sei und trotz des Vertrages von Cotonou eine wahre Revolution der Abkommen nicht stattgefunden habe.
- Quote paper
- Stefan Solle (Author), 2000, Die Entwicklungspolitik der EU von Yaounde bis Cotonou, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108127