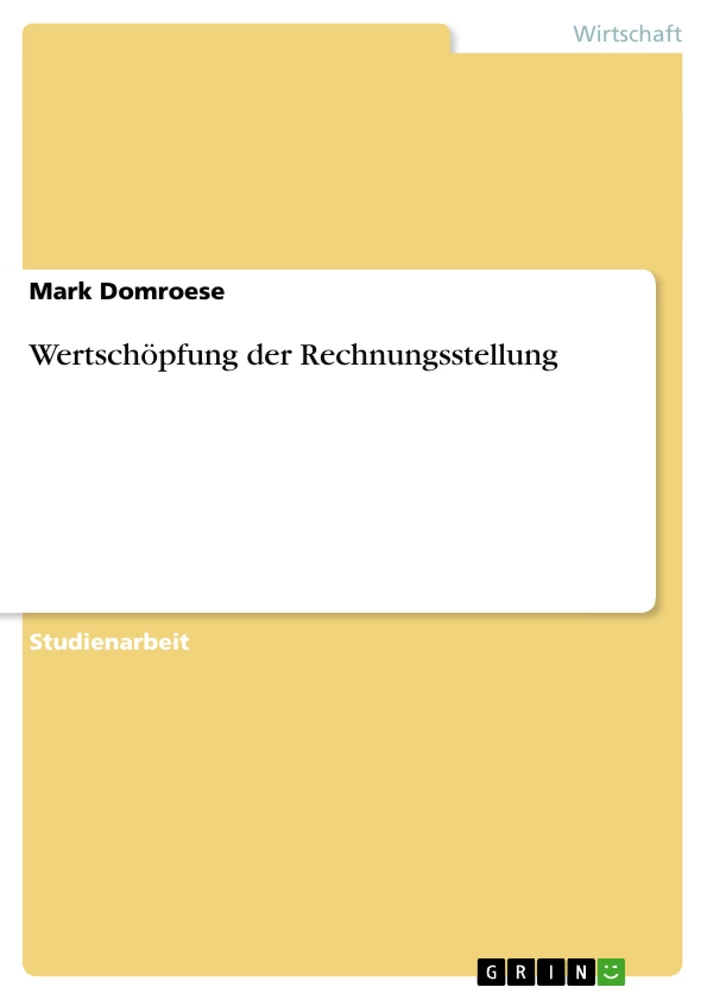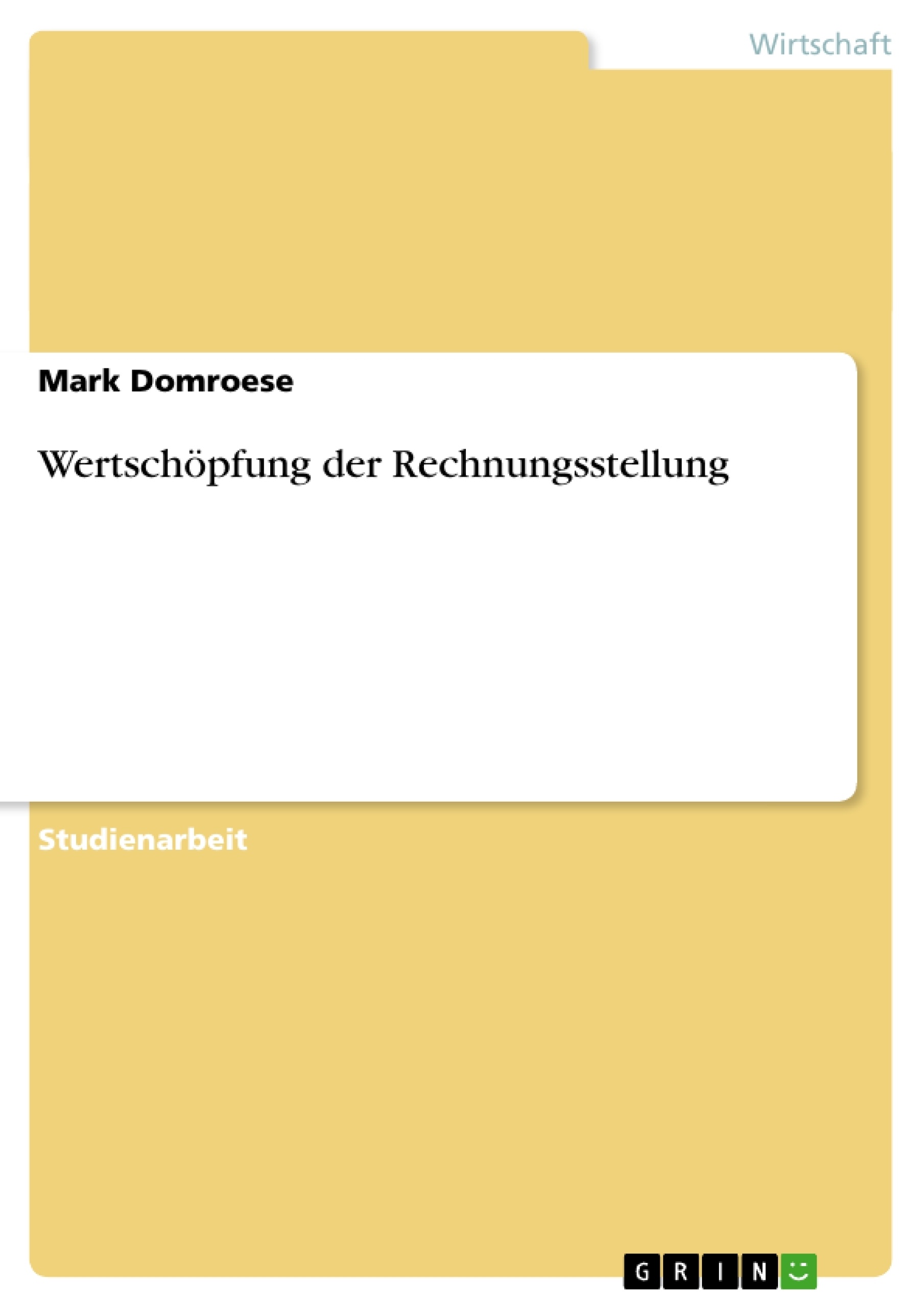Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Problemstellung
2 Optimierungsmöglichkeiten im Rechnungsprozess
2.1 Traditioneller und elektronischer Rechnungsprozess
2.2 Papier, Porto und Postweg
2.3 Kosten- und Zeiteinsparungen durch mehr Effizienz
2.4 Prozessübergreifende Potenziale der elektronischen Rechnungsstellung
3 EBPP-Modelle
3.1 Seller Direct Modell
3.1.1 Überblick
3.1.2 Implikationen für den Rechnungssteller
3.1.3 Implikationen für den Rechnungsempfänger
3.2 Buyer Direct Modell.
3.2.1 Überblick
3.2.2 Implikationen für den Rechnungssteller
3.2.3 Implikationen für den Rechnungsempfänger
3.3 Consolidator Modell
3.3.1 Überblick
3.3.2 Implikationen für Rechnungssteller und Rechnungsempfänger
3.4 Vergleich und Prognose
4 Problemfelder von EBPP
4.1 Ein Chicken-and-Egg-Problem
4.2 Die elektronische Rechnung im deutschen Umsatzsteuerrecht
4.3 Sicherheitsanforderungen an EBPP-Systeme
5 EBPP bei General Electric
5.1 Probleme
5.2 Ziele
5.3 Ansatz
5.4 Resultate
5.5 Fazit
6 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Anzahl Wörter:
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Schematische Darstellung des Seller Direct Modells
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Buyer Direct Modells
Abbildung 3: Schematische Darstellung des Consolidator Modells
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Problemstellung
Zahlreiche Prozesse der Physical Supply Chain wurden in den letzten Jahren mit Hilfe netzbasierter Technologien automatisiert. Die Financial Supply Chain (FSC) hingegen bleibt von derartigen Modernisierungen bis heute weitgehend unberührt. Insbesondere die Rechnungsstellung als Teil der FSC gestaltet sich im Wesentlichen wie seit Jahr- zehnten - als Prozess voller Ineffizienzen und Verzögerungen.
Die Notwendigkeit einer Optimierung des Rechnungsprozesses ergibt sich aus dem wachsenden Konkurrenzdruck in einem globalisierten Wirtschaftsumfeld und den für eine adäquate Rationalisierung idealen Eigenschaften des Mediums Internet. Unterneh- men, die sich zögerlich zeigen, Vorteile aus den technischen Möglichkeiten zu ziehen, könnten bald von fortschrittlicher denkenden Wettbewerbern abgelöst werden.1
Ziel dieser Arbeit ist es, Problemfelder der papierbasierten Rechnungsstellung im Busi- ness-to-Business-Bereich zu diskutieren und Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP) als Alternative vorzustellen. Dazu werden die wichtigsten EBPP-Modelle dar- gestellt, erläutert und verglichen. Außerdem soll auf Probleme bei der Anwendung der elektronischen Rechnungsstellung hingewiesen und kurz ein Beispiel aus der Praxis geschildert werden.
Abschnitt 2 beschäftigt sich mit dem traditionellen Rechnungsprozess und Optimie- rungsmöglichkeiten durch EBPP. In Abschnitt 3 werden drei EBPP-Modelle vorgestellt. Abschnitt 4 spricht Probleme der elektronischen Rechnungsstellung in der Praxis an. In Abschnitt 5 wird schließlich ein Anwendungsbeispiel besprochen.
2 Optimierungsmöglichkeiten im Rechnungsprozess
2.1 Traditioneller und elektronischer Rechnungsprozess
Der traditionelle, papierbasierte Rechnungsprozess ist teuer und zeitaufwändig. Die Rechnung wird typischerweise zunächst vom Lieferanten erstellt, gedruckt, verpackt, kuvertiert und per Post versandt. Nach Eintreffen der Rechnung beim Abnehmer wird sie dort erfasst, mit Bestellung und Transportschein verglichen sowie u. U. weiteren Prüfungen unterzogen. Zur Zahlungsfreigabe folgt die Weiterleitung der Rechnung an
den verantwortlichen Mitarbeiter, der einen entsprechenden Auftrag an die Bank über- mittelt. Schließlich wird die Rechnung archiviert.
Der optimierte elektronische Rechnungsprozess könnte wie folgt aussehen: Nach Ein- gang und Prüfung der Bestellung wird automatisch eine Rechnung erstellt und in digita- ler Form an das Enterprise Resource Planning - System des Empfängers übermittelt, welches im Optimalfall die Rechnung prüft, die Zahlung veranlasst und die Rechnung im Archiv speichert. Die Kommunikation zwischen Rechnungssteller und Rechnungs- empfänger erfolgt bilateral per Electronic Data Interchange (EDI) oder mittels multila- teraler Standards, bspw. Extensible Markup Language. Eine vollständige Automatisie- rung des Prozesses ist bei kleineren oder wiederkehrenden Bestellungen unproblema- tisch, als Alternative kann das EBPP-System bei Handlungsbedarf den zuständigen Mit- arbeiter per E-Mail kontaktieren.
2.2 Papier, Porto und Postweg
Die zwei naheliegendsten Nachteile der Papierrechnung gegenüber der elektronischen sind physischer Natur. Für Papier und Porto werden pro Rechnung durchschnittlich
$1,20 bis $1,25 ausgegeben2 - Kosten, die bei elektronischer Rechnungsstellung nahezu entfallen. Ist die Papierrechnung einmal geschrieben und frankiert, muss sie per Post verschickt werden - Zeit, die bei elektronischer Rechnungsübermittlung eingespart wird.
Kosten und Zeitaufwand sind wichtige Kriterien für den Vergleich von traditionellem mit elektronischem Rechnungsprozess, Materialkosten und Postweg spielen dabei aller- dings eine untergeordnete Rolle. Die Prozesskosten einer Rechnung werden auf mindes- tens das Zehnfache des oben genannten Betrages geschätzt,3 Days Sales Outstanding (DSO) bewegen sich in Größenordnungen von 60 Tagen.4 Direkte Einsparungen von etwa $1,00 pro Rechnung bzw. fünf Tagen DSO5 sind sicherlich bemerkenswert, das ausschlaggebende Potenzial der EBPP-Technologie allerdings ist in einer Effizienzstei-
gerung zahlreicher Arbeitsschritte und Prozesse zu finden, wie im Folgenden erläutert wird.
2.3 Kosten- und Zeiteinsparungen durch mehr Effizienz
Kosten und Zeitaufwand von Papierrechnungen beschränken sich nicht auf Porto und Postweg - die Aufrechterhaltung der traditionellen Rechnungsstellung ist verbunden mit ineffizienten Prozessen und unnötigen Streitigkeiten zwischen Lieferanten und Abneh- mern.
Ein großer Nachteil der Papierrechnung gegenüber ihrem elektronischen Counterpart ist die Existenz von Medienbrüchen. Liegt die Rechnung sowohl am Anfang als auch am Ende des Rechnungsprozesses in elektronischer Form vor, so wird sie im Verlauf mehr- fach manuell eingegeben - bei jeder Lieferung entstehen mindestens 40 Dokumente oder Kopien, die bis zu 60 verschiedene Prozesse durchlaufen können.6
Neben erheblichem Arbeitsaufwand entstehen durch die redundante Eingabe Fehler- quellen, die zu Missverständnissen, Falschlieferungen und Beanstandungen führen, zu- sätzlich gehen oft Rechnungen auf dem Postweg verloren. Bei der Prüfung dieser Vor- gänge muss die Papierrechnung mit u. U. nicht auffindbaren Dokumenten abgeglichen werden - ein aufwändiger Prozess, der die ursprünglichen Kosten der Rechnung mehr als verdoppelt.7
Mit der elektronischen Rechnung sind im Idealfall alle für die Lieferung relevanten In- formationen in einem Dokument gespeichert und in digitaler Form abrufbar.8 Durch die zeitnahe Verfügbarkeit dieses Dokuments sowohl auf Lieferanten- als auch Abnehmer- seite kann die Anzahl der Rechnungsanfragen merklich gesenkt werden. Allein beim Abnehmer entstehen pro telefonischer Anfrage Kosten in Höhe von $10 bis $40.9
Die Vorteile der elektronischen Rechnungsstellung gegenüber der traditionellen ließen sich problemlos verfeinern und vervollständigen. EBPP arbeitet effizienter, bei geringe- ren Kosten und weniger Zeitaufwand. Eine Senkung der Kosten je Auftrag wirkt nicht zuletzt einer Bündelung von Bestellungen und damit einer Verzerrung der Nachfrage
gegenüber den Lieferanten (Bullwhip-Effekt) entgegen.10 Hinsichtlich der für Analysten wichtigen DSO sei darauf hingewiesen, dass bereits eine Senkung der DSO um 5% eine potenzielle Erhöhung des Aktienkurses um 3% zur Folge hat.11
2.4 Prozessübergreifende Potenziale der elektronischen Rechnungsstellung
Die Vorteile einer elektronischen Rechnungsstellung sind nicht auf die Abwicklung von Rechnungen begrenzt, vielmehr ist die elektronische Rechnungsübermittlung an den Empfänger Voraussetzung für einen effizienten Ablauf vieler anderer Prozesse.
Ein wichtiger Punkt ist hier das Working Capital Management. Zusätzlich zu einer Ver- kürzung des Cash-Cycles durch EBPP ist mit der hohen Visibilität des Systems und der Echtzeit-Verfügbarkeit der Rechnungsdaten ein Werkzeug gegeben, welches ein zuver- lässiges Cash Management im Unternehmen ermöglicht. Neben einer damit einherge- henden Float-Verringerung besteht die Möglichkeit, ausstehende Zahlungen nach quali- tativen Merkmalen zu aggregieren und somit die Bonität des Unternehmens besser ein- schätzen zu können.12
Den Lieferanten stehen durch EBPP umfangreiche Fakten über das Kauf- und Zahlver- haltung der Abnehmer zu Verfügung, die sich bei Verhandlungen als nützlich erweisen können.13 In einem Wirtschaftsumfeld, in dem es zunehmend schwierig wird, neue Kunden zu gewinnen und gute zu halten, ist dem Customer Relationship Management (CRM) mit der elektronische Rechnung eine einzigartige Möglichkeit gegeben, Kunden in einem neuen Medium direkt anzusprechen. Dies resultiert auch in einem verbesserten Kundenservice.
Ebenso bietet EBPP enorme Potenziale zur Schaffung von Win-Win-Situationen. Ein effizient gestalteter elektronischer Rechnungsprozess kann sich gleichzeitig für Rech- nungssteller und Rechnungsempfänger als profitabel erweisen.
3 EBPP-Modelle
Im Folgenden werden die für die Rechnungsstellung relevanten Abschnitte der drei we- sentlichen EBPP-Modelle Seller Direct, Buyer Direct und Consolidator analysiert und hinsichtlich ihrer Anforderungen an die Unternehmensprofile verglichen.
3.1 Seller Direct Modell
3.1.1 Überblick
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Seller Direct Modell14 besteht zwischen einem Rechnungssteller und mehreren Rechnungsempfängern eine One-to-Many-Beziehung. Der Rechnungssteller präsentiert die Rechnungen auf einer eigenen Webseite, von der der Rechnungsempfänger seine Rechnungen jederzeit abrufen kann. Meist wird der Empfänger per E-Mail über die Verfügbarkeit einer neuen Rechnung informiert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Schematische Darstellung des Seller Direct Modells
Das Seller Direct Modell ist das älteste und am einfachsten zu implementierende EBPP- System. Charakteristisch für seine Anwendung ist eine starke Marktposition des Rech- nungsstellers, hier kommen u. a. Lieferanten schwer substituierbarer Produkte in Be- tracht. Hoher Marktanteil, großer Kundenkreis bzw. hohe Rechnungsbeträge gehören typischerweise zum Profil des Rechnungsstellers in diesem Modell, welches zunehmend in der Telekommunikationsbranche und der produzierenden Industrie Anwendung fin- det.15
3.1.2 Implikationen für den Rechnungssteller
Das EBPP-System wird im Seller Direct Modell vollständig vom Rechnungssteller kon- trolliert und nach dessen Ansprüchen optimiert. Die Integration mit anderen Unterneh-
mensbereichen, insbesondere der Debitorenbuchhaltung und dem Working Capital Ma- nagement sollte sich demnach als problemlos erweisen.16
Ein großer Vorteil dieses Modells auf Lieferantenseite ist das Zusammentreffen einer direkten Kundenverbindung, eines hohen Informationsstands über den Kunden und ei- ner freien Hand bei der Rechnungsgestaltung. Dem CRM stehen dadurch Möglichkeiten der individualisierten Bannerschaltung offen, so genannte One-to-One Marketing Op- portunities.17 Hierbei ist zu bemerken, dass Anzeigen im Internet ohnehin oft effektiver sind als auf Papier, größtenteils bedingt durch die Click-to-Buy-Features von Bannern.18
Eine Schwierigkeit kann für den Lieferanten trotz starker Marktposition darin liegen, möglichst viele Abnehmer für die Nutzung des EBPP-Systems zu gewinnen. Oft sind hier Anreize nötig, denkbar ist z.B. das Angebot technischer Unterstützung bei der Da- tenintegration.19
Durch den unternehmensinternen Charakter eines EBPP-Systems der beschriebenen Art entstehen für den Rechnungssteller hohe Fixkosten. Zwar können diese durch Beauftra- gung eines Application Service Providers möglicherweise gesenkt werden,20 dennoch interessieren sich aus diesem Grund hauptsächlich große Lieferanten für eine Umset- zung des Seller Direct Modells.
3.1.3 Implikationen für den Rechnungsempfänger
Die einfache Nutzung eines Web-Browsers für den Empfang von Rechnungen stellt insbesondere für kleinere Unternehmen eine kostengünstige Alternative zu EDI dar.
Problematisch für den Rechnungsempfänger ist das aufwändige „Zusammensammeln“ der Rechnungen: Um n Rechnungen von n Rechnungsstellern einsehen zu können, müssen n verschiedene Webseiten besucht werden - eine höchst ineffiziente Methode der Rechnungsbeschaffung.21
[...]
1 Vgl. TradeCard (2002) p. 10; Baker / Laws (2000) p. 8.
2 Vgl. Stefanadis (2002) p. 2; Carrell (2002) p. 2.
3 Vgl. Bünger (2002) p. 2; Emagia (2002a) p. 1.
4 Vgl. Carell (2002) p. 1.
5 Vgl. AFP (2002) p. 2.
6 Vgl. TradeCard (2002) p. 4.
7 Vgl. Bünger (2002) p. 2.
8 Vgl. Alt / Zbornik (2002) S. 191f.
9 Vgl. Carrell (2002) p. 2; IBM (2000) p. 2.
10 Vgl. Bünger (2002) p. 2; Lee et al. (1997) pp. 95f.
11 Vgl. Timme / Williams-Timme (2000) p. 2.
12 Vgl. TradeCard (2002) pp. 3, 5.
13 Vgl. Emagia (2002b) p. 5; Killen (2002) p. 20.
14 Auch Biller Direct.
15 Vgl. NACHA (2001) p. 5; AFP (2002) pp. 1f.
16 Vgl. Abschnitte 2.3, 2.4.
17 Vgl. Emery (2001) p. 1; Him (2001) p. 2; IBM (2000) p. 3; SAP (2001) p. 1.
18 Vgl. Stefanadis (2002) p. 2.
19 Vgl. Abschnitt 3.1.3; NACHA (2001) p. 6.
20 Vgl. NACHA (2001) p. 7; Andreeff et al. (2001) p. 5.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine Analyse von Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP)-Modellen im Business-to-Business-Bereich und diskutiert Optimierungsmöglichkeiten im Rechnungsprozess.
Was ist EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment)?
EBPP steht für Electronic Bill Presentment and Payment und bezieht sich auf die elektronische Präsentation und Bezahlung von Rechnungen, im Gegensatz zum traditionellen papierbasierten Verfahren.
Welche Vorteile bietet EBPP gegenüber der traditionellen Rechnungsstellung?
EBPP bietet zahlreiche Vorteile, darunter Kosten- und Zeiteinsparungen durch Effizienzsteigerung, Reduzierung von Medienbrüchen, weniger Fehlerquellen, schnellere Verfügbarkeit von Rechnungsdaten, verbesserte Kundenbeziehungen und optimiertes Working Capital Management.
Welche EBPP-Modelle werden in diesem Dokument behandelt?
Die drei wesentlichen EBPP-Modelle, die analysiert werden, sind das Seller Direct Modell, das Buyer Direct Modell und das Consolidator Modell.
Was ist das Seller Direct Modell?
Im Seller Direct Modell präsentiert der Rechnungssteller (Seller) die Rechnungen auf einer eigenen Webseite, von der der Rechnungsempfänger (Buyer) sie abrufen kann. Es besteht eine One-to-Many-Beziehung zwischen Rechnungssteller und Rechnungsempfängern.
Was sind die Implikationen des Seller Direct Modells für den Rechnungssteller?
Der Rechnungssteller hat die volle Kontrolle über das EBPP-System und kann es nach seinen Ansprüchen optimieren. Er profitiert von einer direkten Kundenverbindung und kann CRM-Maßnahmen wie individualisierte Bannerschaltung durchführen. Allerdings entstehen hohe Fixkosten.
Was sind die Implikationen des Seller Direct Modells für den Rechnungsempfänger?
Der Empfang von Rechnungen über einen Web-Browser ist kostengünstig, insbesondere für kleinere Unternehmen. Problematisch ist jedoch das aufwändige "Zusammensammeln" der Rechnungen von verschiedenen Webseiten.
Welche Problemfelder der elektronischen Rechnungsstellung werden angesprochen?
Das Dokument thematisiert das Chicken-and-Egg-Problem (dass beide Seiten gleichzeitig EBPP nutzen müssen), die rechtlichen Aspekte der elektronischen Rechnung im deutschen Umsatzsteuerrecht und die Sicherheitsanforderungen an EBPP-Systeme.
Wird ein Anwendungsbeispiel für EBPP gegeben?
Ja, in Abschnitt 5 wird ein Anwendungsbeispiel von EBPP bei General Electric besprochen.
Was sind Days Sales Outstanding (DSO) und warum sind sie wichtig?
Days Sales Outstanding (DSO) ist eine Kennzahl, die angibt, wie lange es durchschnittlich dauert, bis ein Unternehmen seine Forderungen begleicht. Eine Senkung der DSO kann sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.
Was sind die Optimierungsmöglichkeiten im Rechnungsprozess?
Die Optimierungsmöglichkeiten bestehen in der Umstellung von papierbasierten Prozessen auf elektronische, um die Kosten und den Zeitaufwand zu minimieren und die Effizienz zu steigern.
- Quote paper
- Mark Domroese (Author), 2002, Wertschöpfung der Rechnungsstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108792