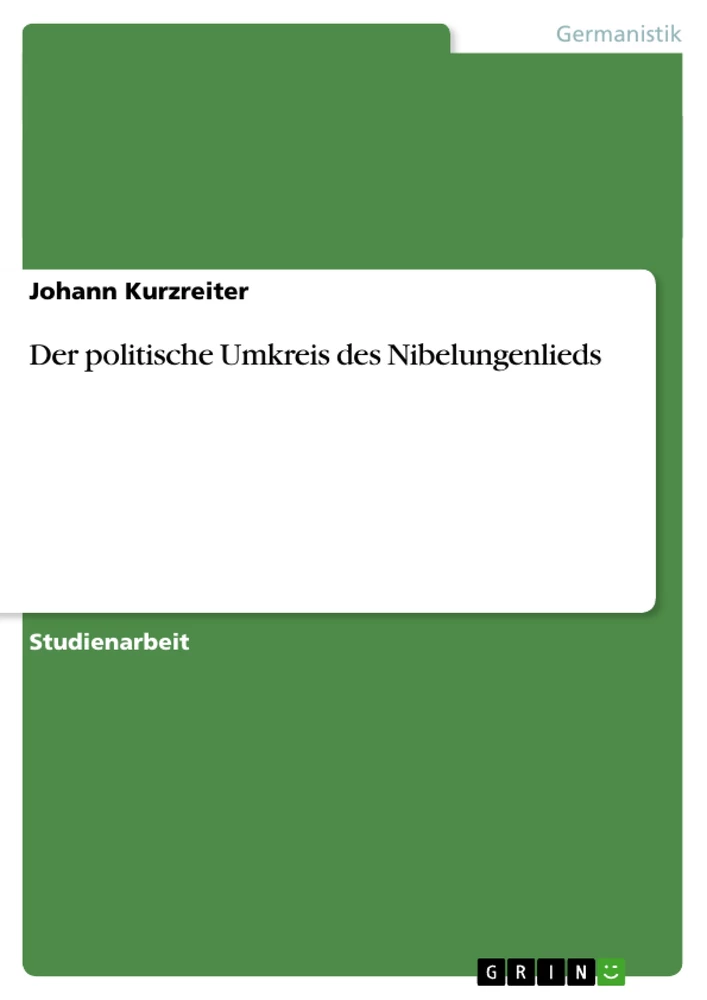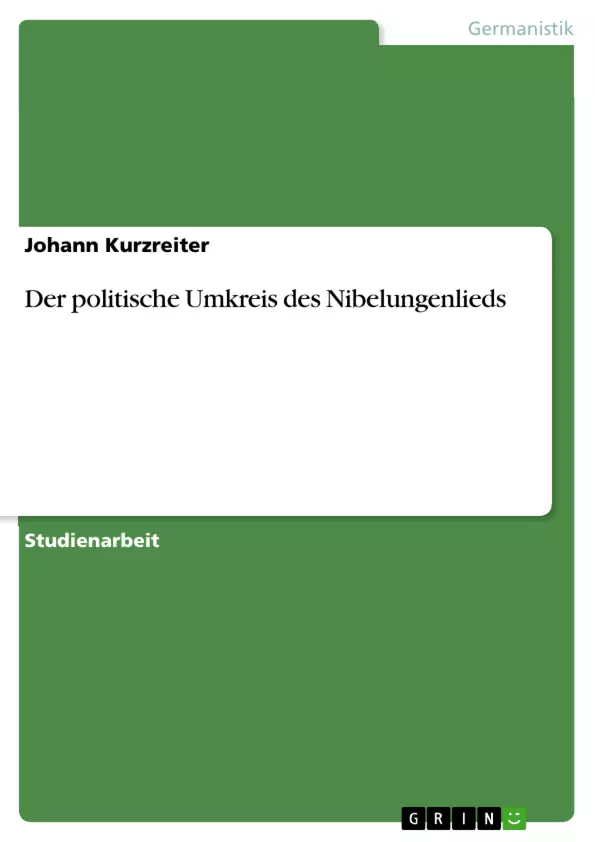Wir haben Grund zu der Annahme, dass dem Dichter des Nibelungenliedes bei dessen Gestaltung politische Ereignisse und Entwicklungen zur Zeit der Abfassung (um 1200) vor Augen standen.
Das Nibelungenlied entstand zu einer Zeit, die von politischen Wirren im Reich geprägt war. Am Beginn stand hierbei der Tod Kaiser Heinrich VI. am 28.9.1197. Die Zeit davor, die Regierung Kaiser Friedrich I. Barbarossas (1152-1190), erschien vielen Zeitgenossen glanzvoll und ruhmreich und als ein Höhepunkt des Reiches und kaiserlicher Herrschaft. Sein Sohn Heinrich VI. (1190-1197) sah sich nach einem ersten politischen Erfolg, seiner Kaiserkrönung 1191, in den Jahren 1192-94 einer heftigen Fürstenopposition im Reich gegenüber, die von dem Welfen Heinrich dem Löwen, dem alten Widersacher seines Vaters, angeführt wurde. Dahinter stand der alte Gegensatz zwischen den beiden Familien der Staufer und der Welfen. Der Vater Heinrichs des Löwen, Heinrich der Stolze, Herzog von Bayern und Sachsen, war 1137/38 im Kampf um die deutsche Königskrone dem Staufer Konrad, Herzog von Schwaben, unterlegen. Zwischen den Söhnen der beiden, Friedrich Barbarossa und Heinrich dem Löwen kam es 1156 zur Aussöhnung, die Welfen erhielten Bayern zurück (das die Babenberger hergeben mussten, dafür wurde Österreich zum Herzogtum erhoben). Die Aussöhnung war nicht von Dauer, 1174 verweigerte Heinrich der Löwe dem Kaiser die Heerfolge nach Italien. Dazu traten divergierende Besitzinteressen beider Familien in Schwaben. Nach seiner Rückkehr aus Italien führte Barbarossa einen Prozess gegen Heinrich, an dessen Ende dieser geächtet und ihm durch Fürstenspruch auch alle Reichslehen aberkannt wurden (1180). Angesichts des zur Durchsetzung des Urteils gegen Heinrich eröffneten Reichskriegs fielen seine Anhänger von ihm ab, diesem blieb nur die Unterwerfung und Verzichtserklärung. Anschließend musste er für drei Jahre in die Verbannung nach England zu seinem Schwiegervater König Heinrich II. gehen.1
1 Lechner, Karl: Die Babenberger. Markgrafen und Herzoge von Österreich 976-1246. Wien/Köln/Weimar: Böhlau 6.Aufl. 1996, S.172
INHALT
Die politischen Verhältnisse im Reich um 1200
Die Burgunden als Spiegelbild der Staufer?
Andere zeitgeschichtliche Bezüge im Nibelungenlied
Beziehungen zwischen den Babenbergerherzögen und dem Bischof von Passau
Das Nibelungenlied als Spiegel rechts- und sozialhistorischer Entwicklungen der Zeit?
Bibliographie
Die politischen Verhältnisse im Reich um 1200
Wir haben Grund zu der Annahme, dass dem Dichter des Nibelungenliedes bei dessen Gestaltung politische Ereignisse und Entwicklungen zur Zeit der Abfassung (um 1200) vor Augen standen.
Das Nibelungenlied entstand zu einer Zeit, die von politischen Wirren im Reich geprägt war. Am Beginn stand hierbei der Tod Kaiser Heinrich VI. am 28.9.1197. Die Zeit davor, die Regierung Kaiser Friedrich I. Barbarossas (1152-1190), erschien vielen Zeitgenossen glanzvoll und ruhmreich und als ein Höhepunkt des Reiches und kaiserlicher Herrschaft. Sein Sohn Heinrich VI. (1190-1197) sah sich nach einem ersten politischen Erfolg, seiner Kaiserkrönung 1191, in den Jahren 1192-94 einer heftigen Fürstenopposition im Reich gegenüber, die von dem Welfen Heinrich dem Löwen, dem alten Widersacher seines Vaters, angeführt wurde. Dahinter stand der alte Gegensatz zwischen den beiden Familien der Staufer und der Welfen. Der Vater Heinrichs des Löwen, Heinrich der Stolze, Herzog von Bayern und Sachsen, war 1137/38 im Kampf um die deutsche Königskrone dem Staufer Konrad, Herzog von Schwaben, unterlegen. Zwischen den Söhnen der beiden, Friedrich Barbarossa und Heinrich dem Löwen kam es 1156 zur Aussöhnung, die Welfen erhielten Bayern zurück (das die Babenberger hergeben mussten, dafür wurde Österreich zum Herzogtum erhoben). Die Aussöhnung war nicht von Dauer, 1174 verweigerte Heinrich der Löwe dem Kaiser die Heerfolge nach Italien. Dazu traten divergierende Besitzinteressen beider Familien in Schwaben. Nach seiner Rückkehr aus Italien führte Barbarossa einen Prozess gegen Heinrich, an dessen Ende dieser geächtet und ihm durch Fürstenspruch auch alle Reichslehen aberkannt wurden (1180). Angesichts des zur Durchsetzung des Urteils gegen Heinrich eröffneten Reichskriegs fielen seine Anhänger von ihm ab, diesem blieb nur die Unterwerfung und Verzichtserklärung. Anschließend musste er für drei Jahre in die Verbannung nach England zu seinem Schwiegervater König Heinrich II. gehen.[1]
Der Konflikt zwischen Kaiser Heinrich VI. und der Fürstenopposition wurde durch einen Ausgleich beendet, der durch die Gefangennahme des englischen Königs Richard Löwenherz, des Schwagers Heinrichs des Löwen, erleichtert wurde. Löwenherz musste sich formal Heinrich VI. unterwerfen, indem er sein Königreich vom Kaiser zu Lehen nahm. Das Lösegeld, das die Engländer für ihren König bezahlen mussten, stärkte die wirtschaftliche Grundlage von Heinrichs Macht und ermöglichte ihm den nächsten politischen Erfolg, nämlich die Gewinnung des normannischen Königreiches in Süditalien und Sizilien, ein Akt, der durch die Heirat Heinrichs mit der Erbin dieses Reiches, Konstanze, 1186 vorbereitet worden war.[2]
Ein Kreuzzug sollte die Krönung dieser Erfolge sein, doch mitten in den Vorbereitungen starb Heinrich 32-jährig in Messina (Sizilien). Der Geschichtsschreiber Otto von St. Blasien rühmte den Verstorbenen mit folgenden Worten: “Sein Tod möge dem Volke der Deutschen und allen Völkern Germaniens in Ewigkeit beklagenswert sein! Denn er hat sie berühmt gemacht durch die Schätze der anderen Länder und hat Schrecken vor ihnen allen Völkern im Umkreis durch seine kriegerische Tapferkeit eingeflößt.“[3]
Nachdem also Heinrich VI. die Macht der Staufer auf einen Höhepunkt geführt hatte, stürzte sein Tod die Herrschaft dieser Familie und damit auch die deutsche Königsmacht in eine schwere Krise. Sein Sohn Friedrich war zu diesem Zeitpunkt noch keine drei Jahre alt. Er war schon im Dezember 1196 zum römischen König gewählt und damit zum Nachfolger seines Vaters designiert worden. Seine Mutter Konstanze erreichte 1198 Friedrichs Thronbesteigung in Sizilien. Seinem Onkel Herzog Philipp von Schwaben war es aber unmöglich, ihn aus Süditalien zur Krönung zum deutschen König nach Aachen zu holen. Angesichts dessen und der Bestrebungen des Erzbischofs von Köln, einen eigenen Kandidaten auf den Thron zu setzen, entschloss sich Philipp nach einigem Zögern, dem Drängen der Parteigänger der Staufer nachzugeben und sich selbst zum König erheben zu lassen. Im März 1198 erfolgte in Thüringen seine Wahl, am Ostertag dieses Jahres (28.März) ging er zu Worms bereits unter der Krone und bekundete damit dem Reich sein Königtum. Eine Gruppe um den Kölner Erzbischof wählte im Juni Otto von Braunschweig, einen Sohn Heinrichs des Löwen, zum König und krönte ihn im Juli in Aachen, also am legitimen Krönungsort, aber nicht mit den richtigen Insignien, denn diese waren in den Händen der staufischen Partei. Philipp wurde im September in Mainz mit der echten Krone des Reiches gekrönt. Diese verhängnisvolle Doppelwahl war der Auftakt zu einem Machtkampf im Reich, der sich über mehr als eineinhalb Jahrzehnte hinzog und der letztlich nur die Fortsetzung des alten staufisch-welfischen Konflikts war. Der Machtbereich Philipps von Schwaben lag mehr im Süden des Reiches, derjenige Ottos von Braunschweig mehr im Norden.[4] Otto konnte zunächst die Unterstützung durch Papst Innozenz III. gewinnen, der über Philipp und seine Anhänger den Bann verhängte. 1203/04 setzte jedoch ein politischer Umschwung im Reich ein. Die Anhänger Ottos begannen abzufallen, Verhandlungen zwischen der Kurie und Philipp, der vom Bann gelöst wurde, begannen. 1208 wurde in Rom die Anerkennung des Staufers beschlossen, dieser fiel jedoch im selben Jahr einem durch private Rache motivierten Mordanschlag Ottos von Wittelsbach zum Opfer. Nun wurde Otto von Braunschweig allgemein als deutscher König anerkannt und 1209 sogar vom Papst zum Kaiser gekrönt.[5]
Seine Herrlichkeit währte aber nicht lange, 1214 musste er sich in der Schlacht von Bouvines dem Staufer Friedrich II., dem bereits erwähnten Sohn Heinrichs VI. und Neffen seines Widersachers Philipp, geschlagen geben. Damit war der Machtkampf zwischen Staufern und Welfen endgültig entschieden.
Die Burgunden als Spiegelbild der Staufer?
Wir finden in der vierten und fünften Aventiure des Nibelungenliedes eine Episode, die man als Anspielung auf den Thronstreit zwischen Philipp und Otto interpretieren kann. Diese Episode handelt von dem Krieg, den der mit seinem Bruder, König Liudegast von Dänemark, verbündete Fürst oder König Liudeger von Sachsen gegen die Burgundenkönige führt. Diese Geschichte hat vermutlich der Dichter dem Stoff der Nibelungensage hinzugefügt. Die historische Grundlage dafür wäre das Bündnis Ottos von Braunschweig mit seinem Schwager, König Knut VI. von Dänemark, gegen Philipp von Schwaben im Jahre 1200. Die Dänen marschierten damals an der Eider auf und eroberten Nordalbingien mit Lübeck. Ihr Verbündeter Otto musste diese Eroberungen durch eine Doppelverlobung 1202 in Hamburg anerkennen.[6] Als literarische Quelle für diese Episode könnte auch eines der so genannten Empörer-Gesten, “Renaud de Montauban“, gedient haben. In einer Episode darin fallen Sachsen ins Reich Karls des Großen ein und belagern Köln, werden aber von Karls Neffen Roland zurückgeschlagen. Allerdings findet sich die Allianz zwischen Sachsen und Dänen nicht in diesem Epos. Dieses Motiv kommt zwar in anderen Empörer-Gesten vor (z.B. im “Chanson des Saisnes“, dem Sachsenlied), trotzdem bleibt immer noch die Herkunft des Namens Liudeger ungeklärt. Hier hilft uns ein Blick in die deutsche Geschichte weiter. Liudeger war der ursprüngliche Name des Sachsenherzogs Lothar von Supplinburg, der 1125 zum deutschen König gewählt wurde und aus diesem Anlass seinen Namen in den fränkischen Namen Lothar änderte. Er gewann die Wahl gegen Herzog Friedrich von Schwaben aus der Familie der Staufer. Daraus entwickelte sich die Rivalität zwischen den Staufern und den Welfen. Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig waren Nachkommen der Kontrahenten von 1125. Der Name Liudeger sollte möglicherweise den Hörern des Nibelungenliedes signalisieren, dass der Krieg zwischen den Sachsen und den Burgunden ein Spiegelbild des staufisch-welfischen Konflikts war. Offen bleibt die Frage, welchen Welfen der Nibelungendichter mit Liudeger von Sachsen meinte. Vielleicht war es Heinrich der Löwe. Dafür spricht, dass dieser Herzog von Sachsen war, wie Liudeger im Epos besiegt wurde und ebenfalls bereits mit dem Dänenkönig Knut VI. verbündet war, dem er 1171 seine Tochter Gertrud zur Frau gab. Dagegen spricht allerdings der zeitliche Abstand zur Entstehung des Nibelungenliedes von rund drei Jahrzehnten. Zudem war Heinrich der Löwe 1195 gestorben. So erscheint es wahrscheinlicher, dass der Nibelungendichter bei der Episode des Sachsenkriegs im Epos die im Jahr 1200 von König Otto erneuerte Allianz der Welfen mit dem dänischen König vor Augen hatte.[7]
Wenn der Dichter dies beabsichtigt hat, wären die Wormser Könige des Epos die Staufer der Realität. Dagegen spricht auf den ersten Blick, dass die Staufer keine Rheinländer oder Burgunden waren, sondern Schwaben. Doch spielte die Stadt Worms in der Geschichte der Stauferherrschaft eine wichtige Rolle. Worms war der häufigste Aufenthaltsort von Friedrich I. Barbarossa und Heinrich VI. im Reich. Friedrich Barbarossa hielt nach der Rückkehr von seiner Kaiserkrönung 1155 in Worms einen großen Hoftag ab. Heinrich VI. veranstaltete in Worms die Schwertleite seines Bruders Konrad. In Worms und Speyer wurden die Verträge über die Freilassung von Richard Löwenherz ausgehandelt und abgeschlossen. Auf den in der Nähe von Worms gelegenen Trifels, der im Mittelalter als Teil des Wasgenwaldes galt, ließ Heinrich VI. den in Palermo erbeuteten Hort der Normannenkönige bringen. Philipp ging, wie erwähnt, zu Ostern 1198 in Worms unter der Krone. Der Dichter des Nibelungenlieds hat zwar “maere“ aus uralten Zeiten erzählt, aber das rheinische Ambiente musste bei den Hörern um 1200 den Eindruck hervorrufen, die Geschichte von Siegfried und Kriemhild spiele im Kernraum der staufischen Macht, in Worms. Auch ein Konnex zwischen den Staufern und Burgund lässt sich herstellen. Friedrich Barbarossa war mit Beatrix von Burgund verheiratet. Seine Kinder aus dieser Ehe, darunter Heinrich VI. und Philipp, waren somit mütterlicherseits burgundischer Herkunft. Barbarossa bekundete der burgundischen Komponente seiner Herrschaft seine Reverenz, indem er sich 1178 in Arles krönen ließ. Beatrix wurde wenig später in Vienne mit dem “diadema Burgundiae“ gekrönt.[8] Die Geschichte vom Nibelungenhort haben die Zeitgenossen wahrscheinlich auf Kaiser Heinrich VI. und seinen Normannenschatz bezogen. Im Nibelungenlied heißt es, Gold und Edelsteine seien auf zwölf Wagen zum Schiff gefahren worden, die jeweils zwölfmal hätten beladen werden müssen (Str.1122). Das wären insgesamt 144 Fuhren. Der Normannenhort soll von 150 Maultieren nach Norden getragen worden sein.[9] Otto von St. Blasien berichtet in seiner Chronik, Heinrich VI. habe mit dem Lösegeld für Richard Löwenherz Söldner angeworben, mit denen er das normannische Königreich erobern wollte. Kriemhild wirbt mit dem Gold der Nibelungen, das einst ja auch Lösegeld war, “vil unkunden recken“ (Str.1127), von denen Hagen vermutet, sie könnte sie gegen ihn und ihre Brüder einsetzen.[10]
Der Dichter lässt einen Streit um eine kaiserliche beziehungsweise kaisergleiche Stellung zum Anlass der Tragödie werden. Kriemhild sagt zu Brünhild: “ich han einen man, / daz elliu disiu riche ze sinen handen solden stan.“ Die Herrschaft über “elliu riche“ ist in der deutschen Dichtung eine geläufige Formel zur Umschreibung kaiserlicher Herrschaft. Man kann daher annehmen, dass der Dichter in eigenständiger Weise das Kaisertum ins Spiel brachte, es erscheint nur in verhüllter Form. Aber ein Gebildeter um 1200 konnte Kriemhilds Worte entsprechend deuten: Siegfried soll Herr über Reiche, soll Kaiser sein. Anders gesagt: Der Anspruch auf eine kaisergleiche Stellung ist vom Dichter ins Zentrum der Schlüsselszene des gesamten Epos gestellt worden.[11]
Ein zusätzliches Indiz dafür, dass die Staufer das reale Vorbild für die Burgundenkönige waren, findet sich in der “Klage“, dem Werk, das an das Nibelungenlied anschließt: Als Swämmel die Nachricht vom Untergang der Burgunden verkündet, herrschen zunächst Trauer und Verzweiflung bis Sindolt, der Schenk, Brünhild mahnt, sie solle ihre Klagen mäßigen, sie würde die Krone weiter tragen und ihr Sohn solle binnen kurzem gekrönt werden (Str.4090). Dieser muss beim Tod seines Vaters mindestens 20 Jahre alt sein. Philipp von Schwaben war, als er wie der junge Burgundenkönig zu Worms unter der Krone ging, 21 oder 22 Jahre alt. In beiden Fällen handelt es sich um einen feierlichen Herrschaftsantritt, Philipp verlangte von allen den Treueid, in der “Klage“ werden Lehen vergeben, was mit dem Treueid verbunden war. Es bestehen also offenkundige Analogien zwischen dem realen Vorgang und dem Geschehen in der Dichtung.[12]
Es sei noch ein letzter Hinweis genannt, nämlich das Minnegespräch zwischen Ute und Kriemhild in der ersten Aventiure. Dieses ist eine Nachbildung einer entsprechenden Szene in Heinrich von Veldekes “Eneide“. Der Dichter des Nibelungenliedes zitiert (Str.17) Begriffe aus einem bestimmten Teil der “Eneide“, aus der so genannten zweiten Stauferpartie. Diese Begriffe sind: ere, liute, hohgezit, zŒaller jungeste, dazu kommen “liebe“ und “leide“, die beiden zentralen Begriffe aus der Minnelehre von Lavinias Mutter. Die entsprechende Strophe im Nibelungenlied ist eine Replik auf Heinrich von Veldekes Preislied zu dem berühmten Hoffest Friedrich Barbarossas in Mainz 1184 und setzt gegen Veldekes Vertrauen in die Zukunft der Staufer die Gewissheit, dass “der von Macht, Glanz und Ruhm besessenen Gesellschaft der Gegenwart nur der Tod als letztes und sicheres Ziel gesetzt war.“[13] Auf Grund all dieser Indizien können wir annehmen, dass der Dichter das Nibelungenlied als Parabel zur Krise der Stauferherrschaft ab 1197/98 verstanden wissen wollte. Wir können auch davon ausgehen, dass das gebildete Publikum der damaligen Zeit, wenn es die Geschichte vom Untergang der Burgunden hörte, an das Schicksal der Staufer dachte.[14]
Andere zeitgeschichtliche Bezüge im Nibelungenlied
Es fällt auf, dass sich im Nibelungenlied Vasallen des öfteren Eigenmächtigkeiten gegenüber dem König erlauben. Wenn Vasallen sich nicht wiederholt über die Absichten ihres Herren hinwegsetzten, sie überspielten oder zum Handeln gegen ihre eigenen Wünsche zwängen, würden die beiden Katastrophen in dem Epos, die Ermordung Siegfrieds und der Untergang der Burgunden am Hunnenhof, nicht eintreten. Unter diesen eigenmächtigen Vasallen ist in erster Linie Hagen zu nennen, im zweiten Teil des Epos aber auch Volker. Aber auch Siegfrieds Stellung ist weniger als die eines bloßen Gefolgsmannes, sondern mehr als die eines Verbündeten, eines Juniorpartners zu charakterisieren. Neben diesen starken Vasallen erscheint König Gunther als schwache Figur, die auf ihre Hilfe angewiesen ist oder sich von ihnen treiben lässt. Dem Nibelungendichter könnte bei der Gestaltung dieser Verhältnisse und Charaktere die politische Realität seiner Zeit vor Augen gestanden haben.[15] Die Figur des schwachen Königs erinnert an die Schwäche des deutschen Königtums während des staufisch-welfischen Thronstreits. Die eigentlich Mächtigen waren die Reichsfürsten, auf deren Unterstützung in dem Konflikt sowohl Philipp von Schwaben als auch Otto von Braunschweig angewiesen waren. Figuren wie Siegfried oder Hagen erscheinen demnach in ihrem Verhältnis zu König Gunther wie Reichsfürsten um 1200. Darüber hinaus sehen wir hier die Anfänge einer Entwicklung, die sich im 13. Jahrhundert fortsetzte, nämlich die zunehmende Schwäche des deutschen Königtums und seine Abhängigkeit von den Reichsfürsten, die die eigentlichen Inhaber der Macht in ihren Territorien wurden. König Philipp war möglicherweise das reale Vorbild für Gunther im Nibelungenlied. Neben der schon geschilderten möglichen Entsprechung Staufer - Burgunden finden sich Parallelen in den Charaktereigenschaften. Wie Gunther war Philipp schwach, es fehlte ihm das notwendige Maß an Härte und Durchsetzungsvermögen, um die Probleme und Widerstände, denen er sich gegenübersah, zu meistern.[16] Wie Gunther des Öfteren von seinen Vasallen zum Handeln getrieben wird, so wurde Philipp, wie geschildert, von Parteigängern der staufischen Dynastie unter den deutschen Fürsten dazu bewogen, sich zum König erheben zu lassen.
In Str.1354 wird ein Buhurt in Tulln beim Empfang Kriemhilds durch ihren künftigen Gemahl Etzel geschildert. Hierbei ist von “tiuschen gesten“ die Rede. Dies war im mittelalterlichen Ungarn in der lateinischen Form “hospites Teutonici“ ein juristischer Begriff, der die deutschen Siedler bezeichnete, die von den ungarischen Königen ins Land gerufen worden waren. Nach dem Tod König Belas III. 1196 kam es zu einem Thronstreit zwischen seinem älteren Sohn Emmerich, der ihm in der Herrschaft nachfolgte, und dessen jüngerem Bruder Andreas. Dieser wurde von den deutschen Siedlern und von Herzog Leopold VI. von Österreich, dessen Mutter Helene eine Schwester Belas III. gewesen war, unterstützt. Leopold ließ in dem Konflikt, der im Verlauf des Jahres 1199 ein auch für das Grenzgebiet des Reiches gefährliches Ausmaß annahm, Truppen aus Österreich und der Steiermark an der Seite von Andreas kämpfen. Die “hospites Teutonici“ wurden durch ihre aktive Parteinahme in dem Thronstreit zu einem politischen Problem, das auch im Reich, vor allem im Südosten, Aufsehen erregte. Nun unternahm Erzbischof Konrad von Mainz, der sich schon im Konflikt zwischen Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig eifrig, aber erfolglos als Vermittler versucht hatte, auch im ungarischen Thronstreit einen Vermittlungsversuch. Er reiste im Frühjahr 1200 in Begleitung von Bischof Wolfger von Passau nach Wien, wo er an der Schwertleite Herzog Leopolds teilnahm, die zu Pfingsten am 28.Mai stattfand. Es ist nicht sicher, ob Konrad nach Ungarn reiste oder ob er sich von Wien aus um eine Verständigung zwischen den beiden Brüdern bemühte, jedenfalls war seine Vermittlung von Erfolg gekrönt, wenn auch nur für einige Jahre. Emmerich starb 1204, sein Sohn Ladislaus wurde als Kind zum König erhoben. Sein Onkel Andreas vertrieb ihn jedoch und bestieg den Thron. Ladislaus floh mit seiner Mutter nach Wien, wo er bald starb.[17]
In den Strophen 1174 und 1302 werden die Bayern als ein Volk von Straßenräubern geschildert. Auch hierzu finden wir einen Bezug zu einem Ereignis von damals. Erzbischof Konrad von Mainz starb auf der Rückreise von dem erwähnten Besuch in Wien. Sein Neffe Herzog Ludwig I. von Bayern nützte diese Gelegenheit schamlos aus und raubte dem Toten die kostbaren Pontifikalgewänder und andere Pretiosen. Diese Tat muss damals einiges Aufsehen erregt haben, in Mainz wurde noch die Ermordung Ludwigs im Jahre 1231 als späte Strafe Gottes für diesen Frevel gedeutet. Bischof Wolfger von Passau, der seinen Mainzer Kollegen auch auf der Rückreise begleitete, dürfte Augenzeuge der Tat gewesen sein.[18] Vielleicht trifft dies auch auf den Dichter des Nibelungenlieds zu, denn er könnte sich ja im Gefolge seines mutmaßlichen Dienstherrn Bischof Wolfger befunden haben. Eine weitere Erklärung für die Bayernfeindlichkeit, die in den beiden Strophen zum Ausdruck kommt, könnte darin liegen, dass Bischof Wolfger von Passau einmal in eine erbitterte Fehde mit den bayerischen Grafen von Ortenburg verwickelt war. Da diese jeden Kompromiss ablehnten und Plünderungen und Gewalttaten verübten, ging der Bischof hart gegen sie vor und zerstörte ihre Burg Graben am Inn.[19]
Ein weiterer zeitgeschichtlicher Bezug im Nibelungenlied ist die Erwähnung des Küchenmeisters Rumolt (Str.1465-68). Dieser gibt den Fürsten den Rat, es sich lieber zu Hause gut gehen zu lassen als ins ferne Hunnenland einem ungewissen Schicksal entgegen zu ziehen. Angesichts der sehr niedrigen sozialen Stellung eines Kochs im Mittelalter erscheint es ausgeschlossen, dass ein solcher sich in eine Beratung von Königen hätte einmischen und ihnen Ratschläge hätte geben dürfen. Wenn Rumolt “kuchenmeister“ genannt wird (Str.10, 777, 1465), kann damit nur das erbliche Hofamt des Küchenmeisters gemeint sein. Dieses wird dadurch erhöht, dass “Rumolt der kuchenmeister“ nach “Hunolt dem truchsess“ und “Sindolt dem schenken“ genannt wird (Str.777). Nun wurde das Hofamt des Küchenmeisters erst zur Zeit der Entstehung des Nibelungenliedes um 1200 geschaffen. Bis dahin gab es nur die erblichen Hofämter Marschall, Schenk, Truchsess und Kämmerer, die stellvertretend die Funktionen der vier weltlichen Kurfürsten als Erzmarschall, Erzschenk, Erztruchsess und Erzkämmerer ausübten. König Philipp übertrug 1198 das bis dahin von den Rothenburgern verwaltete Hofamt des Reichstruchsess an die Familie der von Waldburg. Seit 1199 machten die Rothenburger Ansprüche auf das Amt des Truchsess geltend. Um diesen Streitereien ein Ende zu machen, schuf Philipp als Ersatz ein ganz neues Hofamt, das des Küchenmeisters (als eine Art Abzweigung vom Truchsess). Dieses war das erste Hofamt, das nicht mit den Erzämtern der Kurfürsten korrespondierte, und es war an anderen Höfen unbekannt. In einer Urkunde Philipps vom 23. Juli 1202 oder 25. Juli 1205 (das Datum ist nicht sicher) wird ein Heinrich von Rothenburg “magister coquine“ genannt. Diese Urkunde ist der erste Beleg für die Existenz des Küchenmeisteramtes am Königshof. In einer Urkunde des Babenbergerherzogs Leopold VI. vom 28. August 1201 für das Kloster Admont wird in der Zeugenliste neben anderen der “magister coquine“ des Herzogs genannt. Wenn man davon ausgeht, dass ein solches Amt nach dem Vorbild am Königshof geschaffen wurde (und nicht umgekehrt), muss König Philipp dieses Amt schon vorher errichtet haben. Die Schaffung dieses neuen Hofamtes erregte angesichts der traditionell sehr niederen Stellung des Kochs in der höfischen Gesellschaft offensichtlich großes Aufsehen. Daraus und aus der Aktualität erklärt sich die Einfügung des Küchenmeisteramtes in das Nibelungenlied. Zugleich ironisierte es der Dichter: Als die Fürsten abreisen, lassen sie Rumolt als Reichsverweser zurück.[20]
Beziehungen zwischen den Babenbergerherzögen und dem Bischof von Passau
Wien und Passau sind zwei Städte, die im Nibelungenlied eine Rolle spielen. In Passau residiert Bischof Pilgrim, der Oheim Kriemhilds und ihrer drei Brüder, in Wien findet die Hochzeit zwischen Kriemhild und Etzel statt. Daneben kennt der Dichter viele kleinere Orte an der Donau. Auf den Reisen durch das Donautal, die im Nibelungenlied geschildert werden, werden fast nur Orte genannt, die im Besitz des Bistums Passau waren. Für die Erwähnung von Wien und Passau gibt es eigentlich keine zwingenden Gründe. Bischof Pilgrim hat für den Verlauf der Handlung keine Bedeutung, zudem scheint diese Figur nicht vom Dichter aus der Nibelungensage übernommen, sondern von ihm selbst in das Epos eingefügt worden zu sein. Die Hochzeit zwischen Etzel und Kriemhild hätte den Sitten der Zeit entsprechend entweder in Worms oder an Etzels Hof stattfinden müssen. Trotzdem entschied sich der Dichter für Wien als Trauungsort, obwohl, wie in Str.1375 vermerkt, diese Stadt gar nicht zum Hunnenreich gehörte.[21] Es muss also besondere Gründe geben, warum der Dichter einen Konnex zu Wien und zu Passau herstellte.
Das Auftreten des Bischofs Pilgrim im Nibelungenlied ist anscheinend eine Huldigung an den um 1200 amtierenden Passauer Bischof Wolfger von Erla. Einer von dessen bedeutendsten Vorgängern hieß Pilgrim, der von 971-991 auf dem Bischofsstuhl saß. “Der populärste Oberhirte der Passauer Bistums-Tradition wird zur Maske des gegenwärtigen Bischofs.“[22] Wolfger von Erla war Mäzen verschiedener Dichter (darunter Walther von der Vogelweide) und dürfte auch der Gönner des Nibelungendichters gewesen sein, vielleicht gab er sogar den Auftrag zu dessen Abfassung. Einen Hinweis darauf finden wir in der “Klage“, dem um einige Jahre jüngeren Nachgesang zum Nibelungenlied. Darin heißt es über den Auftraggeber: “Bischof Pilgrim von Passau befahl, diese Geschichte niederzuschreiben.“ Wenn die Gleichsetzung Pilgrim - Wolfger auch hier gilt (und nichts spricht dagegen), wäre Wolfger der Initiator des Nibelungenlieds.[23]
Wolfger von Erla war Bischof von Passau von 1191-1204, danach bekleidete er bis zu seinem Tod 1218 das Amt des Patriarchen von Aquileia. Er entstammte einer guten, aber nicht sehr vornehmen Familie, deren Stammburg unterhalb von Linz lag. Wolfger war vor seiner geistlichen Laufbahn verheiratet gewesen, ein Sohn trat später auch in das Passauer Domkapitel ein. Erst nach dem Tod seiner Frau entschied sich Wolfger für den Priesterberuf. Er machte rasch Karriere, die Stationen lauteten: Propst von Pfaffmünster bei Straubing (nicht ganz sicher), Leiter des Kollegialstifts Zell am See, Domherr in Passau, Bischof ebendort (in dieser Funktion war er auch Reichsfürst). Unter den Vorgängern Wolfgers im 12.Jahrhundert war es zu einem Verfall der bischöflichen Autorität gekommen. So wurde er als Außenseiter Bischof, weil die Kurie nun mehr auf persönliche Fähigkeiten setzte als auf Herkunft aus dem Hochadel wie bei seinen Vorgängern.[24]
Wolfger von Erla war eine bedeutende Persönlichkeit: Er war energisch und pragmatisch, ein fähiger Administrator, der für geordnete Finanzen sorgte, dazu ein begabter Redner und ein exzellenter Unterhändler und Vermittler. Sein politisches Geschick zeigte sich beispielsweise darin, dass er genau auf die Bestimmungen des Wormser Konkordats achtete. Er holte zuerst die Zustimmung des Königs zu seiner Wahl und die Belehnung mit den Regalien ein und erst danach die kirchliche Konsekration. Dadurch schuf Wolfger ein Vertrauensverhältnis zu Kaiser Heinrich VI., zugleich knüpfte er aber auch gute Kontakte nach Rom. So gewährte ihm Papst Innozenz III. das päpstliche Jurisdiktionsprivileg, das heißt, er bestellte den Bischof zum alleinigen Oberrichter in seiner Diözese und hob die seit alters übliche Mitwirkung der Domherren, Archidiakone und hochstiftischen Vasallen an der Urteilsfindung auf. Damit war jeder Einfluss von Laien beseitigt, von nun an spielten Kanonisten aus der Umgebung des Bischofs die entscheidende Rolle im geistlichen Gericht.[25] Als Bischof unterhielt Wolfger enge Beziehungen zu den Babenbergerherzögen in Wien, denen er immer wieder persönliche Besuche abstattete. Diese Beziehungen ergaben sich aus der damaligen Kirchenorganisation. Das Gebiet des Herzogtums Österreich gehörte zur Diözese Passau. Es existierte damals noch keines der heutigen Bistümer in diesem Raum, auch Wien war nur eine Pfarre. Das Passauer Bistum reichte damit von der unteren Isar bis zur ungarischen Grenze, das weltliche Herrschaftsgebiet - das reichsunmittelbare Stiftsland - war dagegen viel kleiner und stark zersplittert.[26]
In Wolfgers Diözese ereignete sich Ende 1192 der Vorfall um die Gefangennahme des englischen Königs Richard Löwenherz durch Herzog Leopold V. von Österreich, der in ganz Europa Widerhall fand. Da Löwenherz als Kreuzfahrer unter dem Schutz der Kirche stand und für die Dauer seiner Reise Unversehrtheit an Leib und Leben, Freiheit und Eigentum genoss, wurde Leopold vom Papst mit dem Bann belegt und über Österreich das Interdikt verhängt. Es ist aber nicht bekannt, dass der Passauer Bischof diese Strafen verkündet und in Kraft gesetzt hätte. Stattdessen erreichte er in persönlichen Gesprächen mit Papst Cölestin III. 1195 die Aufhebung des Interdikts. Wolfger war auch an den Verhandlungen über die Auslieferung von Richard Löwenherz an Kaiser Heinrich VI. beteiligt.[27]
Die enge Verbundenheit Wolfgers mit den Babenbergern zeigte sich auch darin, dass er Herzog Friedrich I. 1197 auf jenem Kreuzzug begleitete, den Kaiser Heinrich VI. plante. Sie reisten auf dem Landweg nach Sizilien, wo das Kreuzheer sich versammelte. Wolfger blieb in Rom zurück zwecks Verhandlungen mit der Kurie im Namen der Babenberger und des Reiches über verschiedene Streitfragen. Danach holte der Bischof die anderen in Sizilien ein, wo sie sich von Heinrich VI. verabschiedeten und im August, also noch vor dem Tod des Kaisers, die Fahrt in den Orient antraten. Wolfger zeichnete sich in den Kämpfen dort aus, zugleich bewies er neuerlich sein politisches Geschick. Er war an der Gründung des Deutschen Ritterordens beteiligt und wurde gebeten, die Genehmigung durch Rom herbeizuführen, was ihm nach der Rückkehr auch gelang. Auf der Heimreise vom Kreuzzug starb der Babenberger Friedrich I. Wolfger weilte an seinem Totenbett, nahm ihm die Beichte ab und geleitete den Leichnam in die Heimat, wo er in Stift Heiligenkreuz bestattet wurde.[28]
Im Juni 1198 war der Passauer Bischof wieder in Deutschland, wo eben der Thronstreit zwischen Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig losbrach. Wolfger verhielt sich in dem Konflikt zunächst vorsichtig neutral, später stellte er sich auf die Seite des Staufers. Im Mai 1200 nahm er erstmals an einem Hoftag Philipps teil. Dieser wohnte der von Wolfger geleiteten Beerdigung des Mainzer Erzbischofs Konrad bei, von da an wurde ihre politische Zusammenarbeit enger.[29] Im Unterschied zum Passauer Bischof gehörte der neue Babenbergerherzog Leopold VI. von Anfang an zur Partei Philipps. Für jemanden, der eben erst zur Macht gelangt war wie Leopold war es ratsam, nicht zu lavieren, sondern sich demjenigen der beiden Könige anzuschließen, der im Süden des Reiches dominierte, und das war der Staufer. Dieser dankte es dem Babenberger mit der Anerkennung als Herzog.[30]
In die Amtszeit Wolfgers als Passauer Bischof fällt auch das Projekt der Babenberger, ein eigenes Bistum Wien zu gründen. Die Schaffung eines Landesbistums in Österreich wäre die Krönung und der logische Abschluss der Bestrebungen der Babenberger zur Gewinnung der vollen Landeshoheit gewesen und hätte den Glanz der herzoglichen Residenzstadt Wien entsprechend erhöht. Schließlich waren sie nach der Erwerbung der Steiermark 1192 die mächtigsten Fürsten im Südosten des Reiches. Aus einem Schreiben von Papst Innozenz III. an Bischof Manegold von Passau vom 14.April 1207 geht hervor, dass Bischof Wolfger von Papst Cölestin III. (1191-1198) die Einsetzung eines zweiten Bischofs in seinem Diözesanbereich erbeten hatte. Dies hätte das Passauer Bistum deutlich verkleinert, als Gegenleistung wäre es aber zum Erzbistum erhoben worden. Ein solches in seiner unmittelbaren Nachbarschaft hätte jedoch dem Erzbistum Salzburg zum Nachteil gereicht. Das Projekt zerschlug sich daher vermutlich wegen Einwänden von Seiten Salzburgs, vielleicht aber auch, weil Wolfger selbst über eine solche Verkleinerung seiner Diözese nicht glücklich gewesen wäre.[31] In den Jahren 1207/08 wurde der Plan durch Herzog Leopold VI. unter Hinweis auf die Größe des Passauer Bistums, die nach Ansicht des Herzogs die Ausübung des Hirtenamtes schwierig machte, und die Bedeutung Wiens wieder aufgenommen. Das Vorhaben zerschlug sich am Widerstand Bischof Manegolds, der eine solche Verkleinerung seines Diözesangebiets samt dem damit verbundenen Verlust an Einkünften nicht hinnehmen wollte, zumal er keine Kompensation in Form einer Erhebung Passaus zum Erzbistum in Aussicht hatte. Der Plan Wolfgers, den Leopold VI. zunächst wieder aufgegriffen hatte, wurde vermutlich durch den Einspruch des Salzburger Erzbischofs in Rom zu Fall gebracht.[32]
Zu der Idee, die Hochzeit zwischen Kriemhild und Etzel in Wien stattfinden zu lassen, könnte der Nibelungendichter durch seine persönliche Anwesenheit bei den Vermählungsfeiern des Babenbergerherzogs Leopold VI. mit der byzantinischen Prinzessin Theodora in Wien im November 1203 inspiriert worden sein. Aus den Reiserechnungen von Bischof Wolfger geht hervor, dass dieser teilnahm, als Landesbischof segnete er wahrscheinlich das Paar. Der Dichter könnte im Gefolge des Bischofs das Geschehen miterlebt haben. Höchstwahrscheinlich war auch Walther von der Vogelweide anwesend. Dieser rühmt in seinem “Wiener Hofton“, der zu jener Zeit verfasst worden sein muss, die große Freigebigkeit, die bei einer Hochzeit herrscht. Dasselbe hebt der Nibelungendichter bei der Vermählung Kriemhilds mit Etzel hervor, vermutlich ist es daher eine Anspielung auf die Hochzeit zwischen Leopold und Theodora.[33] Bei Kriemhields Reise von Passau nach Wien werden im Nibelungenlied als Zwischenstationen die Orte “Everdinge“, “Bechelaren“, “Medelicke“, “Mutaren“, “Zeizenmure“ und “Tulne“ genannt. Von diesen Orten erweisen sich nach den Reiserechnungen Bischof Wolfgers für 1203/04 Eferding, Mautern, Zeiselmauer und Tulln als ständige Übernachtungsquartiere des Bischofs auf seinen Reisen durch seine Diözese bis Wien.[34] Es fällt auch auf, dass der Dichter die Hochzeitsfeiern im Nibelungenlied genauso lange dauern lässt wie die Hochzeit im November 1203 dauerte, nämlich 17 Tage (Str.1365). Der Aufbruch von Wien findet am achtzehnten Tag statt (Str.1375), an diesem verließ auch Bischof Wolfger die Stadt. Dieser ließ am Samstag, dem 25. Oktober 1203 sein Geld in Wiener Münze wechseln, am achtzehnten Tag danach, am 11. November, brach er von Wien nach Klosterneuburg auf.[35] Das Gesinde des Passauer Bischofs war in der Umgebung Wiens, in Zeiselmauer und in Schwadorf, untergebracht. An diese Einquartierung auf dem Land erinnert die Angabe im Nibelungenlied, dass bei der Hochzeit Etzels und Kriemhilds nicht alle Teilnehmer in Wien beherbergt werden konnten, sondern ein Teil von ihnen im Umland nächtigen musste.[36] Letztlich ist die Hochzeit im Nibelungenlied gleichsam ein Brückenschlag zwischen West und Ost, ebenso wie die Vermählung Leopolds mit Theodora einer war.[37]
Das Nibelungenlied als Spiegel rechts- und sozialhistorischer Entwicklungen?
Im Nibelungenlied wird manches geschildert, das man als Spiegelung von Entwicklungstendenzen in der Rechts- und Sozialgeschichte des ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts deuten könnte. Neben der schon erwähnten Schwäche des Königtums und der zunehmenden Macht und Unabhängigkeit der Reichsfürsten, die sich im Nibelungenlied in den Eigenmächtigkeiten spiegeln, die sich Vasallen wie Hagen und Volker gegen ihren König erlauben, ist der Streit der Königinnen Kriemhild und Brünhild, ob Siegfried “Gunthers genoz“ (Kriemhild in Str.818) oder “eigen“ (Brünhild in Str.821) sei, ein Hinweis auf solche Entwicklungstendenzen. Dieser Streit wird in einer Terminologie ausgetragen, die gruppenspezifische gesellschaftliche Erfahrungen der Zeit um 1200 widerspiegelt. Es fällt auf, dass Brünhild immer wieder von Siegfried als “eigen man“ spricht. Das wäre unverständlich, wenn es nur darum ginge, Gunthers höhere Stellung zu bezeichnen. Zu diesem Zweck würde es genügen, Siegfried als “man“, als Lehensmann, Vasall zu bezeichnen. Kriemhild besteht dagegen auf dem Wort “adelvri“. Dies ist kein Gegensatz zu Vasall, Lehensmann, denn das konnte auch ein Freier sein. “Adelvri “ war aber ein Gegensatz zu “eigen“, das heißt unfrei. Ein “eigen man“ war auch ein Ministeriale. Brünhild unterstellt somit Siegfried den rechtlichen Status eines Unfreien, eine Unterstellung, von der Kriemhild fürchten muss, dass sie geglaubt wird.[38]
“Die existentielle Bedrohtheit, in der sich Kriemhild befindet, bietet sich bis ins Detail als Verbildlichung der Erfahrungen jener Teile des Adels an, der in dem tiefgreifenden - und Strukturelemente des neuzeitlichen Staates schaffenden - gesellschaftlichen Umwälzungsprozeß seit etwa der Mitte des 12. Jahrhunderts seine althergebrachten Herrschaftsgrundlagen zerbröckeln sieht, der sich durch die übermächtige Verbindung von Landesherr und Ministerialität in seiner Existenz bedroht und seinem Selbstverständnis gefährdet sieht.“[39]
Dieser Umwälzungsprozess wird auch Territorialisierungsprozess genannt oder als Herausbildung der Landesherrschaft beschrieben. Es handelt sich dabei um den Übergang vom Personenverbandsstaat des Früh- und Hochmittelalters zum modernen Territorialstaat. Diese Entwicklung setzte in der Mitte des 12. Jahrhunderts ein, als an vielen Orten ein strukturell neuer, planmäßiger Ausbau von Herrschaftsgewalten begann, der im Wesentlichen zwei Ziele verfolgte: 1. Die Arrondierung beziehungsweise “Verdichtung“ eines größeren gräflichen, herzoglichen oder königlichen Streubesitzes zu einem zusammenhängenden Territorium. 2. Die Durchsetzung der ausschließlichen Herrschaftsausübung des Landesherren in diesem Gebiet. Diese neuartige Form einer Gebietsherrschaft zielte auf die systematische Beseitigung aller anderen Herrschaftsrechte, also der feudalen Sonderrechte des landsässigen Adels. Der Landesherr trachtete die Rechte seiner adeligen Standesgenossen auf sich zu konzentrieren, diese Territorialisierungspolitik richtete sich daher gegen die adeligen “genozen“ und verfolgte auch die Durchsetzung einer übergeordneten Herrschaftsgewalt über deren “Leute“.[40]
Der Territorialisierungsprozess bedeutete für den Großteil des edelfreien Adels eine Verdrängung aus seinen überkommenen Rechten und damit die Erfahrung einer tief greifenden Krise seiner Herrschaft. Dieser Adel sah sich eingezwängt zwischen dem Suprematieanspruch jener adeligen “genozen“, die Landesherren waren und ihre Herrschaft ausbauten und dem vom König und den Landesherren geförderten Aufstieg der Ministerialen, die Anspruch auf Teilhabe an der Macht erhoben und partiell in adelige Herrschaftspositionen einrückten.[41] “Für jenen großen Teil des altfreien Adels, der sich in dieser Situation befand, vermochte eine Gestalt wie Kriemhild den gesellschaftlichen Erfahrungsraum zu erhellen, vermochte komplexer und zufälliger Alltagserfahrung paradigmatischen Charakter zu geben.“[42] Kriemhilds Verhalten erscheint in diesem Zusammenhang als Reaktion auf eine umfassende Gefährdung ihrer Identität. Sie reagiert auf Tendenzen, die aus der freiwilligen Bindung rechtliche Ansprüche auf Preisgabe der adeligen Freiheit herleiten und fasst damit in dramatisches Geschehen, was in der Realität nur latent ist. “In dem Pochen auf dem Prinzip der ’genozschaft’ und der altadeligen Freiheit ist der verzweifelte und zum Scheitern verurteilte Versuch einer ganzen Schicht zu sehen, ihre gesellschaftliche Identität noch einmal auf die althergebrachte Herrschaftslegitimation des Geblüts zu gründen.“[43]
In der Verweigerung der von Kriemhild geforderten Auslieferung Hagens wird die Treue zwischen Herr und Mann zum absoluten Handlungsprinzip. In diesem Ideal interpretierte sich jener Adel, auf dessen Kosten der Umwälzungsprozess der Territorialisierung ging. Diese soziale Schicht erfuhr die Auflösung der Herrschaftsstrukturen des Personenverbandes und ihre Transformation in die neue Form des Flächenstaats vor allem als Zerfall der “triuwe“ -Bindungen.[44] “Das Nibelungenlied bannt diese Erfahrung in eindrucksvolle Szenen und beschwört zugleich ihre Utopie im rückwärtsblickenden Gesellschaftsmodell einer idealisierten Gefolgschaft.“[45]
Diese oben ausgeführten Thesen von Gert Kaiser sind nicht unwidersprochen geblieben. Im Folgenden seien die Einwände dargelegt, die Fritz-Peter Knapp vorbrachte: Während das Nibelungenlied bereits um 1200 niedergeschrieben wurde, setzte der Prozess der Territorialisierung erst im Laufe des 13. Jahrhunderts ein. In Österreich waren zudem fast ausschließlich die mächtigen Ministerialen betroffen, die weit gehend in die Position der alten Grafen- und Hochfreiengeschlechter eingerückt waren und am Beginn des offenen Konflikts (im zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts) dem Landesherren, der über eine Primus-inter-pares-Stellung noch nicht hinaus gelangt war, in einer ihm durchaus vergleichbaren Machtfülle gegenüber standen. Die meisten gräflichen und edelfreien Familien Österreichs starben bis zum Ende der Regierung Leopolds VI. (1230) aus Ursachen, über die wir nur Vermutungen anstellen können (Kriege, Eintritte in den geistlichen Stand, wenige Eheschließungen) im Mannesstamm aus. Da deshalb die Hauptakteure, die Angehörigen der alten Aristokratie, fehlten, ist die Annahme falsch, nach 1230, unter der Regierung Friedrichs II. des Streitbaren, habe sich bloß ein schon seit dem 12. Jahrhundert aufgestautes Konfliktpotenzial entladen, das auch im Nibelungenlied artikuliert wurde. In Bayern versammelte Herzog Ludwig I. nicht nur Ministerialen, sondern auch Grafen und Edelleute zur Durchsetzung seiner Herrschaftsansprüche um sich. Im Übrigen war in den ersten Jahrzehnten nach dem Regierungsantritt der Wittelsbacher 1180 gerade die Position des Herzogs bedroht und nur durch das Eingreifen des Königs zu seinen Gunsten zu retten. Die entscheidende Auseinandersetzung zwischen dem Landesherren und dem altfreien Adel fand erst in den 1240er und 1250er Jahren statt.[46]
BIBLIOGRAPHIE
Falk, Walter: Das Nibelungenlied in seiner Epoche. Revision eines romantischen Mythos. Heidelberg: Winter 1974
Flieder, Viktor: Stephansdom und Wiener Bistumsgründung. Eine diözesan- und rechtsgeschichtliche Untersuchung. Wien: Dom-Verlag 1968 (=Veröffentlichungen des kirchenhistorischen Instituts der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien 6)
Goez, Werner: Gestalten des Hochmittelalters. Personengeschichtliche Essays im allgemeinhistorischen Kontext. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983
Hoffmann, Werner: Das Nibelungenlied. Frankfurt: Diesterweg 1987 (=Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur)
Kaiser, Gert: Deutsche Heldenepik. In: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft Bd.7. Hg. Klaus von See. Europäisches Hochmittelalter, von Henning Krauss. Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion 1981, S.181-216
Knapp, Fritz-Peter: Nibelungentreue wider Babenberg? Das Heldenepos und die verfassungsgeschichtliche Entwicklung Österreichs im Lichte der neuesten Forschung. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur Bd.107 (1985), S.174-189
Lechner, Karl: Die Babenberger. Markgrafen und Herzoge von Österreich 976-1246. Wien/Köln/Weimar: Böhlau 6.Aufl. 1996
Loidl, Franz: Geschichte des Erzbistums Wien. Wien/München: Herold 1983
Mackensen, Lutz: Die Nibelungen. Sage, Geschichte, ihr Lied und sein Dichter. Stuttgart: Dr. Ernst Hauswedell&Co 1984
Panzer, Friedrich: Das Nibelungenlied. Entstehung und Gestalt. Stuttgart/Köln: Kohlhammer 1955
Rosenfeld, Hellmut: Die Datierung des Nibelungenliedes Fassung *B und *C durch das Küchenmeisterhofamt und Wolfger von Passau. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur Bd.91 (1969), S.104-120
Thomas, Heinz: Dichtung und Politik um 1200: Das Nibelungenlied. In: Pöchlarner Heldenliedgespräch. Das Nibelungenlied und der mittlere Donauraum. Hg. Klaus Zatloukal Wien: Fassbaender 1990, S.103-129 (=Philologica Germanica 12)
Thomas, Heinz: Die Staufer im Nibelungenlied. In: Zeitschrift für Deutsche Philologie Bd.109 (1990), Drittes Heft S.321-354
[...]
[1] Lechner, Karl: Die Babenberger. Markgrafen und Herzoge von Österreich 976-1246. Wien/Köln/Weimar: Böhlau 6.Aufl. 1996, S.172
[2] Lechner: Die Babenberger, S.194f.
[3] Mackensen, Lutz: Die Nibelungen. Sage, Geschichte, ihr Lied und sein Dichter. Stuttgart: Dr. Ernst Hauswedell&Co 1984, S.105f. Zitat S.106
[4] Thomas, Heinz: Dichtung und Politik um 1200: Das Nibelungenlied, S.103f.
In: Pöchlarner Heldenliedgespräch. Das Nibelungenlied und der mittlere Donauraum, hg. Klaus Zatloukal.
Wien: Fassbaender 1990, S.103-129 (= Philologica Germanica 12);
Thomas, Heinz: Die Staufer im Nibelungenlied, S.322 In: Zeitschrift für Deutsche Philologie Bd. 109, Drittes
Heft (1990), S.321-354; Lechner: Die Babenberger, S.195
[5] Lechner: Die Babenberger, S.198f.
[6] Thomas: Dichtung und Politik, S.113f.
[7] Thomas: Dichtung und Politik, S.114f. Thomas: Die Staufer im Nibelungenlied, S.328-333
[8] Thomas: Dichtung und Politik, S.116-119 Thomas: Die Staufer im Nibelungenlied, S.334-338
[9] Thomas: Dichtung und Politik, S.123
[10] Thomas: Dichtung und Politik, S.123f. Thomas: Die Staufer im Nibelungenlied, S.344f.
[11] Thomas: Dichtung und Politik, S.124f. Thomas: Die Staufer im Nibelungenlied, S.345f.
[12] Thomas: Die Staufer im Nibelungenlied, S.350f.
[13] Thomas: Die Staufer im Nibelungenlied, S.353, Zitat ebd.
[14] Thomas: Die Staufer im Nibelungenlied, S.349 u. 353f. Thomas: Dichtung und Politik, S.119f.
[15] Hoffmann, Werner: Das Nibelungenlied. Frankfurt: Verlag Moritz Diesterweg 1987, S.20f.
[16] Mackensen: Die Nibelungen, S.106f.
[17] Thomas: Dichtung und Politik, S.109 Thomas: Die Staufer im Nibelungenlied, S.325f.
Lechner: Die Babenberger, S.196
[18] Thomas: Dichtung und Politik, S.110 Thomas: Die Staufer im Nibelungenlied, S.327f.
[19] Goez, Werner: Gestalten des Hochmittelalters. Personengeschichtliche Essays im allgemeinhistorischen
Kontext. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983, S.296
[20] Thomas: Dichtung und Politik, S.110-112 Mackensen: Die Nibelungen, S.83f.
Rosenfeld, Hellmut: Die Datierung des Nibelungenliedes Fassung *B und *C durch das Küchenmeisterhofamt
und Wolfger von Passau, S.104-106 In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur Bd. 91
(1969) S.104-120
[21] Falk, Walter: Das Nibelungenlied in seiner Epoche. Revision eines romantischen Mythos.
Heidelberg: Winter 1974, S.245f.+Anm.15 Hoffmann: Das Nibelungenlied, S.13
Panzer, Friedrich: Das Nibelungenlied. Entstehung und Gestalt. Stuttgart/Köln: Kohlhammer 1955, S.475-477
[22] Goez: Gestalten des Hochmittelalters, S.301
[23] Goez: Gestalten des Hochmittelalters, S.299-301, Zitat S.301 Falk: Das Nibelungenlied, S.245+Anm.15
[24] Goez: Gestalten des Hochmittelalters, S.293f.
[25] Goez: Gestalten des Hochmittelalters, S.294-297 Lechner: Die Babenberger, S.207f.
[26] Goez: Gestalten des Hochmittelalters, S.294
[27] Goez: Gestalten des Hochmittelalters, S.301f. Lechner: Die Babenberger, S.186-188
Rosenfeld: Die Datierung des Nibelungenliedes, S.117
[28] Goez: Gestalten des Hochmittelalters, S.302f. Lechner: Die Babenberger, S.193 u. 207
[29] Goez: Gestalten des Hochmittelalters, S.303f.
[30] Lechner: Die Babenberger, S.195f.
[31] Goez: Gestalten des Hochmittelalters, S.302
Loidl, Franz: Geschichte des Erzbistums Wien. Wien/München: Herold 1983, S.13
Flieder, Viktor: Stephansdom und Wiener Bistumsgründung. Eine diözesan- und rechtsgeschichtliche Untersuchung. Wien: Dom-Verlag 1968, S.45 (= Veröffentlichungen des kirchen historischen Instituts der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien 6)
[32] Flieder: Stephansdom und Wiener Bistumsgründung, S.45-49
[33] Panzer: Das Nibelungenlied, S.481f. Mackensen: Die Nibelungen, S.133f. Rosenfeld: Die Datierung des Nibelungenliedes, S.109f. Falk: Das Nibelungenlied, S.246+Anm.16
[34] Rosenfeld: Die Datierung des Nibelungenliedes, S.113
[35] Rosenfeld: Die Datierung des Nibelungenliedes, S.111f.
[36] Falk: Das Nibelungenlied, S.246 Anm.16
[37] Mackensen: Die Nibelungen, S.133
[38] Kaiser, Gert: Deutsche Heldenepik, S.192f. In: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, hg. Klaus von See. Bd. 7: Europäisches Hochmittelalter, hg. Henning Krauss. Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion 1981, S.181-216
[39] Kaiser: Deutsche Heldenepik, S.194
[40] Kaiser: Deutsche Heldenepik, S.194 Für Österreich vgl. Lechner: Die Babenberger, S.180-184
[41] Kaiser: Deutsche Heldenepik, S.195 Hoffmann: Das Nibelungenlied, S.20
[42] Kaiser: Deutsche Heldenepik, S.195
[43] Kaiser: Deutsche Heldenepik, S.195
[44] Kaiser: Deutsche Heldenepik, S.197
[45] Kaiser: Deutsche Heldenepik, S.197
[46] Knapp, Fritz-Peter: Nibelungentreue wider Babenberg? Das Heldenepos und die verfassungsgeschichtliche
Entwicklung Österreichs im Lichte der neuesten Forschung, S.183f. u. 188f. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur Bd. 107 (1985), S.174-189
Häufig gestellte Fragen zum Nibelungenlied
Welche politischen Verhältnisse im Reich um 1200 spiegeln sich im Nibelungenlied wider?
Das Nibelungenlied entstand in einer Zeit politischer Wirren im Reich, beginnend mit dem Tod Kaiser Heinrichs VI. 1197. Der Thronstreit zwischen Staufern und Welfen, die Schwäche des Königtums und die zunehmende Macht der Reichsfürsten sind mögliche Spiegelbilder dieser Zeit.
Inwiefern könnten die Burgunden im Nibelungenlied die Staufer widerspiegeln?
Die Wormser Könige im Nibelungenlied könnten eine Anspielung auf die Staufer sein. Worms spielte eine wichtige Rolle in der Stauferzeit, und Friedrich Barbarossa war mit Beatrix von Burgund verheiratet, was eine Verbindung zwischen Staufern und Burgund herstellt.
Gibt es andere zeitgeschichtliche Bezüge im Nibelungenlied?
Ja, die Eigenmächtigkeiten der Vasallen gegenüber dem König, die Rolle des schwachen Königs, der Buhurt in Tulln, die Erwähnung des Küchenmeisters Rumolt und die Bayernfeindlichkeit könnten zeitgeschichtliche Bezüge zur damaligen Realität sein.
Welche Beziehungen zwischen den Babenbergerherzögen und dem Bischof von Passau werden im Nibelungenlied reflektiert?
Die Erwähnung von Wien und Passau, die Rolle des Bischofs Pilgrim und die Wahl Wiens als Hochzeitsort könnten auf die Beziehungen zwischen den Babenbergerherzögen und dem Bischof von Passau (Wolfger von Erla) hindeuten. Wolfger war ein wichtiger Förderer der Künste und möglicherweise auch des Nibelungendichters.
Spiegelt das Nibelungenlied rechts- und sozialhistorische Entwicklungen wider?
Möglicherweise ja. Der Streit zwischen Kriemhild und Brünhild über Siegfrieds Status ("Gunthers genoz" oder "eigen") könnte die gesellschaftlichen Veränderungen und den Konflikt zwischen Adel und Ministerialen um 1200 widerspiegeln. Allerdings gibt es auch Einwände gegen diese These.
Was ist die “Klage” und welche Bedeutung hat sie im Kontext des Nibelungenliedes?
Die “Klage” ist ein Werk, das an das Nibelungenlied anschließt. Sie gibt weitere Hinweise darauf, dass Bischof Pilgrim (Wolfger) von Passau der Initiator oder Auftraggeber des Nibelungenlieds gewesen sein könnte.
Wer war Bischof Wolfger von Erla und welche Rolle spielte er in Bezug auf das Nibelungenlied?
Wolfger von Erla war Bischof von Passau um 1200. Er war ein Mäzen der Künste und es wird vermutet, dass er der Gönner des Nibelungendichters war. Die Figur des Bischofs Pilgrim im Nibelungenlied könnte eine Huldigung an Wolfger darstellen.
Welchen Einfluss hatte die Hochzeit Leopolds VI. mit der byzantinischen Prinzessin Theodora auf das Nibelungenlied?
Die Beschreibung der Hochzeitsfeierlichkeiten im Nibelungenlied (Kriemhild und Etzel) könnte von der prunkvollen Hochzeit Leopolds VI. mit Theodora in Wien im Jahr 1203 inspiriert sein, an der der Dichter möglicherweise teilgenommen hat.
Was sind die Hauptpunkte der Debatte über die Deutung des Nibelungenliedes als Spiegel sozialer Konflikte?
Gert Kaiser argumentiert, dass das Nibelungenlied die Krise des Adels im Zuge der Territorialisierung widerspiegelt. Fritz-Peter Knapp kritisiert diese These, da der Territorialisierungsprozess erst im 13. Jahrhundert einsetzte, während das Nibelungenlied um 1200 entstand.
Welche Orte im Donautal werden im Nibelungenlied erwähnt und warum sind sie bedeutsam?
Orte wie "Everdinge", "Bechelaren", "Medelicke", "Mutaren", "Zeizenmure" und "Tulne" werden erwähnt. Einige dieser Orte waren laut den Reiserechnungen Bischof Wolfgers ständige Übernachtungsquartiere des Bischofs auf seinen Reisen durch seine Diözese bis Wien, was die Verbindung des Dichters zur Region und möglicherweise zu Wolfger untermauert.
- Quote paper
- Johann Kurzreiter (Author), 2001, Der politische Umkreis des Nibelungenlieds, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109151