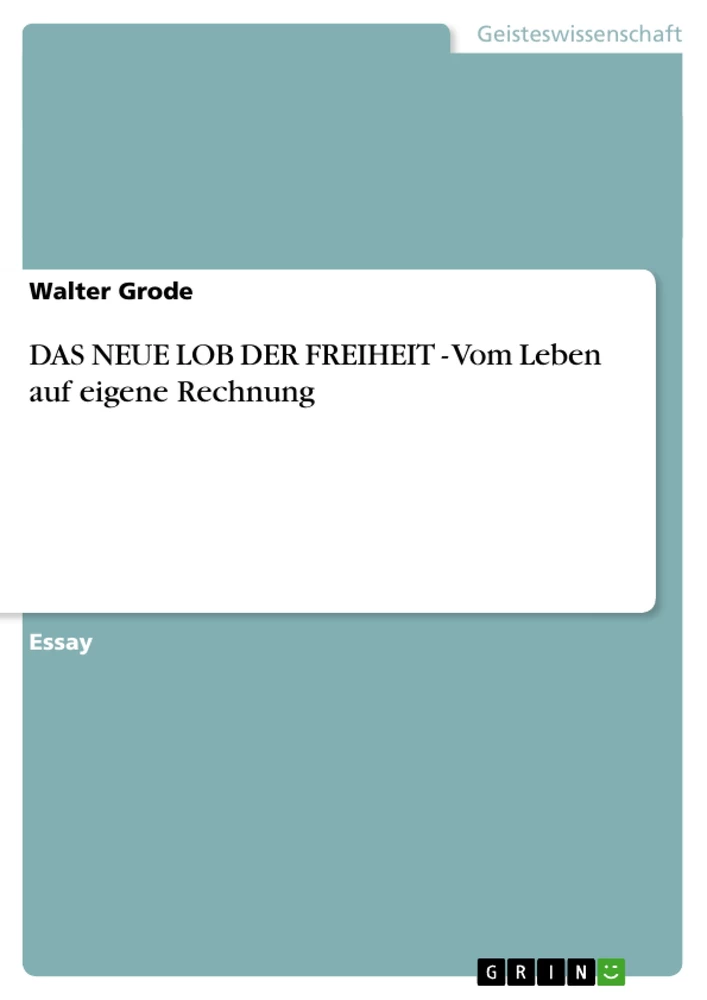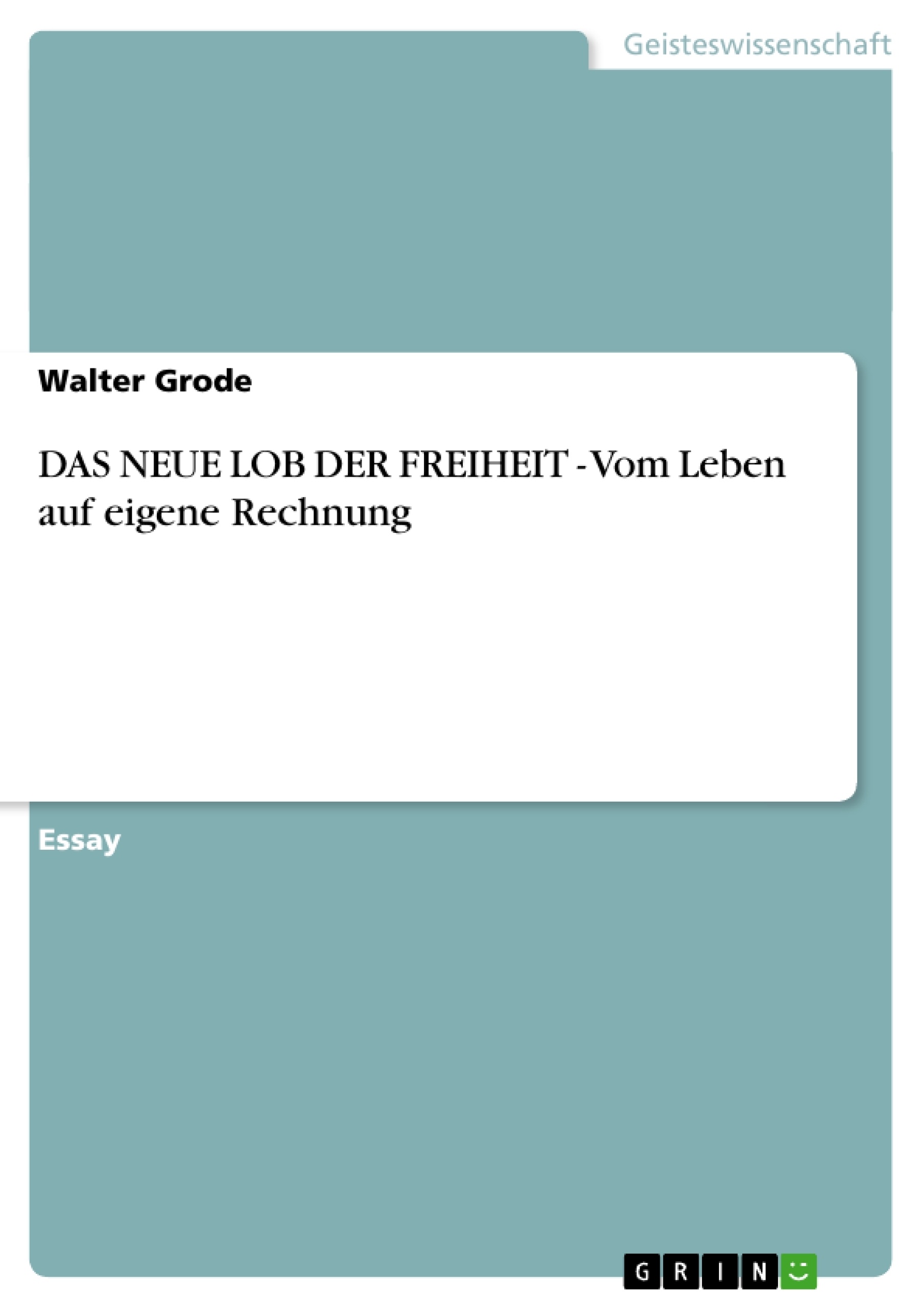Walter Grode
DAS NEUE LOB DER FREIHEIT
Vom Leben auf eigene Rechnung
In: ders.: Aufsätze und Essays, Rezensionen und Kommentare, Hannover 2005
(Notiz: Beim Streit um den Abbau des Sozialstaates ist Freiheit der Joker, wenn keine andere Karte mehr sticht. Die neue Freiheit verspricht den Ausgang aus der Unmündigkeit; die Freiheit von Fürsorge und bürokratischer Vormundschaft. Dies alles geschieht vor dem Hintergrund, daß sich die Armutsentwicklung den frühen siebziger Jahren annähert, und selbst konservative Beobachter einen kapitalistischen Neofeudalismus heraufziehen sehen, in dem sich der Staat aller sozialen Verpflichtungen entledigt und barmherzige Großkonzerne je nach Gusto und aus schlechtem Gewissen eine steuerabzugsfähige Suppenküche für die Ärmsten der Armen aufstellen.)
___________________________________________________________________________
Bertold Brecht riet einst in kritischer Lage der DDR-Obrigkeit, sich ein neues Volk zu suchen, wenn dies nicht mit ihren Plänen übereinstimme. Wenn sich demokratische Politiker heute einen neuen Bürger wählen dürften, dann wäre dieser endlich ein freier Mensch aus staatlicher Vormundschaft entlassen und ganz sein eigener Herr. Den alten Sozialstaat, diese Zwangsveranstaltung, würde der freie Bürger nur aus Erzählungen seiner Großeltern. Er fiele keinem zur Last und er wäre seines eigenen Glückes Schmied (Grode 2003).
Besitzt der freie Bürger für einige Monate einen festen Arbeitsplatz, empfindet er Dank. Höchstleistungen sind ihm nicht fremd. Enttäuschungen helfen ihm weiter und Scheitern ist seine Chance. Illusionen hat er keine, dafür ist das Leben zu kurz. Wer überleben will muß kämpfen. Er wird es schon schaffen. Würde ihn ein Konsumforscher nach seinem Selbstbild fragen, sagte er liberal und modern, flexibel und effizient. Aber auch innivativ und optimistisch. Und vor allem eines: frei.
Ist das eine Karikatur?, fragt Thomas Assheuer (2003) - präsentiert die Studie "Bildung neu denken" der bayrischen Wirtschaft und des Berliner Philosophen Dieter Lenzen zur marktkonformen Verwertung von kindlichem Humankapital - und antwortet mit einem entschiedenen Nein: Bereits das Leben kindlicher Leistungsträger ist "Freiheit in Bewäh-rung und Erwartung".
Auch bei Politikern steht "Freiheit" auf Platz eins. Arm in Arm mit "Eigenverantwortung" oder "Bürgergesellschaft". Beim Streit um den Abbau des Sozialstaats ist Freiheit der Joker, wenn keine andere Karte mehr sticht, selbst bei denen, die lieber von ewigen Werten und haltenden Mächten reden und bei diesem Wort spontan an deren Mißbrauch denken. Die neue Freiheit verspricht den Ausgang aus der Unmündigkeit; die Freiheit von Fürsorge und staatlicher Vormundschaft. Oder, wie die katholischen Bischöfe es formulieren: das Ende der "konfortablen Normalität" einer Sozialstaatsexistenz.
Sogar die allseits gerechte SPD hat sich in eine Freiheitsorganisation verwandelt. Gestern noch eine Pastoralpartei, die alle Schäfchen am Tisch des Herrn versammelte ("Versöhnen statt spalten", heißt die Lösung heute: nicht Umverteilung, sondern Freiheit; nicht Politik für alle, sondern nur für die Willigen. Aus dem Hausvater ist der herrische Platzanweiser geworden, und keiner hat dies so unverblümt ausgesprochen wie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Peer Steinbrück (2003): "Soziale Gerechtigkeit muss künftig heißen, eine Politik für jene zu machen, die etwas für die Zukunft unseres Landes tun: die lernen und sich qualifizieren, die Kinder bekommen und erziehen, die etwas unternehmen und Arbeitsplätze schaffen, kurzum, die Leistung für sich und unsere Gesellschaft erbringen. Um sie - und nur um sie - muss sich Politik kümmern."
Neu ist diese Rhetorik nicht. Schon immer wurde dem Bürger die Freiheit vom Fürsorge-staat schmackhaft gemacht, wenn in Konjunkturkrisen soziale Errungenschaften auf dem Spiel standen und die Durchsetzung sozialer Rechte blockiert werden sollte. Fast könnte man sagen: Die Kritik am Wohlfahrtsstaat ist so alt wie dieser selbst. Zu den frühesten Skeptikern zählt Alexis de Tocqueville, dem die Welt die wunderbar scharfsinnigen Beob-achtungen "Über die Demokratie in Amerika" (1835) verdankt. Der "Wohlfahrtstaat", so lautet das Urteil des konservativen Liberalen, "ist eine gewaltige, bevormundende Macht, die allein dafür sorgt, die Genüsse der Untertanen zu sichern und ihr Schicksal zu überwachen." Die staatlich Wohlfahrt "herrscht" wie eine gütige Despotie, "unumschränkt ins Einzelne gehend, vorsorglich und mild". Statt den Menschen auf das reife Alter vorzubereiten, "hält sie unwiderruflich im Zustand der Kindheit" fest. Der Wohlfahrtsstaat "zwingt selten zu eigenem Tun", aber er infantilisiert den Einzelnen, "weicht ihn auf" und "zermürbt" seinen Willen. Das freie Volk dämmert in unfreier Freiheit vor sich hin, wie eine "Herde ängstlicher und arbeitsamer Tiere, deren Hirte die Regierung ist".
Dennoch war Tocqueville kein Freund eines Liberalismus, für den eine Gesellschaft erst dann wahrhaft frei ist, wenn Arme und Reiche gleichermaßen das Recht haben, unter Brücken zu schlafen. Im Gegenteil, Tocqueville verteidigte soziale Rechte als Fundament der Demokratie - und fürchtete gleichwohl, eine staatlich verwaltete Gerechtigkeit schade der Freiheit.
Auf solche Feinheiten ließen sich konservative Gegner des Sozialstaat erst gar nicht ein. Sie griffen die Idee der sozialen Gerechtigkeit frontal an und behaupteten, die Aufgabe des Staates bestehe einzig und allein darin, Sicherheit und Freiheit zu garantieren. Wer darüber hinaus vom Staat verlange, er solle Gerechtigkeit durchsetzen, der säge am Thron seiner Souveränität. "Sozialstaatliche Inhalte", so schrieb der Staatsrechtler Ernst Forsthoff 1954, seien mit einer "liberalen Verfassung unvereinbar" und sollten daraus schleunigst entfernt werden. Forsthoff, der 1933 in seinem Buch "Der totale Staat" das Führerprinzip verteidigt hatte, löste mit seiner Kritik am Sozialstaatsverständnis der Bundesrepublik eine Kontroverse aus, deren Echo noch heute zu vernehmen ist. Sein Standardargument lautete: Während staatliche Sicherheit klar zu definieren sei, könne man unter sozialer Gerechtigkeit alles und nichts verstehen. Sie sei ein wucherndes Schlinggewächs, eine diskrete Variable in den Händen machtgieriger Parteien. Im Kampf um Wählerstimmen, und dieser Einwand ist für die Zeit der "mittleren" Bundesrepublik gewiß berechtigt, versprechen Politiker den Bürgern stets einen Zuwachs an Gerechtigkeit, also Leistungen, die der Staat erfüllen und die Wirtschaft bereitstellen muß. Auf diese Weise setzten die Parteien einen Überbietungs-wettbewerb in Gang, erzeugten aus Gründen des eigenen Machterhalts immer neue Nachfrage nach sozialer Wohlfahrt - und lähmten Wirtschaft und Staat. Unter der Losung "Mehr Gerechtigkeit" fesselt die Gesellschaft Gulliver, den staatlichen Riesen. Und am Ende, so Forsthoff, drohe die totale Gesellschaft. Die von Gerechtigkeitsansprüchen gefesselte und seiner Macht beraubte Staat ist nicht einmal fähig, seinem ersten und einzigen Auftrag nachzukommen: der Bewahrung von Sicherheit und Freiheit.
Konservative wie Forsthoff, die den Sozialstaat nicht als Instrument der Gerechtigkeit, sondern als illegitimes Mittel der Wohlstandsverteilung begreifen, haben noch andere Pfeile im Köcher, darunter die Behauptung, soziale Gerechtigkeit entfremde den Bürger von der tragischen "Härte" des Schicksals und dem natürlichen Leiden am Dasein. Außerdem erzeuge der Sozialstaat einen uniformen Menschentyp, nämlich den "letzten Menschen", jjenen grauen Langweiler, der keinerlei schöpferische Energien freisetze und unfähig sei, "einen tanzenden Stern zu gebären".
Nietzsche, auf den diese Formulierung zurückgeht, hatte das saturierte Bürgertum der europäischen Gründerzeit vor Augen, und wie nach ihm Martin Heidegger, Carl Schmitt oder Leo Strauss hörte er im Ruf nach Gerechtigkeit den egalitären Klang der christlichen Brüderlichkeitsethik. Der moderne Staat, so schrieb Heidegger in Nachfolge Nietzsches, produziere die "Not der Notlosigkeit". Daraus spricht die Grammatik der Härte,, der Wunsch nach Tragik und Schwere. Ähnliche Bocksgesänge waren dann erst wieder nach der deutschen Vereinigung zu vernehmen. Deutschland, hieß es, bedürfe nicht länger des Sozialstaats als Identitätsersatz. Denn nun könne die selbstbewußte Nation ihren Zusammenhalt wie früher stiften - durch kulturelle Eintracht, nationale Größe und patriotische Gesinnung.
Pikanterweise gibt es auch eine linke Kritik an den Segnungen des Wohlfahrtsstaates. Wie einst Tocqueville sieht auch sie einen heimlichen Paternalismus am Werk, eine unkontrolliert wuchernde Macht aus Bürokratisierung, Verrechtlichung und Bevormundung. Damit kein Mißverständnis aufkommt: Für seine linkem Kritiker gehört der Sozialstaat nicht zum alten Eisen, sondern zum alten Gold. Er war die historisch überfällige Antwort auf das Elend des Liberalismus, auf Klassenkampf und Ausbeutung. Und doch, so heißt es in Jürgen Habermas' klassisch gewordenen Bemerkungen über die "Krise des Wohlfahrtsstaates" (1985), bezahle der Bürger seine soziale Sicherheit mit der kleinen Münze der Freiheit. Erst mute der Staat dem Bürger Freiheitsverluste zu - um ihn dann "in seiner Rolle als Klient wohlfahrtsstaatlicher Bürokratien mit Rechtsansprüchen und in seiner Rolle als Konsument von Massengütern mit Kaufkraft" zu entschädigen. Kurzum, Gerechtigkeit ist zwar eine elementare Norm und sorgt dafür, daß alle Bürger imstande sind, an der Freiheit zu partizipieren. Doch in dem Moment, wo Gerechtigkeit in Bürokratien verwaltet wird, droht der Umschlag von "Freiheitsverbürgerung" in "Freiheitsentzug".
Bei so viel erdrückender Kritik: Stimmt es also, wenn heute behauptet wird, der Abschied vom Sozialstaat entlasse den Bürger aus der großen Gängelung und führt ihn in das gelobte Land der Freiheit? Nach Jahrzehnten der Abhängigkeit: Befreit sich das Mündel endlich von seinem Vormund?
Es gibt gute Gründe dem Pathos der Freiheit zu mißtrauen. Denn wann immer die Vollbeschäftigungsgesellschaft an ihre Grenze und der Verteilungsstaat in die Krise gerät, entdecken Politiker, neokonservative auch sozialdemokratische, über Nacht die "Freiheit" des eigenverantwortlichen Menschen. Eben noch ein treuer Kunde des Sozialstaats, soll der Bürger auf einmal die Daseinsfürsorge in die eigenen Hände nehmen und sich im Gebrauch der Freiheit üben. Denn der Sozialstaat, so heißt es, schränke den Bewegungsraum des Bürgers unnötig ein, halte ihn abhängig und zwingt ihn zu einem bestimmten Lebensstil.
Aber ist der Abbau des Sozialstaats wirklich Freiheit oder doch nur - Freisetzung? Es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die im Dauerappell zur Selbstoptimierung und Selbstbewirtschaftung weniger einen Gewinn an neuer Freiheit, sondern eher eine neue, sanft disziplinierende Form des Staatshandelns erkennen. Soziologen und Philosophen wie Thomas Lemke, Uirich Bröckling oder Stephan Lessenich sprechen davon, der Staat verlagere gesellschaftliche Lasten auf die Schultern des Einzelnen und versuche, die Idee der Sozialversicherung durch die politische Formel des freien und eigenverantwortlichen Subjekts zu ersetzen. Das Lob der Freiheit werde benutzt,, um den Sozialstaat erst abzubauen, um dann ein neues Kontrollnetz auszuwerfen. Auf den ersten Blick sehe es so aus, als zöge sich der Staat aus der Gesellschaft zurück. Einschneidende Veränderungen würden nicht mehr von der Regierung gegen den Einzelnen durchgesetzt, sondern jeder solle sie mental, aus ganzem Herzen, also "frei" und "autonom" wollen. Mit leichter Übertreibung könnte man auch sagen: "Freiheit" ist das Hauptwort eines Staates, dem Kapitalabwanderung und Globalisierung, Überalterung und Massenarbeitslosigkeit die Quellen des Reichtums abgraben. Deshalb steuert er seine Bürger so, daß sie zu Selbstversorgern heranwachsen und mit wachsender Selbstverwendungsfreude ihre Geschicke in die Hand nehmen. Nicht mehr Staat und Gesellschaft, sondern der multioptional einsetzbare Einzelne bildet nun den Knotenpunkt aller Verhältnisse. Im Fall der Ich-AG ist jeder Einzelne sogar Arbeiter und Unternehmer in einer Person; er ist Selbstmanager und Direktvermarkter und damit allein zuständig für Scheitern und Gelingen seines Lebens. "Untersozialisierte, arbeitsunwillige, präventionsverweigernde und aktivierungsresistente Subjekte", so Stephan Lessenich in der Zeitschrift >Mittelweg 36<, verkörperten dagegen eine "Bedrohung des Sozialen - ökonomisch als Investitionsruinen und moralisch als Solidaritätsgewinnler".
Wie alle Zeitdiagnosen, die sich auf den Philosophen Michel Foucault berufen, sind auch diese Beschreibungen pessimistisch eingetönt und klingen manchmal so, als sei Freiheit selbst eine Illusion. Aber richtig an der Beobachtung ist: Während sich der Staat scheinbar zurückzieht und Freiheit ermöglicht, wird der Gebrauch dieser Freiheit sofort wieder festgelegt, definiert und reguliert (siehe dazu auch die Aufsätze in dem von Thomas Lemke im Suhrkamp Verlag herausgegebenen Sammelband "Gouvermentalität"). Kaum betritt der Bürger das Reich der Freiheit, droht neuer Zwang. Der Einzelne soll flexibel und treu, innovativ und beständig, konsumorientiert und fortpflanzungsfreudig sein, kurz: Er soll sich zugleich ökomonisch wie auch moralisch verhalten. Jeder ist frei, aber er soll die Freiheit zur marktfrmigen Organisierung seines Lebens nutzen. So wird der Markt zu einem ständigen Tribunal, dr wie eine innere Stimme über den Einzelnen zu Gericht sitzt. "Wenn Leben zur konomischen Funktion wird", so Ulrich Bröckling, "bedeutet Desinvestment Tod." Soziales Versagen wäre also unterlassene Hilfeleistung gegen sich selbst. Und wer Arbeit hat, soll ein schlechtes Gewissen bekommen; wird er arbeitslos , ist er selbst schuld. So gibt es einen Doppelgänger, der das Schuldgefühl wie einen Schatten begleitet: die Angst überflüssig zu sein.
Der Freiheitsbegriff, für den sich Politiker derzeit stark machen ist auf beunruhigende eise unvollständig. Ein freies und selbstverantwortliches Subjekt, darauf hat der Frankfurter Rechtsphilosoph Klaus Günther hingewiesen, muß erst einmal die soziale Möglichkeit haben, sich selbst entwerfen zu können. Freiheit beruht Selbstbestimmung; wird sie hingegen von außen genötigt, trifft sie also nicht auf die innere Zustimmung, dann wird sie als Disziplinierung erfahren und schlägt um in ihr Gegenteil, in Lähmung und Entfremdung. Was daraus folgt wird vielen Politikern nicht behagen: Damit der Selbstentwurf, das Leben in einer bindungsfähigen, bewußten Freiheit, überhaupt gelingt, darf diese nicht erzwungen oder auf ein ökonomisches Muster reduziert werden.
Und was ist mit dem viel gerühmten angelsächsischen Modell, von dem es heißt, es könne Deutschland den Weg aus der Krise weisen? Es stimmt, Tony Blairs Politik fördert durchaus Eigenverantwortung und "Selbstermächtigung" und sie versucht tatsächlich, Freiheitsspielräume zu eröffnen - aber zum Teil mit Mitteln, die deutlich autoritäre Züge tragen. Seltsam ist auch die Empfehlung, man möge den auf die Vereinigten Staaten richten und sich die amerikanische Gesellschaft zum Vorbild nehmen. Denn der Charme der amerikanischen Freiheit steckt überall, aber gewiß nicht im System seiner Sozialversicherung. Es gibt nämlich gar keine. Die Armutsentwicklung nähert sich den frühen siebziger Jahren an, und selbst konservative Beobachter sehen einen kapitalistischen Neofeudalismus heraufziehen, in dem sich der Staat aller sozialen Verpflichtungen entledigt und barmherzige Großkonzerne je nach Gusto und aus schlechtem Gewissen eine steuerabzugsfähige Suppenküche für die Ärmsten der Armen aufstellen.
Schon heute herrscht in den Vereinigten Staaten wieder ein Maß an Ungleichheit wie zuletzt in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Ein großer Teil des nationalen Reichtums befindet sich in den Händen von zwei Prozent der Bevölkerung und das Jahreseinkommen der reichsten 14.000 Familien ist höher als das der ärmsten 20 Millionen. Zudem hat die Pleite der Firma Enron, bei der Tausende um ihre Altersrücklagen gebracht wurden, auch dem Gutgläubigen klar gemacht, das Konzerne ein stabiles System der sozialen Sicherung nicht ersetzen können. Kein Wunder, daß Kalifornien mehr Geld für den Bau von Gefängnissen ausgibt als für den Bau von Schulen.
Dies alles ist nicht nur ein moralischer Skandal, sondern auch eine Bedrohung für die Freiheit. Sowohl die krasse soziale Ungleichheit wie auch der Einfluß der Großkonzerne auf die Bush-Regierung, unterhöhlen die Grundlagen der Demokratie und wecken dunkle Erinnerungen an die Zeit der großen Gummi-, Eisenbahn-, Stahl- und Öl-Barone.
Es gibt also Grund genug, mit dem Pathos der Freiheit sparsam umzugehen und zu nicht dafür zu mißbrauchen, staatliche Funktionszwänge kosmetisch schönzureden oder die Wähler über das Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft hinwegzutäuschen. Wer nach "Freiheit" vom Sozialstaat ruft, der sollte darüber Auskunft geben, wie eine freie Gesellschaft aussieht, die ihre Mitglieder nicht demütigt, die ihre Chancen und ihren Reichtum gerecht verteilt und dafür Sorge trägt, daß sich die Menschen nicht als Almosenempfänger oder Bittsteller, sondern als Bürger - mit gleichen sozialen Rechten - begegnen.
---------------------------------------------
Assheuer, Thomas (2003): Leben auf eigene Rechnung. Politiker träumen vom neuen freien Individuum. Doch das Lob dieser Freiheit klingt wie ein neuer Zwang, in: >Die Zeit<, 52, 39.
Grode, Walter (2003): Selbstbestimmt Leben und das soziale Modell von Behinderung. Ein richtiges Ziel auf fragwürdiger Basis, in >Gemeinsam leben<, Heft 1; sowie in: >heil-pädagogik-online<, Ausgabe 02
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Walter Grodes "Das neue Lob der Freiheit"?
Der Essay untersucht die Rhetorik der Freiheit im Kontext des Abbaus des Sozialstaates. Er kritisiert, dass die propagierte Freiheit oft mit einer Verlagerung der gesellschaftlichen Lasten auf den Einzelnen einhergeht und eine neue Form der Kontrolle und Disziplinierung darstellt.
Wie kritisiert Grode das Konzept der "neuen Freiheit"?
Grode argumentiert, dass die "neue Freiheit" oft missbraucht wird, um den Rückzug des Staates aus sozialen Verpflichtungen zu rechtfertigen. Er sieht darin weniger eine echte Befreiung, sondern eher eine "Freisetzung", die den Einzelnen zwingt, sich selbst zu optimieren und zu bewirtschaften, während gleichzeitig ein neues Kontrollnetz entsteht.
Welche historische Kritik am Wohlfahrtsstaat wird im Text erwähnt?
Der Text bezieht sich auf Alexis de Tocqueville, der den Wohlfahrtsstaat als eine bevormundende Macht kritisiert, die den Menschen in einem Zustand der Kindheit hält und seinen Willen zermürbt. Auch Ernst Forsthoffs Kritik, der den Sozialstaat als unvereinbar mit einer liberalen Verfassung ansieht, wird erwähnt.
Wie wird der Einfluss von Philosophen wie Nietzsche und Heidegger auf die Kritik am Sozialstaat dargestellt?
Der Text erwähnt, dass Nietzsche und Heidegger im Ruf nach Gerechtigkeit den egalitären Klang der christlichen Brüderlichkeitsethik hörten und den modernen Staat als Produzenten der "Not der Notlosigkeit" kritisierten. Dies spiegelt eine Ablehnung der angeblichen "Verweichlichung" durch den Sozialstaat und einen Wunsch nach "Härte" und "Tragik" wider.
Welche linke Kritik am Wohlfahrtsstaat wird im Text vorgestellt?
Der Text zitiert Jürgen Habermas, der argumentiert, dass der Bürger seine soziale Sicherheit mit Freiheitsverlusten bezahlt. Gerechtigkeit, die in Bürokratien verwaltet wird, kann von "Freiheitsverbürgerung" in "Freiheitsentzug" umschlagen.
Wie beurteilt Grode das angelsächsische Modell im Bezug auf soziale Sicherheit?
Grode ist skeptisch gegenüber der Nachahmung des angelsächsischen Modells, insbesondere der Vereinigten Staaten, da er kritisiert, dass es dort kaum soziale Sicherung gibt und ein Maß an Ungleichheit herrscht, das an die Zeit der "Barone" erinnert. Die Pleite von Enron wird als Beispiel dafür genannt, dass Konzerne kein stabiles System der sozialen Sicherung ersetzen können.
Was ist Grodes Schlussfolgerung bezüglich der "Freiheit vom Sozialstaat"?
Grode plädiert dafür, mit dem Pathos der Freiheit sparsam umzugehen und es nicht zu missbrauchen, um staatliche Funktionszwänge schönzureden oder über das Ende der Vollbeschäftigungsgesellschaft hinwegzutäuschen. Er fordert eine klare Auskunft darüber, wie eine freie Gesellschaft aussieht, die ihre Mitglieder nicht demütigt, ihre Chancen gerecht verteilt und dafür sorgt, dass sich die Menschen als Bürger mit gleichen sozialen Rechten begegnen.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Walter Grode (Autor:in), 2005, DAS NEUE LOB DER FREIHEIT - Vom Leben auf eigene Rechnung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109248