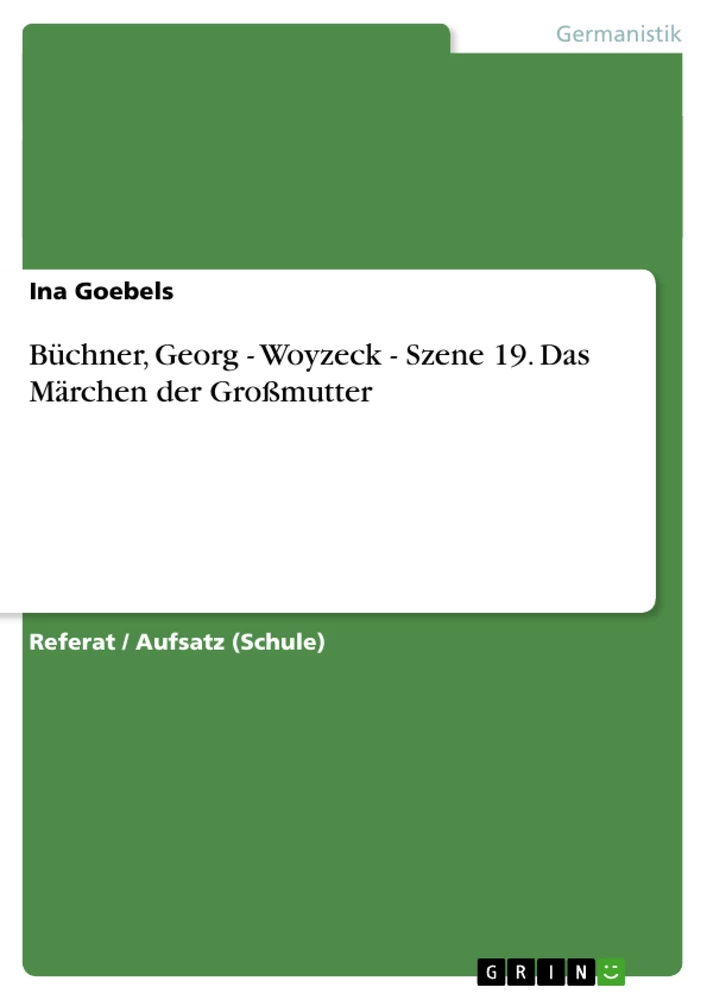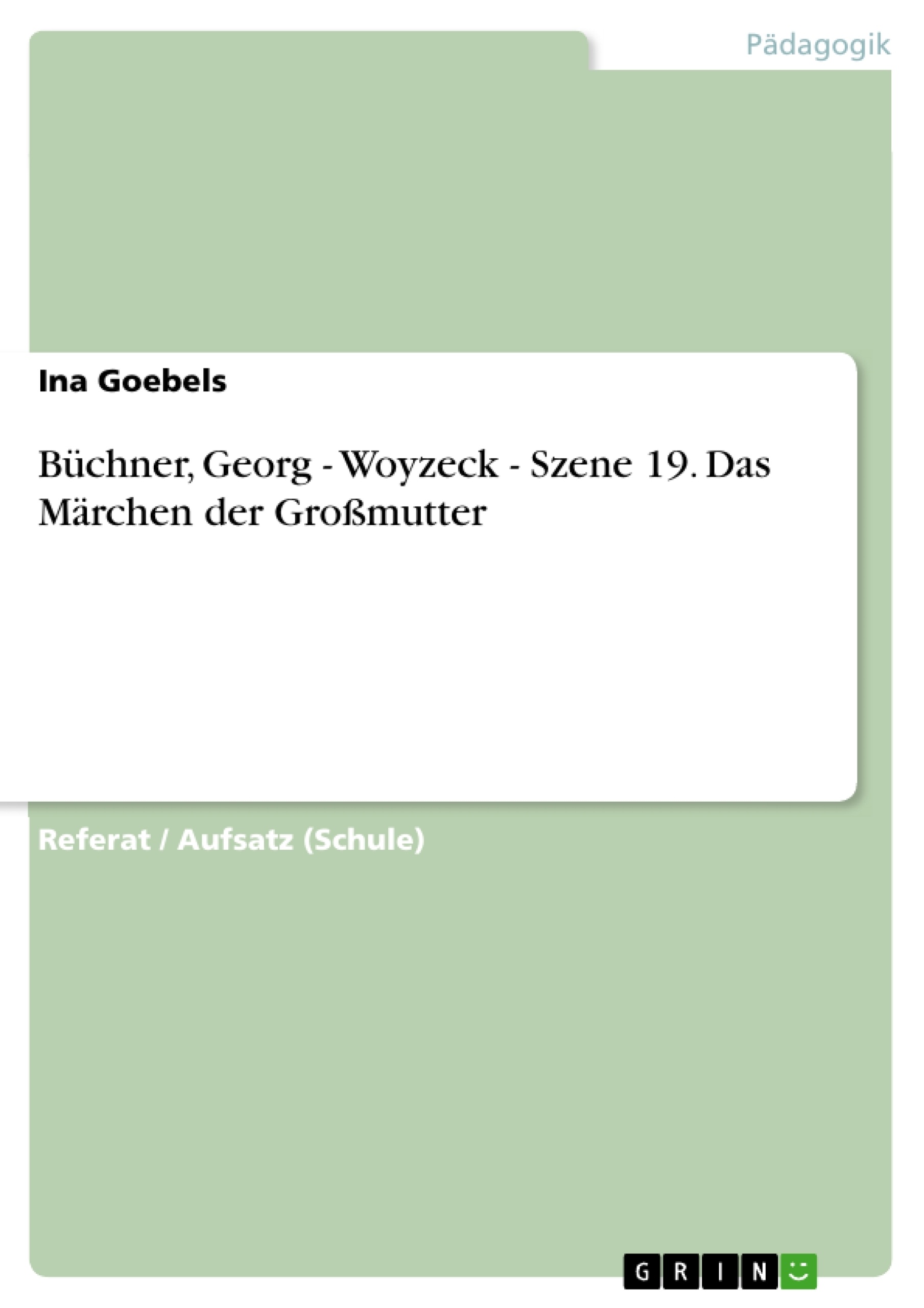Büchners "Woyzeck" stellt in der Geschichte der deutschen Literatur den Beginn des sozialen Dramas dar. Das Werk ist nur als Fragment überliefert und hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Moderne. Es wurde erst im Naturalismus wieder entdeckt und beschreibt eine realistische Darstellung der seelischen Zerstörung eines Menschen. Das Stück wurde in der Epoche des Vormärz geschrieben, dessen Kennzeichen: Unzufriedenheit des Bürgertums, Unsicherheit und Zerrissenheit (Ablehnen oder Klammern an Werte und Normen) sind.
Woyzeck, ein einfacher Soldat, muss, um seine Familie (seine Geliebte Marie und den unehelichen Sohn) ernähren zu können, für den Hauptmann und den Doktor arbeiten. Beide lassen ihn ihre soziale und geistige Überlegenheit spüren. Für letzteren hat er sich zeitweise sogar als medizinisches Versuchsobjekt zur Verfügung gestellt, um seine finanzielle Lage zu verbessern. Seine Braut Marie betrügt ihn aber mit dem Tambourmajor, und der Hauptmann weiß die Eifersucht Woyzecks zu wecken. Hilflos sieht der Arme zu, wie Marie mit dem verdächtigen Tambourmajor im Wirtshaus tanzt, er beginnt einen Streit mit ihm, unterliegt aber. Außer sich über die Untreue Maries gibt er alle Hoffnung auf ein bisschen Glück in dieser Welt auf, denn sie und das Kind waren seine einzige Existenzgrundlage. Heimlich und mit merkwürdiger innerer Beherrschtheit bereitet er alles auf den Tod vor, ersticht seine geliebte Marie auf einem Waldweg, stürzt sich dann in ein tolles Wirtshaustreiben, um schließlich selbst den Tod zu suchen. Er ertränkt sich in einem Teich.
In der 19. Szene „Marie mit Mädchen vor der Haustür“ fordert Marie die Großmutter auf ihr und den drei Kindern eine Geschichte zu erzählen. Großmutter erzählt ein Märchen, das an das Märchen „Sterntaler“ erinnert. Normalerweise gehen Märchen gut aus, aber dieses Märchen geht schlecht aus. Das Kind in dem Märchen hat keine Eltern mehr und sucht ihr Glück beim Mond, der allerdings nur ein Stück Holz war, bei der Sonne, die nur eine vertrocknete Sonnenblume war und bei den Sternen, die nur brennende Mücken. Daraufhin beschließt das Kind zurück zur Erde zu gehen, welche aber inzwischen ein umgestürzter Hafen ist. Das Kind bleibt allein und einsam zurück. Am Ende der Szene tritt Woyzeck auf, der Marie auffordert, mit ihm zu gehen.
Das Märchen charakterisiert das ganze Stück und ist das Symbol für die Existenz Woyzecks. Woyzeck ist der äußerste Gegensatz zum klassischen Ideal zum tragischen Helden. Sein elendes Dasein ist von Hilflosigkeit und Armut geprägt. Er wird vom Leben herumgestoßen ähnlich wie das Kind in Großmutters Märchen. Auch es versucht immer wieder auf eine neue Art und Weise woanders sein Glück zu finden, doch wird immer wieder enttäuscht. Woyzeck verfügt über kein befreiendes Ideenreich, rettendes Gottvertrauen oder schützendes männliches Selbstbewusstsein. Woyzeck wird, wie auch das Kind in Großmutters Märchen als Sinnbild des wehrlosen, unbedeutenden Menschen hingestellt. Woyzeck wird letztendlich vom Armut und der materiellen Welt in den Wahnsinn getrieben. Das Kind in dem Märchen fühlt sich am Ende allein und diese Einsamkeit scheint unvergänglich zu sein. Woyzeck erhält in dem ganzen Stück kaum Geborgenheit und bleibt auch bis zum Ende allein. Woyzeck löst seine Beziehungen zur Umwelt auf und verschachtelt sich immer mehr in seiner eigenen Welt; er ist determiniert. Er geht soweit, dass er aus Eifersucht ein Verbrechen begeht und seine eigentlich geliebte Marie ermordet.