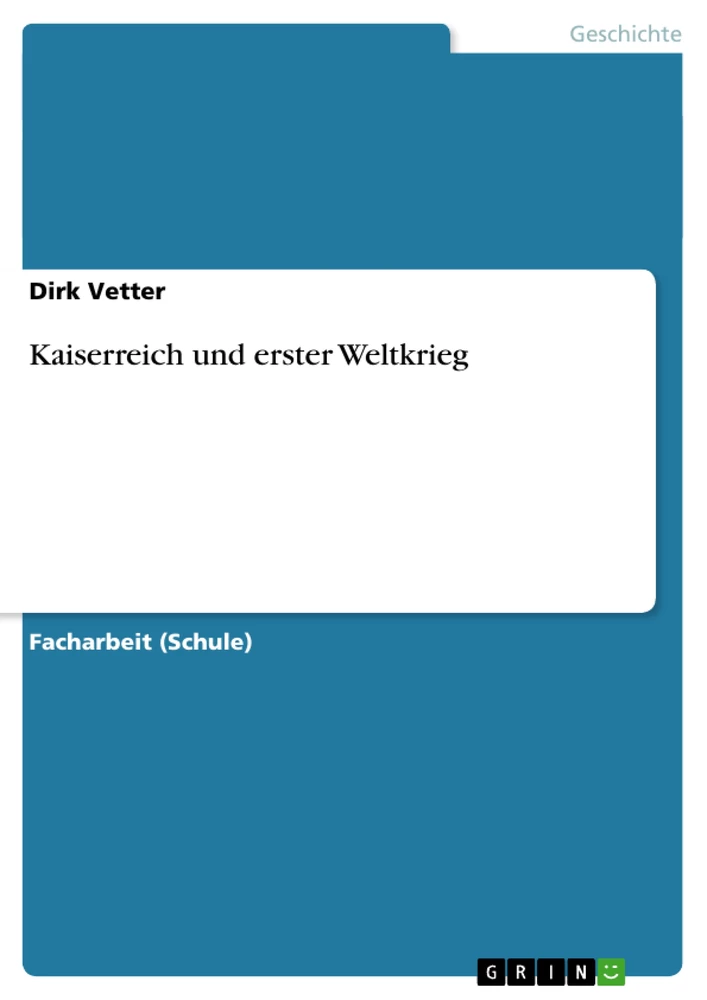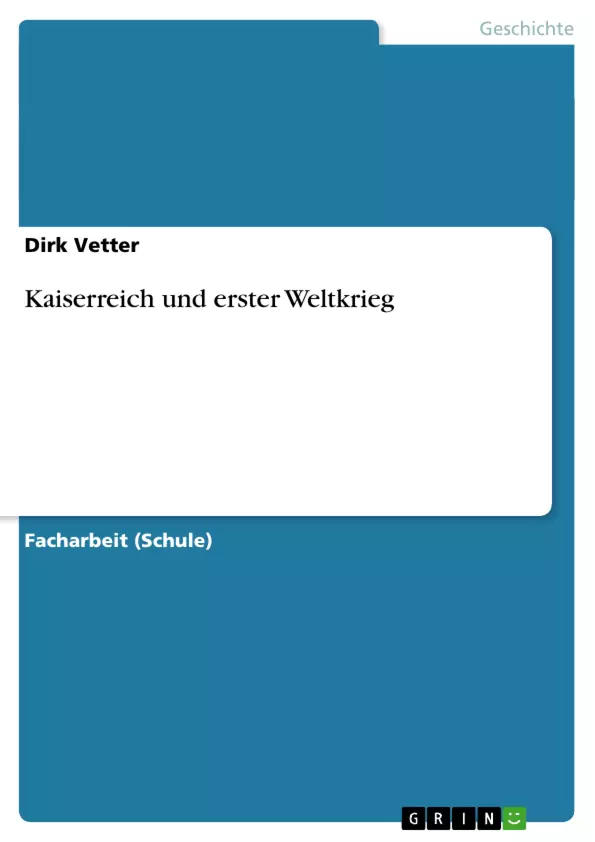Inhaltsverzeichnis
- Reichsgründung
- Die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871
- Bismarcks Innenpolitik
- Bismarcks Außenpolitik
- Umbruch im Kaiserreich
- Wilhelm II. – Das persönliche Regiment des Kaisers
- Julikrise und Kriegsausbruch 1914
- Zusammenbruch des Kaiserreichs
- Quellenangabe
Reichsgründung
Reichsgründung, allgemein der Zusammenschluss verschiedener souveräner Staaten zu einer staatlichen Einheit. Auch verwendet, wenn sich ein Staat in extremem Maße ausgedeht hat. Ein Beispiel ist die Deutsche Reichsgründung 1871. Der Begriff wird nur im Zusammenhang mit autoritär geführten Systemen wie Monarchien oder Diktaturen verwendet.[1]
Versailles, 18. Januar 1871. Der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich war militärisch entschieden, die Hauptstadt Paris war von deutschen Soldaten besetzt.
Nun musste man, nach dem gewonnen Krieg einen neuen Weg einschlagen. Dies wurde im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles gemacht. Um 12 Uhr mittags MEZ begann eine martialische (lat. Kriegerisch, grimmig, wild, verwegen) Zeremonie.
Im Saal befanden sich eng beieinander u.a. deutsche Fürsten, Militärs, Höflinge und Diplomaten. König von Preußen erklärte später dann, dass Wilhelm I. bereit sei, die deutsche Kaiserkrone anzunehmen. Darauf las Kanzler Otto von Bismarck einen Aufruf Wilhelms an das deutsche Volk.
Dann folgte der Höhepunkt des ganzen Spektakels: Großherzig Friedrich I. von Baden proklamierte (lat.-fr. verkündigen, erklären; aufrufen; kundgeben) König Wilhelm zum Kaiser. Zu diesem Anlass schrieen die Anwesenden dreimal „Hoch!“ und erhoben ihre Degen und Helme.
Um 13 Uhr war das Treffen schon wieder vorbei.
Lange ging man davon aus, dass an diesem 18. Januar 1871 das Deutsche Reich gegründet worden sei, doch das ist in dieser Hinsicht nicht vollkommen zutreffend. Schon im November voriges Jahr hatten sich die süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen verbunden und einen Bund geschlossen. Bereits seit dem 1. Januar 1871 existierte staatsrechtlich das Deutsche Reich.
Die Zeremonie am 18. Januar sollte nur deutlich machen, wer nun im Reich das Kommando hat: Der Kaiser, die Fürsten und die militärischen Streitkräfte.
Reichstagsabgeordnete, Volksvertreter waren deshalb mit Absicht nicht eingeladen worden.
Bismarck hatte somit seine „Revolution von oben“(d.h. auf die Ablösung der vom Kaiser ernannten Reichsleitung durch eine neue, erstmals vom Parlament (Reichstag) getragene Reichsregierung) [2]. Gleichwohl war die Reichsgründung aber nicht sein eigenes Werk.
Eine große liberale Nationalbewegung war auch eine treibende Kraft für die Reichseinigung.
Dabei fungierten (lat. Eine bestimme Funktion ausüben) als deren Wortführer der Deutsche Nationalverein, die Deutsche Fortschrittspartei und seit 1867 die Nationalliberale Partei.
Die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Bild[3]
Die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 stellte das monarchische Element in den Vordergrund. Das neue deutsche Kaiserreich war ein Bundesstaat, der Königreiche Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg, die Großherzogtümer Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg und Sachsen-Weimar, die Herzogtümer Anhalt, Braunschweig, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha und Sachsen-Meiningen, die Fürstentümer Lippe, Reuß ältere Linie, Reuß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen und Waldeck sowie die Freien Städte Bremen, Hamburg und Lübeck, dazu das so genannte Reichsland Elsass-Lothringen umfasste. Mehr als 60 % der Einwohner des Reiches lebten im Bundesstaat Preußen.
Die Hauptrolle im politischen System des Kaiserreichs war der Reichkanzler. Sein Vorteil war, dass er sich nur gegenüber dem Kaiser verantworten muss und nicht dem Reichstag. Dennoch waren seine Regierungsakte nur dann gültig, wenn der Kaiser sie unterzeichnet hatte. Der Reichskanzler hatte des weiteren sehr viel Spielraum, da er gleichzeitig noch das Amt des Ministerpräsidenten von Preußen ausübte und den Vorsitz im Bundesrat hatte.
Die einzelnen Aufgaben im Staat waren zwischen dem Reich und den Bundesstaaten folgendermaßen aufgeteilt: Für Justiz, Kultur, Bildung und die gesamte Verwaltung waren die Bundesstaaten verantwortlich.
Für Außenpolitik und Militär war vorrangig das Reich zuständig. Weitere Aufgaben waren die Wirtschaft, Verkehr, Kommunikation, Recht, Handel und Soziales. Diese Felder gewannen sehr schnell an Wichtigkeit.
Obwohl das Kaiserreich sehr obrigkeitlich geprägt war, war es dennoch ein Rechtsstaat.
Merkwürdig ist, dass die politischen Parteien in der Verfassung überhaupt nicht erwähnt werden. Des weiteren gab es auch keine Parteiengesetzgebung, sondern nur ein schlichtes Vereinsrecht.
Ob es Sinn machte, die Parteien zu ignorieren brachte nichts. Sie spielten zunehmend eine wichtige Rolle.
Das Fehlen eines Grundrechtsteils in einer Verfassung muss nicht in jedem Fall ein Mangel sein. Die Bindung der Staatsorgane an die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte kann auch außerhalb der Verfassungsurkunde verbürgt sein[4]
Auszüge aus der Verfassung[5]:
Art. 12 Dem Kaiser steht es zu, den Bundesrats und den Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu schließen
Art. 55 Die Flagge der Kriegs- und Handelsmarine ist schwarz-weiß-rot.
Art. 57 Jeder Deutsche ist wehrpflichtig und kann sich in Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Kaiser (ebenso König von Preußen) konnte die Reichsregierung ernenne und absetzen.
Des weiteren war seine Aufgabe, internationale Verträge abzuschließen. Er bestimmte auch über Krieg und Frieden, er hatte den Oberbefehl über das Militär.
Der Bundesrat war das stärkste Organ. Er war zusammengesetzt aus 58 Vertretern der 25 Länder.
Bismarcks Innenpolitik
Ziele von Bismarck waren u.a. die Vorherrschaft des Adels, also die Bewahrung des sozialen Status. Des weiteren wollte er unbedingt eine Revolution von unten verhindern. Wichtig für ihn war die Bekämpfung aller Nebenhierarchien, die den Kaiser ablehnten. Er nannte diese Leute als „Reichsfeinde“.
Kulturkampf:
Der Kulturkampf wurde von Reichskanzler Bismarck angeführt, gleich nach der Reichsgründung. Er wollte damit zeigen, dass er keine Reichsgegner und Oppositionelle dulden würde. Er sah in den katholischen Minderheiten eine potentielle Gefahr der Sicherheit und Stabilität des Kaiserreichs. Ihnen wurde Ultramontanismus (lat. Jenseits der Berge) nachgesagt. Mit dieser Aussage wurden die Katholiken einfach unterstellt. Sie verhielten sich angeblich illoyal zur deutschen Obrigkeit. Papst Pius IX. war für Bismarck eine Bedrohung, nach seinem Unfehlbarkeitserlass von 1870. Das Zentrum, geleitet als eine politische Organisation der Katholiken, stand im Blickpunkt Bismarcks für seine politischen Überlegungen. Er vermutete, dass sich nach den Reichswahlen (Zentrum war zweitstärkste Partei) weitere oppositionelle Grüppchen bilden könnten. Diese könnten, laut Bismarck, die eben gewonnen „Revolution von oben“ gefährden.
Zuerst wurde die katholische Abteilung im preußischen Kulturministerium aufgelöst.
Im Jahr 1872, bereits ein Jahr darauf, wurde die geistliche Schulaufsicht in Preußen durch eine staatliche Aufsicht ersetzt.
Des weiteren durften sich Jesuiten im Reich nicht mehr niederlassen.
Die Ausbildung und Einstellung der Geistlichen wurde kontrolliert und auch die kirchliche Vermögensverwaltung wurde umstrukturiert.
Ein großer Akt Bismarcks war es, die Eheschließung nur noch vor dem Gesetz gültig werten zu lassen. Die Eheschließung in der Kirche sollte nur noch als Symbolik dienen.
Diese Maßnahmen sollten eigentlich die katholischen Kräfte im Reich schwächen, aber der Papst nutzte diese Situation als Propagandazwecke.
Am Ende Bismarcks Kulturkampfes erreichte er eher das Gegenteil, was er eigentlich vorhatte. Die Zentrumspartei erlangte immer mehr an Zulauf und die Haltung der Antipreußen verstärkte sich.
Dies war Bismarcks erste innenpolitische Niederlage.
Die Sozialistengesetze :
Ähnlich wie schon im Kulturkampf mit der katholischen Kirche hatte der Kampf Bismarcks mit der Sozialdemokratie. Dies Begann Ende der 70er Jahre. Einen Aufstieg der Sozialdemokraten konnte man nach der Vereinigung der marxistischen und lassalleanischen Richtung verzeichnen. Bismarck erkannte den ständigen Zuwachs der Arbeiterbewegung. Nach der wirtschaftlichen Flaute im Jahr 1873 konnte man mit noch einem höheren Zuwachs rechnen. 1877 hat sich der prozentuale Anteil der Stimmen im Reichstag verdreifacht, die Anzahl der Mandate sogar versechsfacht.
Auf der einen Seite bekämpfte Bismarck die Sozialdemokratie mit Gesetzen, auf der anderen Seite kam er der Arbeiterschaft durch verschiedene Gesetzgebungen entgegen. Die massive Repression (Unterdrückung) von Sozialdemokraten begann zuerst im Herbst 1878. Das „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ wurde verabschiedet. Ein Grund für dieses Gesetz wurde schnell gefunden. Bismarck schob die Schuld eines Attentats auf Wilhelm I. in die Schuhe der Sozialdemokratie. Dies löst die Organisationen und Vereine unter der roten Fahne auf.
Nun begann eine willkürliche Zeit, geprägt von Verhaftungen von sozialdemokratischen Gesinnungsgenossen. Die Polizei hatte sogar das Recht auf bloßem Verdacht und ohne Prozess Sozialdemokraten auszuweisen.
Leider konnte Bismarck auch mit diesem Vorhaben seine Innenpolitik nicht stärken. Die Arbeiterschaft konnte sich dadurch als eigenständige gesellschaftliche Gruppierung identifizieren. Ab 1881 konnte die Sozialdemokratie einen ständigen Zuwachs verzeichnen, dies hatte zur Folge, dass sie bereits 1890 stärkste Fraktion im Reichstag waren.
Folgende Gesetze wurden verabschiedet: Krankenversicherung (1883), Unfallversicherungsgesetz (1884) und Invalidität und Altersversicherung (1889).
Der Versuch die Sozialdemokratie zu stoppen ging mächtig schief. So musste Bismarck einsehen, dass sie Sozialdemokraten immer mächtiger und einflussreicher wurden als parlamentarische Kraft. Sie blieben jedoch dauernd ein Gegner mit dem obrigkeitsstaatlichen System.
Bismarcks Außenpolitik
Voraussetzung für Bismarcks erfolgreiche Außenpolitik war die "Saturiertheit" des Reiches nach der Reichseinigung von 1871, das heißt der Verzicht auf weitere Expansion und weitere Annexionen[6]. Sein Ziel war es ein Mächtegleichgewicht herzustellen. Des weiteren wollte Bismarck nicht, dass Deutschland in mitten Europas isoliert wird. Bismarck wollte auch nicht, dass es einen Krieg gibt, denn er wollte einen Zweifrontenkrieg (Frankreich und Russland) verhindern.
Der erste Schritt dazu war das Dreikaiserabkommen von 1873. Dies besagte ein Zusammenhalt von Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland im Falle eines Krieges.
Somit erreichte Bismarck auch eine Isolierung Frankreichs. Das Dreikaiserabkommen löste sich 1876 langsam auf, als Russland mit Österreich in einem Konflikt stand, wegen der Balkankrise (Zerfall des Osmanischen Reichs). Österreich wollte nämlich, dass das Osmanische Reich fortbestand, aber Russland wollte mehr politischen Einfluss und war für die Entwicklung der Aufspaltung. Deutschland verhielt sich bei diesem Konflikt neutral, da er Österreich nicht in den Rücken fallen wollte und Russland nicht schwächen wollte. Russland und Türkei bekriegten sich danach, doch die Türkei verlor diesen Krieg.
Im Sommer 1878 fand der Berliner Kongress statt. Teilnehmer waren Russland, Österreich-Ungarn, Großbritannien, Frankreich, Osmanisches Reich, Italien, Deutschland. Der Kongress tagte unter dem Vorsitz von Bismarck, der weder „Schiedsrichter“ noch „Schulmeister“ in Europa sein wollte.
Ergebnis des Kongresses waren unter anderem die Verkleinerung Bulgariens und dass Österreich Bosnien und Herzegowina verwalten durfte. Serbien, Montenegro und Rumänien blieben unabhängig. Doch Russland und die Türkei waren mit diesem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden, da sie sich isoliert fühlten. Es kam zum Scheitern des Dreikaiserabkommens.
Im Jahre 1879 gab es einen Zweibund zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn. Dieser Bund sagte, dass diese zwei Länder bei einem Krieg mit Russland zusammen kämpfen würden. Man kann sagen, dass bis zum 1. Weltkrieg 1914 dieses Bündnis die Grundlage der deutschen Außenpolitik war.
1881 kam es zu einer Art Erneuerung des Dreikaiserabkommens. Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland bildeten ein Dreikaiserbündnis. Diese Bündnis solle Neutralität eines Krieges sichern, falls es zum Krieg mit einer vierten Macht kommen sollte. Deutschlands vierte Macht war Frankreich, Russlands vierte Macht war hingegen England. Diese Bündnis sicherte einen Zweifrontenkrieg Deutschlands. Dennoch konnte diese Gefahr nur dann eingeräumt werden, wenn es Russland und Österreich-Ungarn gelingt friedlich auf dem Balkan miteinander umzugehen.
Etwa 10 Monate später, Mai 1882, wurde das Dreikaiserbündnis durch den Dreikaiservertrag sehr verstärkt.
Der Zweibund von Deutschland und Österreich-Ungarn wurde 1882 erweitert. Italien soll den Frieden in Europa mit sichern. Somit entstand der Dreibund.
1887 schloss Bismarck mit Russland den Rückversicherungsvertrag, der das Ziel hatte, vertragliche Sicherungen für die Ostgrenze Deutschlands zu erreichen. Neutralitätsversprechen zwischen Russland und Deutschland (für den Fall eines französischen Angriffs auf Deutschland und eines österreichischen auf Russland).
Die Kolonialpolitik war nicht der Freund von Bismarck. Er sah diese Politik eher skeptisch. Für ihn waren Kolonien eher Handelsstützpunkte. Bismarck konzentrierte sich eher auf das Kräfteverhältnis in Europa. Trotzdem erwarb Deutschland zur Zeit Bismarcks die meisten Kolonien. 1883 kam es schließlich zu kolonialen Spannungen zwischen Deutschland und England. Ein weiterer Grund für die Ablehnung von Kolonien waren die feindlichen Koalitionen die sich hätten bilden können. Erst nach Bismarck, zur Zeit Wilhelm II. kam es zu einer richtigen Kolonialpolitik.
Umbruch im Kaiserreich
Im Jahre 1888, das sogenannte Dreikaiserjahr ist entscheidend für den weiteren Verlauf des deutschen Reichs. Am 9. März 1888 starb Wilhelm I. mit 91 Jahren. Sein Nachfolger, sein Sohn Friedrich III., der bereits todkrank war, starb nur nach 99 Tagen Regentschaft am 15. Juni an Kehlkopfkrebs. Am selben Tag übernahm der älteste Sohn Friedrich Wilhelm, Wilhelm II. die Arbeit. Er verehrte Bismarck als Reichsgründer und Politiker, fand dessen Vorgehensweise jedoch antiquiert (lat. Veraltet, nicht mehr zeitgemäß, altmodisch, überholt).
In einem Zeitraum von nur 6 Tagen (15. März bis 20. März 1890) drängte er Bismarck zum Rücktritt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild[7]
„Der Lotse geht von Bord“
Ein sehr bekanntes Bild, auf dem sieht, wie Otto von Bismarck von Bord geht und Wilhelm II. von oben hinabschaut auf ihn.
Bismarck, der 19 Jahr treu dem Kaiserreich gedient hatte, wird nun von einem 29-jährigen zum Rücktritt gezwungen.
Wilhelm II. – Das persönliche Regiment des Kaisers
Wilhelm II. war ein Egozentriker (gr.-lat. Die eigene Person als Zentrum allen Geschehens betrachtend). Er hatte vor allem keine politischen Grundideen wonach er handeln könnte und es fehlte ihm an einer Weltanschauung.
Man sagt ihm nach, dass er eine sprunghafte Persönlichkeit hatte. Des weiteren war er geprägt durch Sucht nach öffentlicher Anerkennung, z.B. brauchte er Beifall der Öffentlichkeit.
Wilhelm II. wollte sein eigener Kanzler sein und er nutze auch Möglichkeiten die ihm in der Verfassung zugestanden sind, nicht so wie Wilhelm I..
Wie auch später bei Hitlers Regime war das Heer sehr wichtig für Wilhelm II. Er sah es auch als Grundlage für ein gut funktionierendes Reich. Laut Verfassung konnte nur der Kaiser politische und militärische Interessen abstimmen. Nachdem Bismarck von der Bildfläche verschwunden ist, fehlte dem Reich ein „Lotse“ der das deutsche Volk führte.
Seine ersten zwei Nachfolger Caprivi (1890 -1894), von Hohenlohe-Schillingsfürst (1894 – 1900) unterlagen voll den Befehlen von Wilhelm II. und machten sozusagen das, was der Kaiser von ihnen verlangte. Erst Reichskanzler von Bülow (1900 – 1909) versuchte den Kaiser etwas zu lenken, dennoch gelang es ihm nicht.
Kaiser Wilhelm II. schlug einen komplett „Neuen Kurs“ ein. So geriet das von Bismarck aufgebaute Kräftegleichgewicht in Europa ins Wanken. So verlängerte er (durch Kanzler Caprivi) 1890 den geheimen Rückversicherungsvertrag mit Russland nicht weiter. Die Auswirkungen wurden zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bedacht. Russland verbündete sich nun mit Frankreich. So war es möglich, dass Deutschland in einen Zweifrontenkrieg geraten kann. Nun wäre ein Bündnis Deutschlands mit Großbritannien von großem Vorteil gewesen. Die deutsch-britischen Beziehungen verschlechterten sich jedoch, als man Mitte der 1890er Jahre mit dem Aufbau einer deutschen Hochseeflotte begann.
Ein Bündnis zwischen Frankreich und Großbritannien, die Entente cordiale, die später mit Rußlands Beitritt zur Triple-Entente ausgeweitet wurde, führte schließlich zur Isolation des Deutschen Reiches, dem außer Österreich-Ungarn kein Bündnispartner mehr geblieben war.
Wilhelm II. Heeres- und Flottenpolitik kennzeichnete seine Ausführung als Kaiser.
Der Bau der Kriegsflotte war sein eigenes Werk. Er wollte damit England abschrecken, Deutschland anzugreifen, denn Wilhelm II. wollte so eine starke Kriegsflotte bauen, dass er Englands Machtstellung sehr schädigen konnte. Die Flottenfrage belastete das deutsch-englische Verhältnis schwer.
Im Gegensatz zu Bismarck forderte Wilhelm II. den Imperialismus (Def.: Imperialismus ist die Bezeichnung für die Bestrebungen eines Staates, die Herrschaft oder zumindest Kontrolle über andere Länder oder Völker zu erringen. Letzteres kann über politische, ökonomische oder kulturelle Einflussnahme und Unterwerfung geschehen)[8].
Des weiteren steigt das Nationalismusgefühl (starkes, meist intolerantes, übersteigertes Nationalbewusstsein, das Macht u. Größe der eigenen Nation als höchsten Wert erachtet) [9] weiter an. Es gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Die Kolonialpolitik stieg Wilhelm II. zu Kopf. Er wollte so gut wie zu jedem Preis Kolonien erringen. Doch er vernachlässigte dabei die Verbindungen innerhalb Europa. Deutschland wurde immer isolierter. Um aus dieser Umklammerung überhaupt wieder herauszukommen, war der Krieg die einzige Möglichkeit.
Julikrise und Kriegsausbruch 1914
Durch das Attentat von Sarajewo am 28. Juni 1914 ausgelöste internationale Krise , die über österreichische Kriegserklärung zum 1. Weltkrieg führte.[10]
Die Ermordung des Österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Frau am 28. Juni 1914 in Sarajewo lösten eine unheilvolle Aneinanderreihung von Missverständnissen, Fehlurteilen und Überreaktionen aus.[11]
Daraufhin stellte Österreich-Ungarn den Serben ein Ultimatum, welches sie nicht einlösen konnten. Somit haben Österreich-Ungarn einen Grund gefunden um einen Krieg zu führen.
Zusammenbruch des Kaiserreiches
Die militärische katastrophale Lage des Deutschen Reichs im September 1918 führte zu einer Bildung einer parlamentarischen Regierung die unter Prinz Max von Baden geleitet wurde. Seine Aufgabe war unter anderem, einen Waffenstillstand mit den Alliierten auszuhandeln.
Das Deutsche Reich brach nach der Kriegsniederlage und der Novemberrevolution vollends zusammen. Wilhelm II. hatte am 9. November 1918 durch die Verkündigung von Reichskanzler Prinz Max von Baden abgedankt. Wilhelm II. übergab vor seiner Flucht nach Holland die Regierungsgeschäfte an Friedrich Ebert.
Am selben Tag wurde in Deutschland die Republik ausgerufen.
Ein Volk, das keine Vergangenheit haben will, verdient auch keine Zukunft (Alexander von Humboldt)
Quellenangabe
- http://216.239.59.104/search?q=cache:GQ-e2_M_C5MJ:www.thueringen.de/imperia/md/content/text/lzt/16.pdf+Verfassung+1871&hl=de
- http://www.finanz-xl.de/lexikon/Deutsches_Kaiserreich_(Zweites_Reich)_Gruendung_18.html
- http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich
- http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/
- Winfried Halder, Innenpolitik im Kaiserreich 1871 – 1914; 2003
- Klaus Hilfebrand, Deutsche Außenpolitik 1871 – 1918; 1989
- Brockhaus, 6. Auflage
- Otto Ziere, Welt- und Kulturgeschichte in 10 Bänden Band IV; 1981
[...]
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsgr%C3%BCndung
[2] http://www.salvator.net/salmat/pw/pw1/weimar/nieder.htm
[3] http://www.lsg.musin.de/Geschichte/Deutsches%20Reich/Verfas1.jpg
[4] http://de.wikipedia.org/wiki/Bismarcksche_Reichsverfassung
[5] http://www.lsg.musin.de/Geschichte/Quellen/verfassungen/verfassung1871.htm
[6] http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
[7] http://home.arcor.de/maria.rentsch/History/Bilder/bismar2.jpg
[8] http://www.lsg.musin.de/Geschichte/Deutsches%20Reich/imperialismus1.htm
[9] DUDEN – Das Fermdwörterbuch
[10] Der Große Brockhaus 18. Auflage – Band 6
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Reichsgründung?
Die Reichsgründung bezeichnet allgemein den Zusammenschluss verschiedener souveräner Staaten zu einer staatlichen Einheit. Der Begriff wird oft im Zusammenhang mit der Deutschen Reichsgründung 1871 verwendet, einem Beispiel für ein autoritär geführtes System.
Was waren die wichtigsten Aspekte der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871?
Die Verfassung stellte das monarchische Element in den Vordergrund. Das Kaiserreich war ein Bundesstaat mit Preußen als dominierender Kraft. Der Reichskanzler, verantwortlich nur dem Kaiser gegenüber, spielte eine zentrale Rolle. Obwohl obrigkeitlich geprägt, war es dennoch ein Rechtsstaat.
Was waren Bismarcks Ziele in der Innenpolitik?
Bismarcks Ziele umfassten die Bewahrung des sozialen Status des Adels, die Verhinderung einer Revolution von unten und die Bekämpfung von "Reichsfeinden", die den Kaiser ablehnten. Der Kulturkampf und die Sozialistengesetze waren zentrale Elemente seiner Innenpolitik.
Was war der Kulturkampf unter Bismarck?
Der Kulturkampf war Bismarcks Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, in der er eine Gefahr für die Stabilität des Reiches sah. Er führte zu Maßnahmen wie der Auflösung der katholischen Abteilung im preußischen Kulturministerium und der staatlichen Kontrolle der Schulaussicht.
Was waren die Sozialistengesetze?
Die Sozialistengesetze waren ein Versuch Bismarcks, die Sozialdemokratie zu unterdrücken. Sie führten zur Auflösung sozialdemokratischer Organisationen und Vereine, sowie zu Verhaftungen und Ausweisungen von Sozialdemokraten.
Was waren die Hauptziele von Bismarcks Außenpolitik?
Bismarcks Außenpolitik zielte auf ein Mächtegleichgewicht in Europa ab, um die Isolierung Deutschlands zu verhindern und einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden. Das Dreikaiserabkommen und der Berliner Kongress waren wichtige Instrumente dieser Politik.
Was war das Dreikaiserabkommen?
Das Dreikaiserabkommen von 1873 war ein Bündnis zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland, das den Zusammenhalt im Falle eines Krieges vorsah und Frankreich isolieren sollte.
Was geschah im "Dreikaiserjahr" 1888?
Im Jahr 1888 starben drei Kaiser: Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm II. Wilhelm II. bestieg den Thron und entließ Bismarck 1890, was einen Umbruch im Kaiserreich markierte.
Was war das "persönliche Regiment" von Wilhelm II.?
Wilhelm II. strebte eine persönliche Herrschaft an und mischte sich stark in politische und militärische Angelegenheiten ein. Er verfolgte einen "Neuen Kurs", der das von Bismarck aufgebaute Kräftegleichgewicht in Europa störte.
Was war die Julikrise 1914?
Die Julikrise war die internationale Krise, die durch das Attentat von Sarajewo am 28. Juni 1914 ausgelöst wurde und zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte.
Wie kam es zum Zusammenbruch des Kaiserreichs?
Die militärische Niederlage im Ersten Weltkrieg und die Novemberrevolution führten zum Zusammenbruch des Kaiserreichs. Wilhelm II. dankte ab, und die Republik wurde ausgerufen.
- Citar trabajo
- Dirk Vetter (Autor), 2005, Kaiserreich und erster Weltkrieg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109284