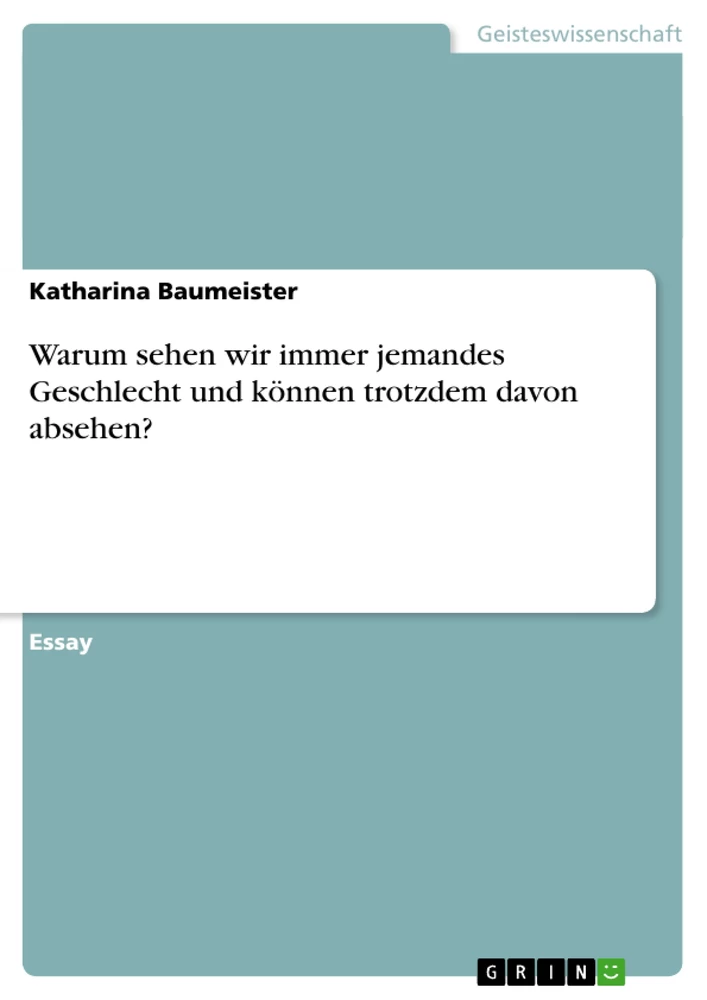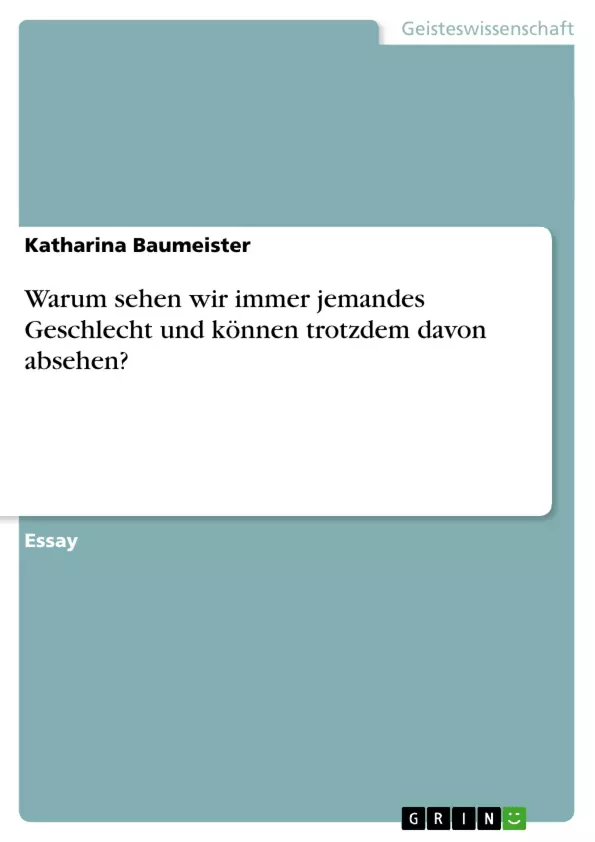Gliederung
1. Einleitung
2. „Doing gender“ und „Undoing gender“
3. Schluss
1. Einleitung
„Es ist ein Mädchen!“ „Es ist ein Junge!“ Diese Aussagen sind uns aus beispielsweise filmischen Darstellungen hinlänglich bekannt und wir assoziieren damit die „Bekanntmachung“ mit einem Neugeborenen. Nach Tyrell ergibt sich Geschlechtszuschreibung „aus dem Blick auf vorgefundene Fakten“ (Tyrell 1986, S. 474), wenn man sich an die Unterscheidung von Geburt an hält. Geschlecht scheint also das Erste zu sein, das man von einem Menschen erfährt und dies bleibt das ganze Leben so. Geschlecht fungiert beispielsweise in Interaktionen als Auflöser doppelter Kontingenz, denn durch das Geschlecht können die Akteure Ego und Alter mögliche Kommunikationsskripten verwenden und so mit Hilfe von Geschlechtsstereotypen Komplexität reduzieren. Man kann also sagen, dass durch die Kategorisierung in zwei Geschlechter aus Fremden Bekannte werden können. (vgl. Hirschauer 2001, S. 220) Im Folgenden soll erörtert werden, warum wir immer jemandes Geschlecht sehen und trotzdem davon absehen können.
2. „Doing gender“ und „Undoing gender“
„Die Geschlechtszugehörigkeit wird im Normalfall weder erfragt noch mitgeteilt, sondern dargestellt.“ (Hirschauer 1994, S. 672) Geschlecht ist also etwas, das Menschen explizit zur Darstellung bringen – darum sehen wir es. Der Körper dient dabei als „Darstellungsmedium“ (vgl. Hirschauer 1994, S. 674). Die Geschlechtszugehörigkeit der Akteure ist also weitgehend geheimnislos. Der soziologische Begriff von Geschlecht wird als „doing gender“ bezeichnet. Demnach ist die „Geschlechtszugehörigkeit ein fortlaufender Prozess, eine interaktive Praxis der Darstellung und Attribution, die ein Alltagswissen von den Strukturen sozialer Wirklichkeit reproduziert“ (Hirschauer 1994, S. 670).
In der Interaktion werden die Akteure durch die Aktualisierung von Stereotypen mittels Mimik, Gestik oder Äußerungen zu „Mann“ oder „Frau“. Weinbach und Stichweh beschreiben, warum das Geschlecht gerade in Interaktionen eine Rolle spielt, denn da wird das „Problem doppelter Kontingenz vielfach in der Weise gelöst werden, dass in Abwesenheit anderer relevanter Indikatoren auf visuelle Eindrücke zurückgegriffen wird“ (Weinbach/Stichweh 2001, S. 46). Geschlecht wird hier durch explizite Darstellung mittels Kleidung und Haartracht verstärkt. Die Autoren gehen davon aus, dass Interaktionssysteme ihren Personen neben den internen Rollenverpflichtungen zugleich sexuierte externe unterstellen, was zu verschiedenen Erwartungen an männliche und weibliche Akteure führt. Man kann also sagen, dass Personen das Geschlecht immer mitbringen und so ein Erwartungsbündel innehaben. Man sieht das Geschlecht und verbindet etwas damit – seine Erwartungen.
Können wir nun aber dennoch vom Geschlecht einer Person absehen, obwohl wir es ständig sehen? Hirschauer verweist darauf, dass man nur von etwas absehen könne, „das man gesehen hat.“ (Hirschauer 2001, S. 216) Wie bereits oben erwähnt, kann die Geschlechtszugehörigkeit in der Interaktion aktualisiert werden. Geschieht dies nicht, „ereignet sich ein praktiziertes ‚Absehen’ von ihr, eine Art soziales Vergessen“ (Hirschauer 1994, S. 678). Dies sei eine Art konstruktive Leistung. Soziales Vergessen meint, dass nicht die Geschlechtszugehörigkeit vergessen wird, sondern das Geschlecht in der sozialen Praxis nicht relevant ist. Entscheidend ist hier, ob die Teilnehmer an das Geschlecht ihrer Interaktionspartner anknüpfen oder nicht. Wenn die Geschlechterdifferenz im Verlauf der Interaktion in den Hintergrund tritt, spricht Hirschauer von „undoing gender“. Mit dieser Begriffsbestimmung, die eine vorübergehende situative Neutralisierung der Geschlechterdifferenz beschreibt, bringt Hirschauer auch Einwände gegen die Omnirelevanz-Annahme von Gender zum Ausdruck. Zum einen verweist er auf die „relative Signifikanz der Geschlechterunterscheidung im Vergleich (…) zu anderen Klassifikationen“ (Hirschauer 1994, S. 676) wie Alter, Ethnizität oder Schichtzugehörigkeit. Eine weitere Schwäche der Omnirelevanz-Annahme sieht Hirschauer in der mangelnden Prüfung von Hindergrund und Vordergrund der Kommunikation von Gender. Er geht von einer „Diskontinuität der Geschlechtskonstruktion“ (Hirschauer 1994, S. 677) aus, denn der Prozess der Geschlechtskonstruktion bestehe aus Episoden, in welchen Geschlecht in sozialen Situationen auftauche und verschwinde.
Nach Heintz und Nadai ist „undoing gender“ eine „ebenso komplexe Darstellungsleistung wie die Inszenierung von Geschlecht.“ (Heintz/Nadai 1998, S. 82) In ihrer Studie untersuchten sie die Darstellung von Geschlecht in typischen Männer- und Frauenberufen. Dabei fanden sie unter anderem heraus, dass es Kontexte gibt, in denen das Geschlecht keine Rolle spielt. Der Beruf des Sachbearbeiters etwa steht Männern wie Frauen offen und wird auch in prozentual etwa gleichen Teilen von beiden Geschlechtern ausgeübt – er ist sozusagen entgenderisiert, denn das Geschlecht ist für die Anforderungen des Berufs und dessen Ausübung irrelevant. Sie fassen zusammen: „Im Vergleich zur Krankenpflege und Informatik ist die Sachbearbeitung geschlechtlich unbestimmt.“ (Heintz/Nadai 1998, S. 86) Geschlecht tritt also beim Beruf des Sachbearbeiters in den Hintergrund. Dass das Geschlecht erst durch die Struktur der Situation relevant wird, kann man auch beispielsweise in der ethnographischen Studie zum „Gebrauch der Geschlechterunterscheidung in der Schulklasse“ von Breidenstein sehen. Hier werden von Schülern und von den Beobachtern (einer davon ist männlich, der andere weiblich) jeweils die Geschlechter unterschieden, wobei die Lehrerin als neutrale „Grenze zwischen den Geschlechtern fungiert“ (Breidenstein 1997, S. 347). Geschlecht wird demnach zumindest von den Schülern nicht geschlechtlich gesehen, wenn es keinen Gegenpart gibt.
Baecker bezieht sich in seinem Aufsatz über „Männer und Frauen im Netzwerk der Hierarchie“ auf Eric Leifer (vgl. Baecker 2003, S. 137), der die kommunikative Arbeit als Oszillation der Wahrnehmung, Neutralisierung, Kommunikation der Neutralisierung und Kommunikation der möglichen Neutralisierung der Neutralisierung von Wahrnehmungen sieht. Er unterscheidet hier die Kommunikation von der Wahrnehmung und die Darstellung von der Behandlung. Geschlecht wird zwar wahrgenommen, kann in der Kommunikation aber abgekoppelt werden. Baecker geht davon aus, dass aus gegenseitiger Wahrnehmung zweier Personen schon Geschlechtsdarstellung erfolgt. Das macht aus den Verhaltensweisen der Akteure bereits Darstellungen. In einem weiteren Schritt bedarf es dann einer Mitteilung, dass das Geschlecht abgekoppelt wird, also einem Signal, dass das, was wahrgenommen wird nichts zur Sache tut. Der letzte Schritt, der dieses Hin und Her zweier bistabiler Zustände beschreibt, ist die Kommunikation der möglichen Neutralisierung der Neutralisierung von Wahrnehmungen. Die Koexistenz der geschlechtsneutralen Strukturen wird dabei revidiert. Alles in allem wird hier eine Unbestimmtheit beschrieben, die aber in einer Kommunikation bestimmt werden kann. Dies heißt, dass es Akteuren möglich ist, in der Kommunikation sowohl „doing gender“ als auch „undoing gender“ zu betreiben.
3. Schluss
Eingangs wurde die Frage gestellt, warum wir jemandes Geschlecht immer sehen, aber trotzdem davon absehen können. Ein Versuch, diese zu beantworten, wurde mit Hilfe der Begriffe „doing gender“ und „undoing gender“ im Hauptteil unternommen. Zusammenfassend lässt sich nun sagen, dass das Geschlecht eines Menschen eines seiner markantesten Merkmale ist, weil er es darstellt und man schon immer entsprechend instruiert wurde, dass es Mann und Frau gibt. Man sieht Geschlecht also, es reduziert Komplexität und bietet auch immer einen Anknüpfungspunkt für Kommunikationen. Jeder hat schließlich im Laufe seiner Sozialisation gelernt, wie man mit Gleichgeschlechtlichen oder Personen des anderen Geschlechts kommuniziert. Dennoch kann das Geschlecht im Laufe der Interaktion neutralisiert werden. Dies geschieht dann, wenn es nicht mehr aktualisiert wird. Damit wird Geschlecht in spezifischen Kommunikationen und Kontexten irrelevant – man kann davon absehen.
Literaturverzeichnis
Baecker, Dirk (2003): Männer und Frauen im Netzwerk der Hierarchie. S. 125-143. In: U. Pasero/ C. Weinbach (Hg.) Frauen, Männer, Gender Trouble. Frankfurt: Suhrkamp
Breidenstein, Georg (1997): Der Gebrauch der Geschlechterunterscheidung in der Schulklasse. Zeitschrift für Soziologie 26: S. 337-351
Heintz, Bettina/ Eva Nadai (1998): Geschlecht und Kontext. De-Institutionalisierungsprozesse und geschlechtliche Differenzierung. Zeitschrift für Soziologie 27: S. 75-93
Hirschauer, Stefan (1994): Die soziale Fortpflanzung der Zweigesclechtlichkeit. Kölner Zeitschrif für Soziologie und Sozialpsychologie 46: S. 686-692
Hirschauer, Stefan (2001): Das Vergessen des Geschlechts. Zur Praxeologie einer Kategorisierung sozialer Ordnung. S. 208-235. In: B. Heintz (Hg.) Geschlechtersoziologie. Opladen: Westdeutscher Verlag
Tyrell, Hartmann (1986): Geschlechtliche Differenzierung und Geschlechterklassifikation. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 38: S. 450-489
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text behandelt die Konzepte "Doing Gender" und "Undoing Gender" in Bezug auf soziale Interaktionen. Er untersucht, warum wir Geschlecht wahrnehmen und wie wir dennoch davon absehen können.
Was bedeutet "Doing Gender"?
"Doing Gender" beschreibt, wie Geschlecht in Interaktionen durch die Darstellung und Zuschreibung von Geschlechtszugehörigkeit konstruiert und reproduziert wird. Es ist ein fortlaufender Prozess, bei dem Stereotypen durch Mimik, Gestik oder Äußerungen aktualisiert werden.
Was bedeutet "Undoing Gender"?
"Undoing Gender" bezieht sich auf das praktische Absehen vom Geschlecht in sozialen Interaktionen, eine Art soziales Vergessen, bei dem Geschlecht nicht relevant wird. Es beschreibt eine vorübergehende situative Neutralisierung der Geschlechterdifferenz.
Wie wird Geschlecht in Interaktionen dargestellt?
Geschlecht wird durch explizite Darstellung mittels Kleidung, Haartracht, Mimik und Gestik verstärkt. Der Körper dient als "Darstellungsmedium".
Warum spielt Geschlecht in Interaktionen eine Rolle?
Geschlecht spielt eine Rolle, weil es das "Problem doppelter Kontingenz" lösen kann, indem es Akteuren ermöglicht, anhand visueller Eindrücke mögliche Kommunikationsskripten zu verwenden und so Komplexität zu reduzieren.
Kann man vom Geschlecht einer Person absehen, obwohl man es ständig sieht?
Ja, man kann vom Geschlecht absehen, wenn es in der Interaktion nicht aktualisiert wird. Dies geschieht durch eine Art konstruktive Leistung, ein soziales Vergessen, bei dem das Geschlecht in der sozialen Praxis nicht relevant ist.
Welche Einwände gibt es gegen die Omnirelevanz-Annahme von Gender?
Hirschauer verweist auf die relative Signifikanz der Geschlechterunterscheidung im Vergleich zu anderen Klassifikationen wie Alter, Ethnizität oder Schichtzugehörigkeit. Außerdem sieht er eine Schwäche in der mangelnden Prüfung von Hintergrund und Vordergrund der Kommunikation von Gender.
Wie beschreibt Baecker die kommunikative Arbeit in Bezug auf Geschlecht?
Baecker bezieht sich auf Eric Leifer, der die kommunikative Arbeit als Oszillation der Wahrnehmung, Neutralisierung, Kommunikation der Neutralisierung und Kommunikation der möglichen Neutralisierung der Neutralisierung von Wahrnehmungen sieht. Geschlecht wird zwar wahrgenommen, kann aber in der Kommunikation abgekoppelt werden.
In welchen Kontexten spielt Geschlecht keine Rolle?
Die Studie von Heintz und Nadai zeigt, dass es Kontexte gibt, in denen das Geschlecht keine Rolle spielt, wie beispielsweise beim Beruf des Sachbearbeiters, der sozusagen entgenderisiert ist.
- Quote paper
- Katharina Baumeister (Author), 2004, Warum sehen wir immer jemandes Geschlecht und können trotzdem davon absehen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109366