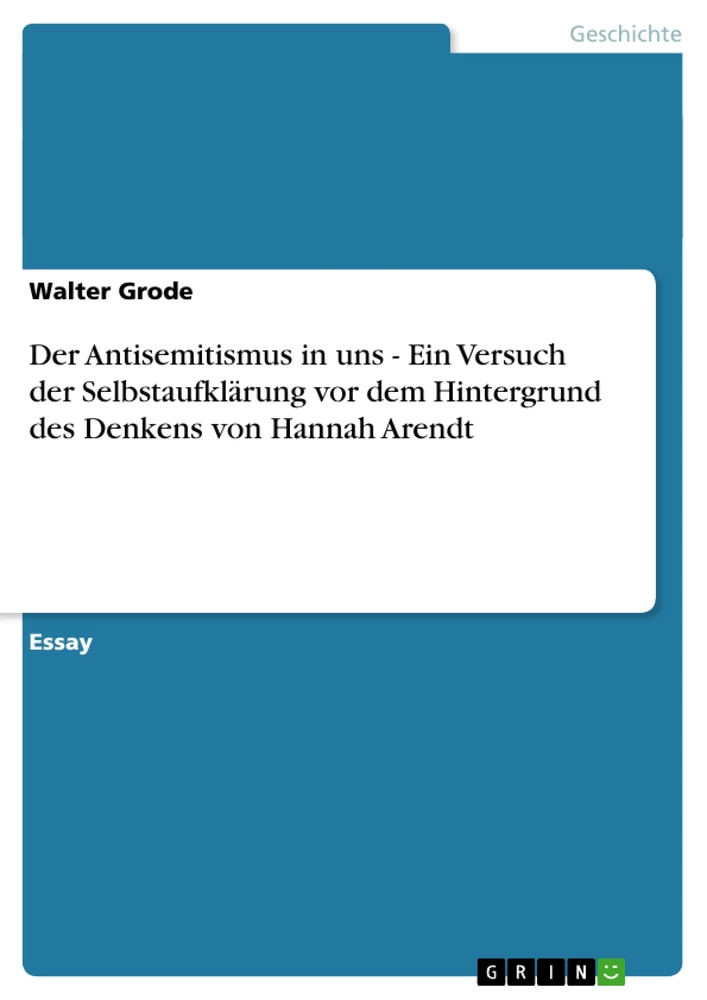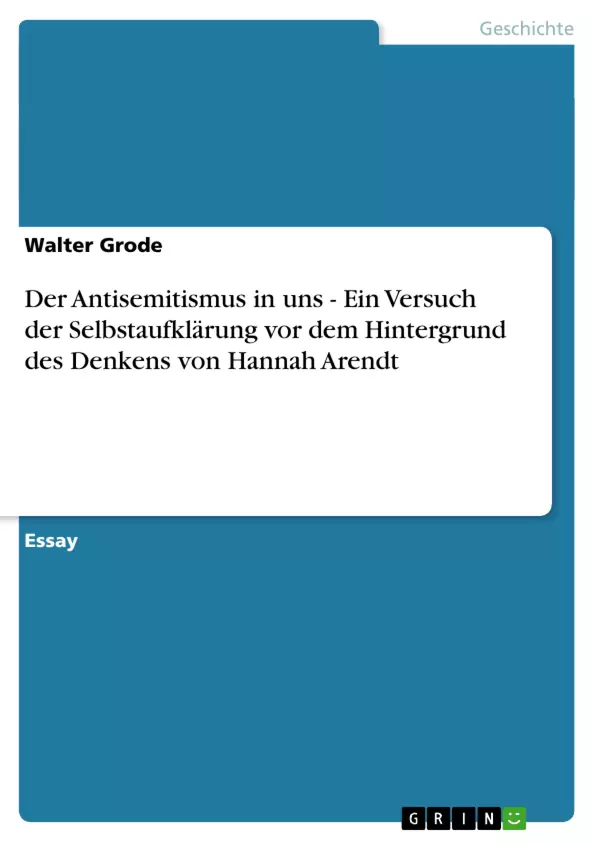Walter Grode
DER ANTISEMITISMUS IN UNS
Ein Versuch der Selbstaufklärung
vor dem Hintergrund des Denkens von Hannah Arendt
Erschienen in: Walter Grode: Aufsätze und Essays, Rezensionen und Kommentare,
Hannover 2002
Antisemitische Anwürfe hat es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder gegeben. Daran wird sich auch nichts ändern, weil sich mit ihnen auch in Zukunft wohlfeil politische, literarische oder wie auch immer geartete Aufmerksamkeit erzielen lassen wird.
Und noch weniger wird sich vorerst an dem >Antisemitismus ohne Juden< und an der Tatsache etwas ändern, daß eine starke Minderheit der Deutschen in dieser Hinsicht, eher einem >trockenen Alkoholiker< ähnelt, dem ein volles Glas hingehalten wird.
Das sollte eigentlich keinen aufmerksamen Beobachter überraschen. Wir sollten wir uns eher darin üben, "ohne Furcht und Hader" zwischen dem medialen Aufmerksamkeitswert und dem, was man reale ideologische Hegemonie nennen könnte, zu unterscheiden. Denn die demokratische Pointe war und ist ja, daß es nicht die antisemitischen Anwürfe waren und sind, die im privaten, wie öffentlichen Meinungsstreit punkten, sondern stets die darauf folgenden Antisemitismusvorwürfe:
Sobald das alte Bild vom >bösen Juden< auch nur in Umrissen erkennbar wird, formiert sich bei uns sofort eine Phalanx der Verteidigung; aber eigentlich nicht eine der inneren Abwehr. Denn von diesem Bild sind >wir Gutmenschen< innerlich so weit entfernt, daß wir es gegen alle unberechtigten, und selbst gegen alle berechtigten, nämlich auf inhumanes Handeln hinweisenden Angriffe verteidigen können.
Das war so, als Rainer Werner Faßbinder (vor mehr als drei Jahrzehnten) einen raffenden jüdischen Häusermakler auf die Bühne bringen wollte. Und dieser Reflex funktioniert auch (in Zukunft) gegenüber all jenen, die (berechtigt oder unberechtigt) >jüdische Aggressionspotentiale< anzusprechen wagen.
Insofern haben wir unsere Lektion aus dem Holocaust gelernt. Wenn überhaupt der windige Begriff der >Leitkultur< einen demokratischen Sinn haben soll, so offenbart er sich im Umgang mit unserer Vergangenheit.
Doch dieser Lernprozeß - und ich sage das ganz bewußt als (kritisierbaren) Versuch der Selbstaufklärung - ist noch immer nicht abgeschlossen. Denn auch wir nachgeborenen Deutschen haben in unserem Gefühlshaushalt >die Sonderstellung der Juden< offenbar nicht abgeschafft, sondern lediglich auf unsere eigene Weise tief verinnerlicht: statt mit Antisemitismus begegnen wir ihnen mit bedingungslosem Philosemitismus!
Wie aber können wir uns von dieser falschen, weil kritiklosen Haltung emanzipieren - und d.h. gerade hier, aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit herauskommen - ohne selbst antisemitisch zu werden?
Hannah Arendts Verhältnis zu ihrem Judentum war vielschichtig und kompliziert. Das zeigen schon ihre Essays aus den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Sie bergen für den Leser eine Überraschung: die Krise des Zionismus, von der in ihnen immer wieder die Rede ist, meint nicht die heutige politische Gegenwart, sondern sie behandelt die Krise der jüdischen Nationalbewegung vor der Gründung des Staates Israel.
Den historische Hintergrund dieser Stellungnahmen bilden die Nachkriegsjahre, in denen eine Lösung der Judenfrage akut wurde, die Hitler in das Zentrum weltpolitischer Erwägungen gerückt hatte. Und es mag zunächst erstaunen, daß Hannah Arendt gegen den jüdischen Staat plädierte, um den die zionistischen Siedler damals ihren Zweifrontenkrieg gegen den arabischen Widerstand und die britische Mandatsmacht führten.
Es hat den Anschein als werde hier der Grund sichtbar, der ihr Jahrzehnte später, während des Eichmann-Prozesses, den Vorwurf Gershom Scholems eintrug, der jüdischen Sache lieblos gegenüber zu stehen.
Aber dieser Vorwurf ist nicht gerechtfertigt. Was in diesen Aufsätzen zum Tragen kommt, ist keine antizionistische oder gar antijüdische Haltung, sondern es ist ihre - sich allmählich herausbildende - (in ihrem Hauptwerk dargelegte) Vorstellung über >Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft<.
Hannah Arendt widerspricht einem Axiom der zionistischen Weltanschauung, die den Antisemitismus als eine naturgegebene, deterministische Erscheinung deutet, der nur durch die Gründung eines Judenstaates zu begegnen sei. Es ist die These der >Elemente< der Antisemitismus sei nicht aus natürlichen, sondern aus historischen Wurzeln erwachsen; er sei politisch gefährlich geworden, weil sich die Juden Europas mit dem Prinzip des Nationalstaates identifizierten und mit seinem Niedergang seit dem Ende des 19. Jahrhunderts schutzlos zwischen den aufeinanderprallenden Gesellschaftsklassen standen; der Nationalstaat sei zuerst durch den Imperialismus und dann durch den Totalitarismus aufgerieben worden, der schließlich auch Europas Judentum vernichtet habe.
In dem Aufsatz >Der Zionismus aus heutiger Sicht< erinnert Hannah Arendt daran, daß diese Bewegung nur eine jüdische "Heimstätte" in Palästina angestrebt habe, nie einen Staat. Ihre Reaktion auf den Teilungsbeschluß der UNO-Vollversammlung im Jahre 1947 heißt: >Es ist noch nicht zu spät<. Sie beklagt den Rechtsruck der palästinensischen Juden, der einen ähnlichen Rechtsruck der gesamten Diaspora zur Folge gehabt habe. Sie betrachtet die Teilung des Landes nach "nationalen" Prinzipien als einen Rückschritt in Richtung auf ein historisch nicht mehr haltbares Prinzip, fürchtet die Gefahr der Balkanisierung, die den Kriegszustand nur verlängern kann. Und plädiert für eine Föderation von Juden und Arabern. Zugespitzt formuliert: Sie suchte schon vor 55 Jahren einen Rückweg vom Nationalstaat zum Weltbürgertum.
Hannah Arendts politische Deutungen aus der Nachkriegszeit besitzen Gültigkeit im doppelten Sinne: Sie wurden zum großen Teil weder durch spätere Forschung widerlegt noch von politischen Entwicklungen überholt. Das liegt daran, daß ihr theoretisches Antizipationsvermögen und ihre prophetische Kraft ebenso groß sind wie das Beharrungsvermögen und der Wiederholungszwang der Realität.
Auch heute wüten "Nationalismus und Stammesdenken", die den Grundsatz politischer Ethik mißachten, wonach die Idee des Volkes oder des Stammes nicht über die des Menschseins gehoben werden darf.
Hannah Arendt leugnet nicht die Daseinsberechtigung kollektiver kultureller und nationaler Zugehörigkeit, aber sie lehnt die ethnische Diskriminierung oder den ethnischen Ausschluß innerhalb politischer Gemeinwesen ab.
So wenig wie Hannah Arendt die materiellen ökonomischen Triebkräfte politischer Zusammenarbeit vernachlässigte - sie machte die Abschottung des jüdischen vom arabischen Wirtschaftssektor während der Aufbauphase des Zionismus verantwortlich für die jüdisch-arabische Feindschaft - so wenig fürchtete sie den Vorwurf der Moralität: Kompromißlose Moralität sei "zum einzigen Mittel geworden, mit dem die eigentliche Realität - im Gegensatz zur von Verbrechen entstellten und im Grunde nur kurzlebigen Faktizität - erkannt und planvoll gestaltet werden kann."
Hannah Arendt aber suchte nicht nur einen Rückweg vom Nationalstaat zum Weltbürgertum: ihre gesamte Denkweise war verwurzelt in der Tradition der deutschen Aufklärung. Der Urgrund dieser Aufklärung aber ist das (Selbst-)Bild des jüdischen Menschen. Moses Mendelsohn und Lessings Nathan waren die besten Vertreter dieser Philosophie, wie zugleich all ihrer unerfüllten Versprechen.
Diese unerfüllten Versprechen unserer zivilisatorischen Hoffnungen aber - voran Kants Diktum, daß der Mensch dem anderen stets Zweck und niemals Mittel zu sein habe - lösen in uns einen geheimen Groll gegenüber jenen aus, die, wie uns scheint, traditionell Wege gefunden haben, mit diesen und anderen Enttäuschungen produktiv umzugehen.
Thomas Mann sprach (1937) von "jüdischer Leidensfähigkeit, geprüfter Geistigkeit und ironischer Vernunft". Und Hannah Arendt empfand ihre eigene >Paria-Existenz< zeitlebens als den Urgrund, der stets aufs neue das Bedürfnis nach Humanität hervorbringe.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Walter Grodes "DER ANTISEMITISMUS IN UNS"?
Der Text ist ein Versuch der Selbstaufklärung über Antisemitismus, vor dem Hintergrund des Denkens von Hannah Arendt. Er untersucht die deutsche Auseinandersetzung mit Antisemitismus nach dem Holocaust und die komplexe Beziehung zwischen Philosemitismus und kritischer Auseinandersetzung.
Was sind die Hauptaussagen des Textes?
Der Text argumentiert, dass auch nachgeborene Deutsche eine besondere Beziehung zu Juden haben, die sich oft in bedingungslosem Philosemitismus äußert. Er fragt, wie man sich von dieser unkritischen Haltung emanzipieren kann, ohne antisemitisch zu werden. Er untersucht auch Hannah Arendts Kritik am Zionismus und ihre Vorstellung von Weltbürgertum anstelle von Nationalismus.
Welche Rolle spielt Hannah Arendt in Grodes Analyse?
Hannah Arendts Denken dient als Hintergrund für Grodes Selbstaufklärung. Ihre Kritik am Zionismus, ihr Plädoyer für eine Föderation von Juden und Arabern und ihre Betonung des Weltbürgertums werden als Alternativen zum Nationalismus präsentiert. Arendts Analyse der historischen Wurzeln des Antisemitismus, im Gegensatz zu einer naturalistischen Erklärung, ist ebenfalls zentral.
Was versteht Grode unter "Antisemitismus ohne Juden"?
Grode bezieht sich auf die Situation, in der Antisemitismus weiterhin existiert, auch wenn es wenige oder keine Juden in der unmittelbaren Umgebung gibt. Er beschreibt es als eine Art "trockenen Alkoholismus", bei dem die Versuchung und das Potenzial für Antisemitismus weiterhin vorhanden sind.
Was ist das Fazit des Textes?
Grode kommt zu dem Schluss, dass die bedingungslose Verteidigung der "schlechten jüdischen Faktizität" eine Flucht vor dem hohen Maßstab darstellt, der traditionell das Leben "des guten Juden" prägt, nämlich eine Einheit aus Leidensfähigkeit, Geistigkeit und ironischer Vernunft. Er fordert eine kritische Auseinandersetzung, die über unkritischen Philosemitismus hinausgeht.
- Quote paper
- Dr. phil. Walter Grode (Author), 2002, Der Antisemitismus in uns - Ein Versuch der Selbstaufklärung vor dem Hintergrund des Denkens von Hannah Arendt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109372