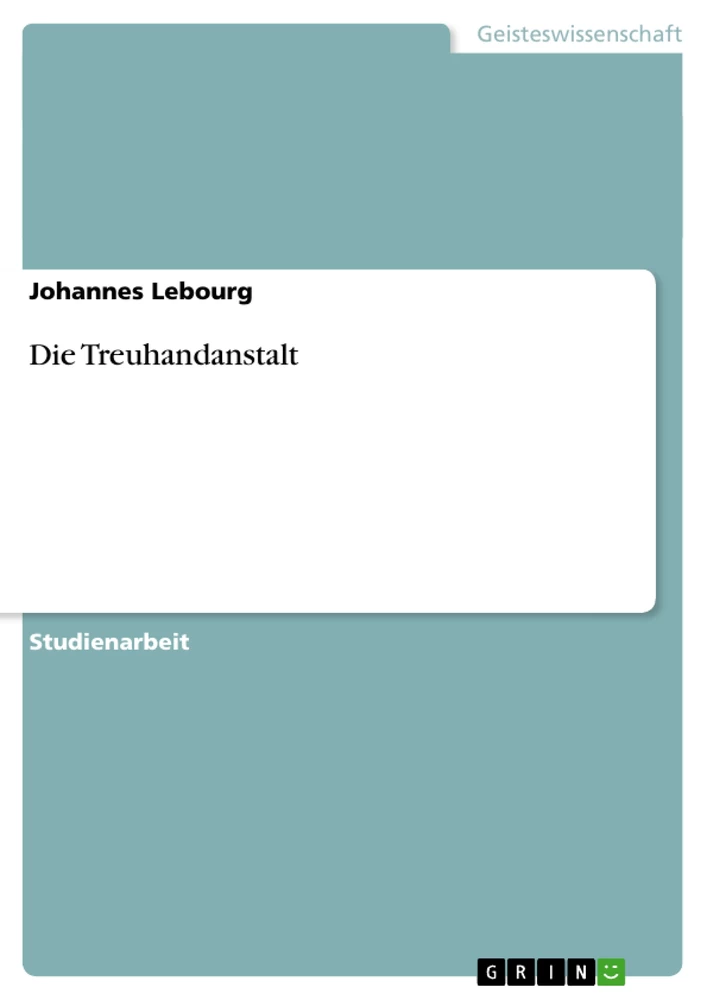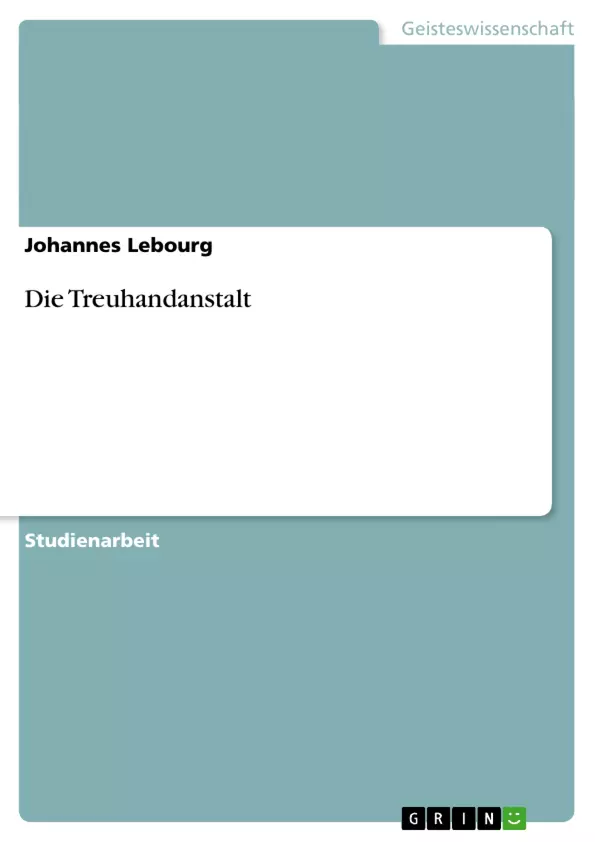Die Treuhandanstalt (THA)
Formuliert wurde der Gesetzestext zur „Treuhandanstalt“ am 17. Juni 1990, jedoch gingen ihrer Gründung lange deutsch-deutsche Überlegungen und Faktenketten voraus, die sie letztendlich erst entstehen ließen.
Neben „westlichen Vorschlägen“ aus der Bundesrepublik endstand der Gedanke eine treuhänderische Verwaltung einzurichten in der ehemaligen DDR selbst.
Nach der Ablösung Erich Honeckers durch Egon Krenz im Vorsitz des Staatsrates im Oktober 1989 endstand eine öffentliche Debattierung der wirtschaftlichen Lage, aus der schließlich die Einsicht notwendiger ökonomischer Unterstützung aus dem Ausland erwuchs. Zum einen hatte die Regierung unter Modrow vor, einen „dritten Weg“ zwischen Plan- und Marktwirtschaft zu beschreiten, um einer sicher eintretenden Zahlungsunfähigkeit der Deutschen Demokratischen Republik spätestens 1991 entgegenzuwirken. Zum anderen begann sich eine Bürgerbewegung zu formieren, die sich am 6. Dezember 1989 zur „Freien Forschungsgemeinschaft Selbstorganisation“ konstituieren sollte. Ihre Kern-Akteure waren der Ingenieur Matthias Artzt, der Physiker Gerd Gebhardt und der Theologe Wolfgang Ullmann. Sie waren der Überzeugung , dass das Gesellschaftssystem der DDR am Ende und staatstragende Kräfte ratlos seien. So formulierten Sie Ihre Bereitschaft, „[...] als eine Art gesellschaftspolitischer Kristallisationskern für einen Übergang zu agieren“ (Vgl.Fischer/Schröter, 1993). Das erste Zusammentreten des neu gegründeten „Runden Tisches“ erfolgte einen Tag später, nämlich am 7. Dezember 1989. Im Wesentlichen ist es ihrem offenen Angriff auf die Basis des Sozialismus und somit der Existenz der DDR zuzuschreiben, dass sich ein Kreis ostdeutscher Intellektueller zur Vereinigung „Demokratie Jetzt“ bilden konnte. Es war der Theologe Wolfgang Ullmann, der am 12. Februar 1990 den Vorschlag machte, eine „Initiative zur Einrichtung einer treuhänderischen Verwaltung des Volksvermögens der DDR“ einzurichten. Als am 8. Januar 1990 auch in Regierungskreisen – der Vorschlag einer allgemeinen Privatisierung in der DDR kam von Gerhard Beils und Lothar de Maizières an den Ministerrat – der Beschluss gefasst worden war, erst Wohnungen und schließlich die gesamte DDR-Wirtschaft unter treuhänderische Verwaltung zu stellen, war der Weg für die Gründung der THA frei.
Die Aufgabe der somit am 17. Juni 1990 gegründeten Treuhandanstalt war die Rückführung verstaatlichter Betriebe in Privateigentum mit sozialer Bindung. So viel vorhandenes Volkseigentum wie möglich sollte direkt den DDR-Bürgern zukommen. Durch ihren Auftrag, ökonomisches Kapital zu verwalten und zu verteilen wurde „[...] die THA so zu einem wichtigen Bindeglied zwischen der sich auflösenden DDR und der Bundesrepublik Deutschland“ (Vgl. Fischer/Schröter, 1993) für eine neue, wirtschaftliche Strukturierung.
Nach der Wiedervereinigung wurde die Treuhandanstalt in eine rechtsfähige, bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts unter Aufsicht des Bundesfinanzministeriums umgewandelt. Ihr zuerst zugestandener Kreditrahmen hatte ein Volumen von 17 Mrd. DM, später wurde dieser auf 25. Mrd. DM angehoben.
Konkret bestand die Haupttätigkeit der THA in der Entflechtung von Kombinaten und der Umwandlung der Nachfolgeunternehmen in Kapitalgesellschaften. Die statische und marode Planwirtschaft der DDR sollte hingeführt werden zu kapitalistisch-dynamischen, marktwirtschaftlichen Strukturen.
Die Treuhandanstalt hatte einhergehend mit der wirtschaftlichen Verwaltung auch den Auftrag „[...] kreative Ideen, unternehmerische Verantwortung, betriebswirtschaftliches Know-how und Investitionszusagen [...]“ (Vgl. Breuel, 1993) nach Ostdeutschland zu holen, um so einen ökonomischen Anschluss der ehemaligen DDR an das marktwirtschaftliche System der Bundesrepublik zu fördern. Dabei „arbeitet die THA nach dem Motto: zügige Privatisierung, entschlossene Sanierung und – wo unvermeidlich – Stilllegung, aber dann sehr behutsam“ (Vgl. Breuel, 1993).
Nachdem es in der Praxis der Anfangsjahre zu mehreren Fällen massenhaften Fördermittelmissbrauchs gekommen war, wurden Arbeitsplatzgarantien in die Privatisierungsverträge integriert, um die Nachhaltigkeit der Förderungen zu garantieren.
Neben der Heranführung der ehemaligen DDR an eine internationale Wettbewerbsfähigkeit sollte die THA ein Modell zur Gründung und Förderung eines stabilen Mittelstandes entwickeln und betreiben: das Prinzip des so genannten „Management-Buyouts“. Hierbei wurden im Wesentlichen Unternehmen an ihre eigenen Führungskräfte verkauft, um die Bürger durch Mitarbeiterbeteiligungen an den Unternehmen aktiv in eine soziale Marktwirtschaft einzubinden.
Am 1. Juli 1990 waren der Treuhand ca. 8.500 Betriebe mit etwa 4 Mio. Arbeitnehmern zur Verwaltung unterstellt.
Nach dem Rücktritt Reiner Maria Gohlkes wurde als erster Präsident der THA nach der Wiedervereinigung Detlev Karsten Rohwedder eingesetzt. Er leitete die Geschicke der Treuhand bis zum 1. April 1991, als er bei einem Attentat durch einen Terroristen der RAF ermordet wurde. Seine Nachfolgerin wurde am 13. April 1991 die CDU-Abgeordnete Birgit Breuel. Sie war Präsidentin der THA bis zu ihrem Ende am 31. Dezember 1994, als sie aufgelöst wurde und eine Gesamtverschuldung von geschätzten 270 Mrd. DM hinterließ. Die Schulden der Treuhand wurden am 1. Januar 1995 in den Erblastentilgungsfonds eingebracht.
Literaturangaben:
1. Breuel, Birgit [Hrsg.]: „Treuhand intern“, Ullstein, Frankfurt am Main, 1993
2. Fischer, Wolfram/Schröter, Harm: „Die Entstehung der Treuhandanstalt“ in: Fischer, Wolfram [Hrsg.]: „Treuhandanstalt – das Unmögliche wagen. Forschungsberichte“ , Akademischer Verlag, Berlin, 1993
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Treuhandanstalt (THA)?
Die Treuhandanstalt wurde am 17. Juni 1990 gegründet und hatte die Aufgabe, verstaatlichte Betriebe in Privateigentum mit sozialer Bindung zurückzuführen. Sie sollte so viel vorhandenes Volkseigentum wie möglich direkt den DDR-Bürgern zukommen lassen.
Wie entstand die Idee zur Treuhandanstalt?
Die Idee entstand aus deutsch-deutschen Überlegungen und Faktenketten nach der Ablösung Erich Honeckers. Es gab sowohl „westliche Vorschläge“ als auch den Gedanken, eine treuhänderische Verwaltung in der DDR selbst einzurichten.
Welche Rolle spielte die "Freie Forschungsgemeinschaft Selbstorganisation"?
Diese Gruppe, bestehend aus Matthias Artzt, Gerd Gebhardt und Wolfgang Ullmann, formulierte ihre Bereitschaft, einen Übergang des Gesellschaftssystems der DDR zu gestalten. Wolfgang Ullmann schlug am 12. Februar 1990 die Einrichtung einer treuhänderischen Verwaltung des Volksvermögens der DDR vor.
Welche Aufgaben hatte die Treuhandanstalt nach der Wiedervereinigung?
Nach der Wiedervereinigung wurde die THA in eine bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts unter Aufsicht des Bundesfinanzministeriums umgewandelt. Ihre Haupttätigkeit bestand in der Entflechtung von Kombinaten und der Umwandlung der Nachfolgeunternehmen in Kapitalgesellschaften. Sie sollte die Planwirtschaft der DDR in marktwirtschaftliche Strukturen überführen.
Welchen Kreditrahmen hatte die Treuhandanstalt?
Ihr zuerst zugestandener Kreditrahmen hatte ein Volumen von 17 Mrd. DM, später wurde dieser auf 25 Mrd. DM angehoben.
Welche weiteren Aufträge hatte die THA neben der wirtschaftlichen Verwaltung?
Sie sollte kreative Ideen, unternehmerische Verantwortung, betriebswirtschaftliches Know-how und Investitionszusagen nach Ostdeutschland holen, um einen ökonomischen Anschluss der ehemaligen DDR an die Bundesrepublik zu fördern.
Was ist das Prinzip des "Management-Buyouts"?
Hierbei wurden Unternehmen an ihre eigenen Führungskräfte verkauft, um die Bürger durch Mitarbeiterbeteiligungen an den Unternehmen aktiv in eine soziale Marktwirtschaft einzubinden.
Wie viele Betriebe waren der Treuhandanstalt unterstellt?
Am 1. Juli 1990 waren der Treuhand ca. 8.500 Betriebe mit etwa 4 Mio. Arbeitnehmern zur Verwaltung unterstellt.
Wer waren die Präsidenten der Treuhandanstalt?
Detlev Karsten Rohwedder war der erste Präsident nach der Wiedervereinigung. Nach seiner Ermordung wurde Birgit Breuel seine Nachfolgerin.
Wann wurde die Treuhandanstalt aufgelöst und welche Schulden hinterließ sie?
Sie wurde am 31. Dezember 1994 aufgelöst und hinterließ eine Gesamtverschuldung von geschätzten 270 Mrd. DM. Die Schulden wurden am 1. Januar 1995 in den Erblastentilgungsfonds eingebracht.
- Quote paper
- Johannes Lebourg (Author), 2005, Die Treuhandanstalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109396