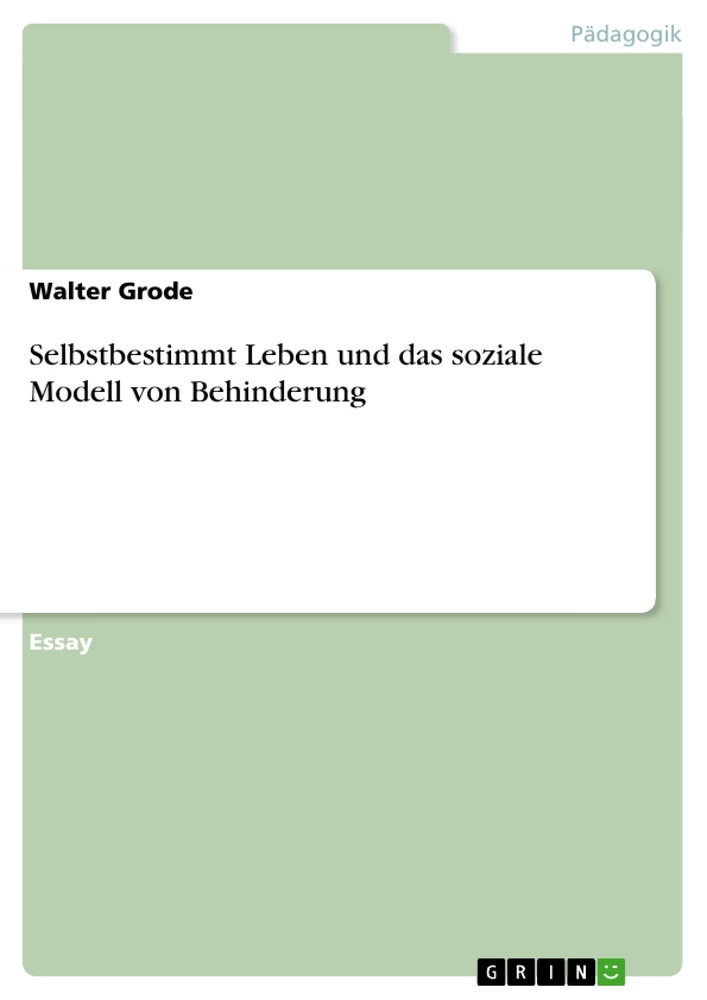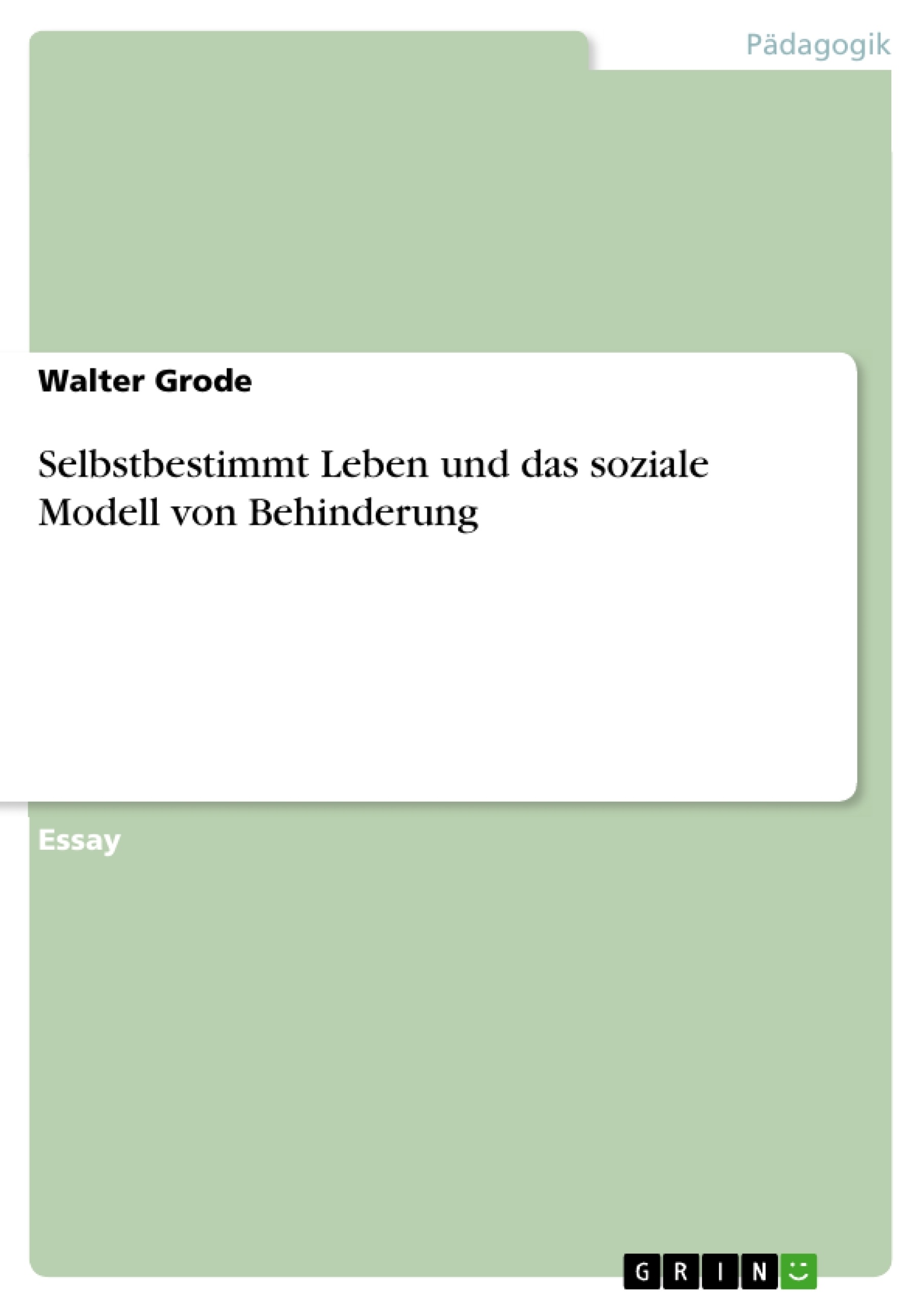Dworkins eindrucksvolles Plädoyer für eine liberale Regelung der Sterbehilfe geht nun von der Feststellung aus, daß wir ein Leben leben und einen Tod sterben wollen, der unseren "wertebezogenen" Interessen gerecht wird. Es geht dabei also nicht allein um den Wunsch, daß einem unerträgliche Qualen erspart bleiben. Die Würde einer Person kann auch von einem Lebensende in Mitleidenschaft gezogen werden, von dem sie selbst gar nichts mehr mitbekommt: wenn sie über Jahre mit technischer Unterstützung im "vegetativen Zustand" gehalten und zu einer bloß biologischen Existenz verurteilt wird, die nichts mehr mit dem zu tun hat, was für sie den Sinn des Lebens ausmachte. In diesem Sinne ist es durchaus konsequent und keineswegs zynisch, wenn die >Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben< (DGHS) ihre Zeitschrift >Selbstbestimmtes Leben< nennt. Autonom also >Selbstbestimmt Leben< ist in den vergangenen Jahrzehnten auch für viele behinderte Menschen zur Maxime geworden (Exner 2000). Die mutigsten und politisch aktivsten Vertreter dieses neuen Selbstwußtseins aber gaben sich nicht mit mühsamer (gar konsensorientierter) Interessenabwägung zufrieden, sondern verglichen ihren Protest mehr und mehr mit dem Kampf um Gleichberechtigung von Frauen, Schwarzen und Homosexuellen. Und sie kamen zu dem Schluß, daß sie gar nicht behindert seien, sondern von der Gesellschaft behindert würden. Dieses soziale Modell trat dem medizinischen Modell entgegen, das die Quelle der Behinderung im biologischen Mangel des Individuum sah. Es machte aus Almosenempfängern eine unterdrückte Minderheit, die jetzt lautstark und mit Erfolg ihre Rechte forderte. Das Ziel eines Selbstbestimmten Lebens bis hin zu Kindern nach eigenem Maß (Spiewak/Viciano 2002), schmeichelt natürlich dem Ego von behinderten Menschen gewaltig. Doch ist das rein soziale Modell von Behinderung, das diesem Ziel zu Grunde liegt, schon allein deshalb dringend revisionsbedürftig, weil es außerhalb der >disability community< auf völliges Unverständnis stößt - und (weil es sich um kein zufälliges Vermittlungsproblem handelt) auch stoßen muß! [...]
Inhaltsverzeichnis
- Spiegelbild und Behinderung
- Zuschreibung als gesellschaftliche Sackgasse
- Gesellschaft und Behinderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht das soziale Modell von Behinderung und dessen Auswirkungen auf das selbstbestimmte Leben behinderter Menschen. Er hinterfragt die These, dass Behinderung ausschließlich gesellschaftlich konstruiert ist und konfrontiert dieses Modell mit individuellen und gesellschaftlichen Realitäten.
- Das soziale Modell von Behinderung im Vergleich zum medizinischen Modell
- Selbstbestimmung und die Rolle der Gesellschaft
- Individuelle Erfahrungen und die Grenzen des sozialen Modells
- Die Kritik am Dekonstruktivismus in der Gesellschaftskritik
- Historische Perspektiven auf die Behandlung behinderter Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Abschnitt "Spiegelbild und Behinderung" präsentiert die Lebensgeschichte des britischen Behindertenaktivisten Tom Shakespeare und seine Entwicklung bezüglich des sozialen Modells von Behinderung. Shakespeare revidiert seine anfängliche strikte Position, verdeutlicht die Begrenztheit des rein sozialen Modells. Der zweite Abschnitt, "Zuschreibung als gesellschaftliche Sackgasse", kritisiert das soziale Modell von Behinderung aus gesellschaftlicher Perspektive. Er problematisiert den dekonstruktivistischen Ansatz und dessen Mangel an einer positiven Vision einer Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Soziales Modell von Behinderung, Selbstbestimmtes Leben, medizinisches Modell, Dekonstruktivismus, Integration, Behinderung, Gesellschaft, Autonomie, Selbstbestimmung, Disability Studies, Tom Shakespeare.
- Quote paper
- Dr. phil. Walter Grode (Author), 2003, Selbstbestimmt Leben und das soziale Modell von Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109437