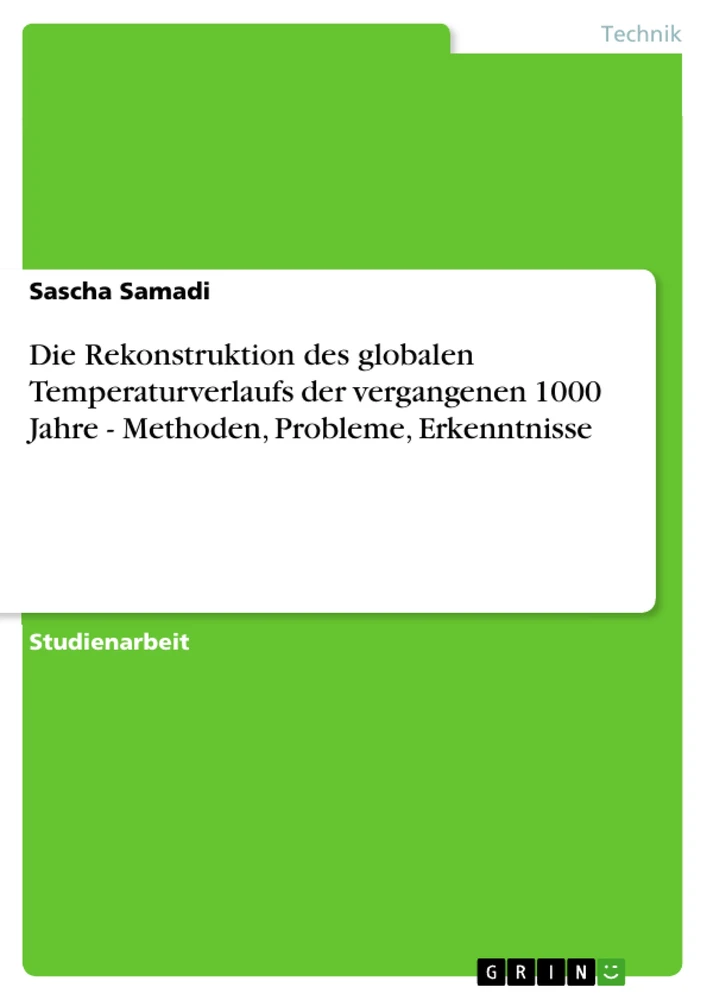Die vorliegende Arbeit ist entstanden, um einen auch für Nicht-Naturwissenschaftler verständlichen Überblick über den aktuellen Stand der als Paleoklimatolgie bekannten Wissenschaft der Rekonstruktion des globalen Temperaturverlaufs der vergangenen 1000 Jahre zu bieten. Sie möchte einen Überblick über die Methoden und die Erkenntnisse, aber auch über die Schwierigkeiten und Grenzen der Paleoklimatologie geben – insbesondere desjenigen Bereichs der Paleoklimatologie, der sich mit dem Temperaturverlauf des letzten Jahrtausends beschäftigt. Zu diesem Zweck werden im zweiten Kapitel zunächst die Grundlagen angesprochen, die für eine Rekonstruktion des Klimas notwendig sind. Dies ist zum einen die auf Instrumenten, historischen Dokumenten und natürlichen „Archiven“ beruhende Datengrundlage. Zum anderen sind bestimmte Verfahren durchzuführen, um aus den unterschiedlichen und zum Teil (zeitlich und örtlich) lückenhaften Daten mittlere globale Lufttemperaturen ableiten zu können.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen der Temperaturrekonstruktion
2.1 Instrumentelle Daten
2.2 Historische Dokumente
2.3 Daten aus natürlichen Klimaarchiven
2.3.1 Baumringe
2.3.2 Korallen
2.3.3 Eisbohrkerne
2.3.4 Tropfsteine
2.3.5 Geschichtete Seen- und Meeressedimentbohrkerne
2.3.6 Bohrlöcher
2.3.7 Weitere natürliche Klimaarchive
2.4 Verfahren zur Temperaturrekonstruktion
3. Erkenntnisse und Diskussionen zum Temperaturverlauf der letzten 1000 Jahre
3.1 Die vorherrschende Meinung in der Paleoklimatologie
3.2 Die wissenschaftliche Diskussion um die Temperaturrekonstruktionen
3.3 Die außerwissenschaftliche Diskussion um die Temperaturrekonstruktionen
4. Fazit
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Mittlere globale bodennahe Lufttemperatur von 1850 bis
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Erstellung einer Baumringchronologie
Abbildung 3: Temperaturrekonstruktion der nördlichen Hemisphäre von Mann u. a. (1999)
Abbildung 4: Temperaturrekonstruktionen der nördlichen Hemisphäre ab 1000 n. Chr.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Bereits seit mehreren Jahrhunderten ist die Veränderlichkeit des Klimas Gegenstand wissenschaftlicher Forschung.[1] Dieses frühe Interesse begründet sich dabei im Wesentlichen auf den unmittelbaren und zum Teil erheblichen Einfluss des Klimasystems auf das Wohlergehen der Menschen. So konnten beispielsweise in der Vergangenheit – und können auch heute noch in den ärmeren Ländern der Welt - außergewöhnlich trockene Sommer durch die damit verbundenen Ernteausfälle zu schweren Hungersnöten führen. Und besonders kalte Winter brachten aufgrund der mit der Vereisung von Flüssen einhergehenden Einstellung der Schifffahrt negative wirtschaftliche Folgen mit sich.[2]
In den vergangenen etwa zwei Jahrzehnten hat das wissenschaftliche Interesse an der als Paleoklimatologie bezeichneten Erforschung früherer Klimaverläufe weiter zugenommen. Dies drückt sich unter anderem in der gestiegenen Anzahl der diesem Thema gewidmeten Fachzeitschriften aus. Das Interesse ist dabei nicht zuletzt auf die – spätestens seit den 1990er Jahren auch in der breiten Öffentlichkeit geführte – Diskussion um die in jüngerer Zeit zu beobachtende Erderwärmung zurückzuführen.[3] So können Erkenntnisse über das Klima der Vergangenheit wichtige Hinweise in Bezug auf die zum Teil kontrovers diskutierte Frage nach dem Einfluss des Menschen auf diese Erwärmung liefern.
Im Mittelpunkt steht in diesem Zusammenhang wiederum die Frage nach der Außergewöhnlichkeit der Erderwärmung insbesondere der letzten drei bis vier Jahrzehnte im Kontext der in der Vergangenheit aufgetretenen natürlichen Klimaschwankungen.[4] Um hierüber Aufschluss zu erhalten, wird seit einiger Zeit verstärkt die Temperaturentwicklung der vergangenen rund 1000 Jahre untersucht. Zum einen traut es sich die Paleoklimatologie innerhalb eines solchen Zeitfensters noch zu, zeitlich ausreichend hoch aufgelöste und relativ zuverlässige Rekonstruktionen des Temperaturverlaufs zu liefern. Zum anderen ist bekannt, dass sich grundsätzliche Einflüsse auf das Klimasystems (beispielsweise die Erdumlaufparameter oder die auf der Oberfläche der Erde vorhandene Eismasse) in dieser Zeitspanne nicht in nennenswertem Ausmaß verändert haben.[5] „The variations in climate observed over this time frame are likely therefore to be representative of the natural climate variability that might be expected over the present century in the absence of any human influence.”[6]
Die vorliegende Arbeit möchte einen Überblick über die Methoden und die Erkenntnisse, aber auch über die Schwierigkeiten und Grenzen der Paleoklimatologie geben – insbesondere desjenigen Bereichs der Paleoklimatologie, der sich mit dem Temperaturverlauf des letzten Jahrtausends beschäftigt. Zu diesem Zweck werden im zweiten Kapitel zunächst die Grundlagen angesprochen, die für eine Rekonstruktion des Klimas notwendig sind. Dies ist zum einen die auf Instrumenten, historischen Dokumenten und natürlichen „Archiven“ beruhende Datengrundlage (Abschnitte 2.1 bis 2.3). Zum anderen – und hierauf geht Abschnitt 2.4 ein – sind bestimmte Verfahren durchzuführen, um aus den unterschiedlichen und zum Teil (zeitlich und örtlich) lückenhaften Daten mittlere globale Lufttemperaturen ableiten zu können.
Kapitel 3 fasst anschließend den derzeitigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zum globalen Temperaturverlauf der vergangenen rund 1000 Jahre zusammen, wobei in Abschnitt 3.1 zunächst auf die Forschungsergebnisse der Mehrheit der Klimaforscher eingegangen wird. Diese kommen in Bezug auf die Frage nach der Außergewöhnlichkeit der Erwärmung der letzten Jahrzehnte im Wesentlichen zu übereinstimmenden Ergebnissen. Demgegenüber findet in Abschnitt 3.2 die wissenschaftliche Kritik an der Forschung und den Schlussfolgerungen der Mehrheit der Paleoklimatologen Berücksichtigung. Abschnitt 3.3 geht auf Aspekte der außerwissenschaftlichen Diskussion um vergangene Temperaturverläufe ein. Im abschließenden Fazit (Kapitel 4) werden die wesentlichen Erkenntnisse der vorherigen Kapitel zusammengefasst und eine persönliche Einschätzung der Diskussion um die Rekonstruktion vergangener Temperaturen vorgenommen.
2. Grundlagen der Temperaturrekonstruktion
Um robuste Aussagen über den Verlauf der globalen Temperaturentwicklung vergangener Zeiten treffen zu können, bedarf es zunächst einer hohen Anzahl an Daten, die die tatsächliche Temperatur zu verschiedenen Zeitpunkten möglichst zuverlässig wiedergeben. Wichtig ist dabei, dass diese Daten aus vielen unterschiedlichen und möglichst gleichmäßig verteilten Regionen der Erde kommen, um die tatsächliche mittlere globale Erdtemperatur wiedergeben zu können.[7]
Es gibt verschiedene Quellen, um an die benötigten Temperaturdaten der Vergangenheit zu gelangen. Zum einen sind dies die von Messinstrumenten abgelesenen Temperaturen, auf die in Abschnitt 2.1 eingegangen wird. Des Weiteren lassen sich Klimainformationen aus unterschiedlichen Arten von historischen Aufzeichnungen gewinnen (Abschnitt 2.2). Ganz wesentlich greift die Paleoklimatologie aber (insbesondere für die „vorinstrumentelle“ Zeit) auf indirekte Temperaturangaben in natürlichen Quellen zurück. Diese Klimaarchive, im englischen als Proxies bezeichnet, werden in Abschnitt 2.3 näher besprochen. Die Verfahren, mit denen schließlich die Vielzahl unterschiedlicher Daten zu einem rekonstruierten Temperaturverlauf aggregiert werden, werden zum Abschluss des zweiten Kapitels in Abschnitt 2.4 diskutiert.
2.1 Instrumentelle Daten
Instrumentelle Messdaten haben gegenüber anderen, in den folgenden Abschnitten besprochenen Klimadaten eine Reihe von Vorteilen. Zum einen können sie präzise datiert werden, erfordern keine komplizierten Umrechnungen um Temperaturinformationen zu erhalten und sind prinzipiell überall auf der Erde erfassbar.[8] Trotz dieser Vorteile ist bei der Verwendung instrumenteller Messdaten zum Zwecke der Klimarekonstruktion zu beachten, dass verschiedene Faktoren auch hier zu Ungenauigkeiten in den Daten führen können. Instrumentelle Verbesserungen, Verlegungen von Messorten, Änderungen der Beobachtungszeiten oder Änderungen bei der Anbringung der Messgeräte sowie ein möglicher Wandel der Umwelt, die den Messort unmittelbar umgibt (z.B. der Vegetation), können jeweils zu Einschränkungen der Genauigkeit und – insbesondere über längere Beobachtungszeiträume – zu fehlender Vergleichbarkeit führen.[9]
So wird beispielsweise bei Landmessungen seit langer Zeit über das Ausmaß des erwärmenden Einflusses wachsender, stärker bebauter und industrialisierter Städte auf die gemessenen Temperaturen diskutiert.[10] Einige „Klimaskeptiker“ führen sogar die in den letzten Jahrzehnten beobachtete Erderwärmung (siehe Abbildung 1) im Wesentlichen oder gar vollständig auf diesen als Urban Heat Island Effect (UHIE) bekannten Effekt zurück.
Abbildung 1: Mittlere globale bodennahe Lufttemperatur von 1850 bis 2005
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: UK Met Office, Hadley Centre for Climate Prediction and Research (Hrsg.): Global temperatures, http://www.metoffice.com/research/hadleycentre/obsdata/globaltemperature.html, mit Modifikationen
Wissenschaftliche Untersuchungen mit Vergleichsmessungen außerhalb der Städte deuten jedoch darauf hin, dass, falls der UHIE überhaupt einen Einfluss auf die mittlere globale Erdtemperatur hat, dieser nur einen Bruchteil der im 20. Jahrhundert beobachteten Erwärmung begründen kann.[11] Eine Erklärung dieser Erwärmung durch den UHIE ist auch deswegen schwer haltbar, da in den letzten Jahrzehnten nicht nur auf Landgebieten, sondern – in ähnlichem Umfang – auch auf den Meeren ein Temperaturanstieg gemessen wurde.[12]
Instrumentelle Messdaten können insbesondere dann als außerordentlich zuverlässig gelten, wenn vor ihrer wissenschaftlichen Verwertung ihre Homogenität bewertet wird. Dies bedeutet, dass das Vorhandensein von systematischen Abweichungen innerhalb einzelner Datensets geprüft wird und diese Abweichungen dann – sofern dies möglich ist - herausgerechnet werden. Der oben erwähnte Vergleich von städtischen Temperaturmessungen mit umliegenden Messdaten ist ein Beispiel für einen solchen Homogenitätstest. Ein weiteres Beispiel sind Untersuchungen, die systematischen Messunterschiede zwischen der insbesondere bis in die 1940er Jahre dominierenden Methode der Messung von Meeresoberflächentemperaturen (S ea Surface Tmperatures, SST) mit Hilfe von Eimern und der seitdem umgestellten Messung mit an den Schiffen befestigten Instrumenten erforschen.[13]
Es wird angenommen, dass die damaligen Messungen der SST durch die Verwendung von Eimern um rund 0,3 bis 0,7 °C kälter ausfielen, als sich mit den heutigen Messmethoden ergeben hätte. Zwar kann angestrebt werden, diesen Effekt durch eine Bereinigung der betroffenen Datensätze auszugleichen, dass dies nicht in vollem Umfang gelingen kann, wird aber spätestens dann klar, wenn man bedenkt, dass die jeweiligen Temperaturabweichungen vom Material und damit der Isolationsfähigkeit der damals verwendeten Eimer, von den herrschenden Wetterverhältnissen sowie von der Dauer zwischen Wasserentnahme und Messzeitpunkt abhängt.[14]
Trotz des möglichen Auftretens von systematischen, zeitabhängigen, aber auch zufälligen Messfehlern bei Datensätzen instrumenteller Temperaturmessungen, gelten diese insgesamt dennoch als die mit Abstand zuverlässigsten aller vorhandenen Klimadaten.[15] Allerdings ist ein global ausreichend flächendeckendes Messnetz erst seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts vorhanden.[16] Dieser Umstand macht es für Klimarekonstruktionen mehrerer Jahrhunderte oder gar Jahrtausende notwendig, auf andere, nicht-instrumentelle Klimaindikatoren zurückzugreifen.
2.2 Historische Dokumente
Klimainformationen aus historischen Dokumenten können beispielsweise aus Aufzeichnungen über Beginn und Ende von Frostperioden oder über die Dauer von Einfrierungen größerer Gewässer gewonnen werden.[17] Auch die in früheren Jahrhunderten - nicht zuletzt aufgrund der Notwendigkeit der anteiligen Abtretungen an die Gutsherren - oftmals detailliert niedergeschriebenen Informationen über Ernteerträge, ermöglichen Aussagen über den früheren Klimaverlauf.[18] Zu bedenken ist dabei jedoch, dass die Höhe von Ernteerträgen von einer Vielzahl verschiedener klimatischer Faktoren (z.B. Niederschlag und Temperatur), wie auch anderer Faktoren (z.B. politische Stabilität, technischer Fortschritt, landwirtschaftlich genutzte Fläche) abhängt. Ein direkter Rückschluss auf Temperaturschwankungen ist also nur sehr eingeschränkt möglich.[19]
Auch bei dem Rückschluss von Vereisungsdaten auf die Härte bzw. Milde eines Winters ist in einigen Fällen Vorsicht geboten. So ist bekannt, dass die Thames in London zwar zwischen den Jahren 1408 und 1814 über zwanzig Mal eingefroren ist, seitdem jedoch nicht mehr. Dies wird von einigen Autoren als Indiz dafür gedeutet, dass diese Zeitspanne eine außergewöhnlich kalte Periode in der Klimageschichte Großbritanniens gewesen sein muss und die Annahme erhärtet, dass etwa zwischen 1300 und 1800 auch global betrachtet eine solche, als Little Ice Age bezeichnete Kälteperiode auftrat.[20]
Die Klimawissenschaftler Philip Jones und Michael Mann weisen jedoch darauf hin, dass in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts die alte Brücke Londons durch eine neue ersetzt wurde. Im Gegensatz zu der neuen Brücke hatte die alte mehrere Pfeiler und hielt das Meereswasser bei Fluten zurück. Durch den Neubau gelangte die Flut weiter stromaufwärts und verhinderte seitdem das Zufrieren des Flusses in London – selbst in außergewöhnlich kalten Wintern wie 1962/1963.[21]
Grundsätzlich sind verschiedene Einschränkungen bei der Verwendung einiger historischer Dokumente zu beachten. Zum einen kann die Tatsache, dass überwiegend extreme Wetterereignisse überliefert sind, zu verzerrten Rückschlüssen auf die tatsächlich üblichen Klimaschwankungen verleiten. Zum anderen erschweren die über Jahrhunderte erfolgten Veränderungen im Sprachgebrauch sowie die im Mittelalter zum Teil selbst von Stadt zu Stadt unterschiedlichen Kalender und Heiligentage die Auswertung bzw. korrekte Zuordnung der in historischen Aufzeichnungen enthaltenen Informationen.[22] Zudem sind mehrere Jahrhunderte zurückreichende Klimadokumente fast ausschließlich auf die Regionen der Erde beschränk, die über eine längere Tradition des Schriftgebrauchs verfügen. Zu diesen Regionen zählen vor allem Europa, Ostasien und – weniger weit zurückreichend – auch Nordamerika.[23]
In Bezug auf die Bestrebungen, zeitlich möglichst hochaufgelöste und kontinuierliche Daten über Temperaturentwicklungen einzelner Erdregionen zu erlangen, stellen die ab dem 15. Jahrhundert von Einzelpersonen geführten Wetterjournale eine ergiebige Quelle dar. Denn sie enthalten zum Teil tägliche, systematische Beobachtungen und erfüllen damit „wie kein anderer schriftlicher Quellentyp die Forderung nach homogenen, kontinuierlichen, gleichartigen und quantifizierbaren Daten und ermöglichen somit weit reichende klimatische Aussagemöglichkeiten“.[24]
2.3 Daten aus natürlichen Klimaarchiven
Neben historischen Aufzeichnungen steht der Paleoklimatologie eine Vielzahl unterschiedlicher natürlicher Klimaarchive zur Verfügung, mit Hilfe derer indirekt Rückschlüsse auf die klimatischen Bedingungen der vorinstrumentellen Vergangenheit möglich sind. Unterteilen lassen sich diese Quellen nach der Art, mit der sie Klimainformationen festhalten. Dies kann biologisch (z.B. Dicke von Baumringen), chemisch (z.B. Gaseinschlüsse in Eisbohrkernen) oder physikalisch (z.B. Gesteinsmagnetismus) erfolgen.[25]
Einige Klimaarchive, wie die meisten Sedimentbohrkerne, können den Wandel des Klimas nur in geringer zeitlicher Auflösung wiedergeben. Für die Temperaturrekonstruktion der vergangenen Jahrhunderte und speziell für die Diskussion der Frage nach der Außergewöhnlichkeit der Erwärmung der letzten drei bis vier Jahrzehnte ist aber die Verwendung von Klimaindikatoren jährlicher bzw. saisonaler Auflösung von großer Bedeutung. Im Folgenden stehen daher diese hochauflösenden Klimaarchive, zu denen Baumringe, Korallen, jährliche auflösende Eisbohrkerne, geschichtete Sedimentbohrkerne aus Meeren und Seen, sowie Tropfsteine (Stalagmiten) zählen, im Mittelpunkt der Betrachtung.[26] Es sei allerdings erwähnt, dass auch geringer auflösende Klimaarchive in diesem Zusammenhang insofern ihren Nutzen haben, als dass sie als Kontrolle für ermittelte Temperaturrekonstruktionen dienen können.
2.3.1 Baumringe
Baumringe weisen aufgrund der Jahreszeiten ein Bild auf, das durch den Wechsel von Vegetationsruhe und Vegetationsperiode bestimmt ist. Das Frühholz, das im Frühling und Frühsommer angelegt wird unterscheidet sich durch seinen wesentlich dichteren Wuchs von dem im Spätsommer wachsenden Spätholz. Aus diesem Grund lassen sich auch die Jahresringe leicht unterscheiden. Diesen wiederum wird durch den klimatischen Verlauf und die jeweils herrschenden Umweltverhältnisse eine individuelle Prägung gegeben.[27]
Die Temperaturdaten, die sowohl aus der Breite, als auch aus der Dichte der Jahresringe geeigneter Bäume gewonnen werden, gelten als die zuverlässigsten aller aus natürlichen Klimaarchiven ableitbaren Informationen. Verschiedene Studien haben eine hohe Korrelation zwischen den aus Baumringen mehrerer Bäume eines Gebietes (Baumserie) rekonstruierten Temperaturverläufen und den in den jeweiligen Gebieten instrumentell gemessenen Temperaturen nachgewiesen. Baumringe sind außerdem das global am weitesten verbreitete jährlich auflösende natürliche Klimaarchiv.[28] Aufgrund dieser Vorteile bilden Informationen aus Baumringen die wesentliche Datenquelle für die meisten der in den vergangenen Jahren veröffentlichten Rekonstruktionen mittlerer globaler oder hemisphärischer Temperaturverläufe der letzten 1000 Jahre.[29]
Eine Reihe von Einschränkungen und Problemen müssen bei diesem Klimaindikator dennoch berücksichtigt werden. Insbesondere ist hervorzuheben, dass nicht jede Baumart[30] und nicht jeder Standort Klimarückschlüsse aus den Jahresringen erlaubt. So sind Temperaturinformationen nur aus den Ringen derjenigen Bäume zu erhalten, bei denen im Wesentlichen Wärmemangel den beschränkenden Faktor für den jährlichen Holzzuwachs darstellt – und nicht etwa Niederschlag oder andere Klimaelemente. Diese Bedingung ist grundsätzlich für die relativ kalten Standorte nördlicher Breitengrade (etwa nördlich 30° N) sowie für einige höher gelegene (Berg-) Regionen erfüllt.[31]
Klimainformationen aus Baumringen sind daher trotz ihrer im Vergleich zu anderen natürlichen Klimaarchiven weiten Verbreitung global sehr ungleich verteilt. Sowohl für die Tropen, als auch für die südliche Hemisphäre liegen nur sehr wenige Baumring-Datensätze vor. Eine weitere, viel diskutierte Schwierigkeit bei der Nutzung von Baumringen zur Klimarekonstruktion der vergangenen 1000 Jahre ergibt sich aus der Notwendigkeit, Datensätze mehrerer Baumserien zu kombinieren, um einen solch langen Zeitraum rekonstruieren zu können. Hierzu müssen die verschiedenen Serien über identische, überlappende Kalenderjahre miteinander verbunden werden. Abbildung 2 verdeutlicht, dass für weiter zurückreichende Rekonstruktionen auf abgestorbene bzw. durch die Menschen in der Vergangenheit genutzte Bäume zurückgegriffen wird.[32]
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Erstellung einer Baumringchronologie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: National Oceanic & Atmospheric Administration, US Department of Commerce (Hrsg.): NOAA Paleoclimatology, http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html.
Das Problem bei dieser „Überlappungstechnik“ besteht darin, dass an den einzelnen Baumserien in der Regel bereits eine mathematische Glättungsfunktion angewandt wurde, um den bekannten Trend abnehmender Ringweiten älterer Baumringe zu bereinigen. Dieses im Englischen als detrending bezeichnete Verfahren rechnet allerdings nicht nur – wie gewollt – den Alterungseffekt der Baumringe, sondern ebenfalls – allerdings ungewollt – einen über den gesamten Betrachtungszeitraum möglicherweise aufgetretenen langfristigen Temperaturtrend heraus.[33] „Thus, a 100-year-long treering series will not contain any climatic variance at periods longer then 100 years if it is explicitly detrended by a fitted growth curve.”[34]
Aussagen über längerfristige Klimaänderungen, die komplett oder im Wesentlichen auf zusammengefügten Baumringserien beruhen, sind aufgrund der verbundenen Unsicherheiten in Bezug auf möglicherweise herausgerechnete Temperaturtrends in Kritik geraten. Neuere, komplexere statistische Verfahren zur Bildung längerer Baumringchronologien, die insbesondere eine gemeinsame Bereinigung des Alterungseffekts einer Vielzahl von Baumringserien vorsieht, sollen allerdings Rekonstruktionen ermöglichen, die langfristige Temperaturschwankungen weitestgehend berücksichtigen.[35]
Trotz der grundsätzlich sehr hohen Korrelation zwischen Baumringdicke bzw. –dichte und örtlichem Temperaturverlauf, scheint die Zuverlässigkeit dieses Klimaindikators für die letzten paar Jahrzehnte zum Teil deutlich eingeschränkt zu sein. Seit etwa den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts weisen zahlreiche Baumserien – insbesondere aus Erdregionen höherer Breitengrade – eine verringerte Klimasensitivität des Baumringwachstums gegenüber dem Temperaturverlauf auf. Insbesondere die Dichte, aber auch die Dicke der Baumringe dieser Bäume weisen nicht mehr das Wachstum auf, das aufgrund der (seit den 60er Jahren in allen entsprechenden Regionen gestiegenen) Temperaturen zu erwarten gewesen wäre.[36]
Noch sind sich die Forscher nicht sicher, worauf diese relativ plötzlich auftretende Divergenz von Temperaturverlauf und Holzzuwachs zurückzuführen ist. Für möglich gehalten wird das Vorliegen einer absoluten Schwelle der linearen Wachstumsreaktion der Bäume auf Wärme. Diese Grenze könnte aufgrund der hohen Temperaturen im Laufe des 20. Jahrhunderts in einigen Regionen der Erde erreicht worden sein. Möglicherweise einhergehende verringerte Bodenfeuchtigkeit[37] könnte für das Erreichen dieser Schwelle (mit-) verantwortlich sein. Weitere in Betracht gezogene Faktoren für die zu beobachtende Verringerung der Klimasensitivität sind ein erhöhtes Aufkommen pflanzenfressender Insekten sowie höhere UV-B-Level. Es erweist sich allerdings als schwierig, den isolierten Einfluss dieser Faktoren zu betrachten, denn zusätzlichen Einfluss auf das Baumwachstum haben auch andere sich verändernde Variablen, wie die höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre sowie die Zunahme von Bodenversauerung und troposphärischem Ozon.[38]
Die in den vergangenen Jahren erstellten Studien zur Temperaturrekonstruktion haben bei der Verwendung von Baumringdaten üblicherweise Schritte unternommen, um solche Einflüsse so weit wie möglich herauszurechnen.[39]
2.3.2 Korallen
Für die Paleoklimatologie sind Korallen nicht zuletzt deshalb von hoher Bedeutung weil sie aufgrund ihrer Standorte Klimainformationen über tropische und subtropische Regionen der Erde liefern und damit eine gute örtliche Ergänzung zu den Informationen aus Baumringen darstellen. Ähnlich wie bei Bäumen ist bei Korallen das jährliche Wachstum erkennbar. Dieses ist zwar nicht allein auf die Temperatur zurückzuführen, da verschiedene andere Faktoren (vor allem Lichteinfall, aber z.B. auch Nährstoffreichtum und Windstress) eine bedeutende Rolle spielen, dennoch haben sich die Unterschiede im Kalkzuwachs in einigen Regionen als guter Indikator für die Wassertemperatur erwiesen.[40]
Außerdem liefern verschiedene geochemische Eigenheiten der jeweiligen Kalkschichten Informationen über vergangene Temperaturverläufe. So ermöglicht eine Untersuchung der stabilen Sauerstoffisotope der Korallenskelette Rückschlüsse auf die Temperaturentwicklung.[41] Bei der Analyse greift man dabei auf die Erkenntnis zurück, dass die in der Natur vorkommenden Sauerstoffisotope 16O und 18O in unterschiedlichen Verhältnissen im Kalziumkarbonat der Korallen angereichert werden. Das Verhältnis von 16O zu 18O einer gut erhaltenen Kalkschale gibt dabei an, bei welcher Wassertemperatur diese gebildet wurde.[42]
Lebende Korallen können grundsätzlich jährlich oder noch höher aufgelöste Klimainformationen liefern, die bis zu einigen Jahrhunderten in die Vergangenheit reichen. Um tausende von Jahren an Klimageschichte rekonstruieren zu können, bedarf es des Rückgriffs auf abgestorbene Korallen.[43] Während einige auf Korallenanalysen basierende Temperaturrekonstruktionen eine hohe Korrelation mit Instrumentenmessdaten über mehrere Jahrzehnte aufweisen, werfen verschiedene Unsicherheiten bei der Analyse älterer Koralleninformationen Fragen bezüglich ihrer Zuverlässigkeit – auch über längere Zeiträume hinweg – auf.[44]
Da die Korallenanalyse einen vergleichsweise jungen Bereich der Paleoklimatologie darstellt[45], und zudem in den letzten Jahren vielversprechende neue Analyseverfahren entwickelt worden sind, werden von ihr in Zukunft weiter reichende und zuverlässigere Informationen über den Temperaturverlauf der Korallenstandorte erwartet.[46]
2.3.3 Eisbohrkerne
Eisbohrkerne enthalten Informationen über den Klimaverlauf mehrere Jahrtausende und können aus den Polarregionen sowohl der südlichen, als auch der nördlichen Hemisphäre sowie aus tropischen und subtropischen alpinen Regionen gewonnen werden. Eisbohrkerne können somit die Informationen aus Baumringen und Korallen ergänzen, ihre Verfügbarkeit ist aber auf einen sehr kleinen Teil der Erde beschränkt.[47] Eisbohrkerne liefern eine Vielzahl verschiedener Klimainformationen. So kann beispielsweise die Niederschlagsmenge anhand der zum jeweiligen Zeitpunkt akkumulierten Schneemasse bestimmt werden und die Luftblasen, die zwischen dem gefallenen Schnee eingeschlossen werden und langfristig im gefrorenen Eis erhalten bleiben, ermöglichen Forschern Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Atmosphäre der Vergangenheit. So können unter anderem Änderungen der jeweiligen Treibhausgasanteile in der Atmosphäre bestimmt werden. Der Nachweis von Staubpartikeln vulkanischen Ursprungs gibt darüber hinaus wichtige Anhaltspunkte für Zeitpunkte und Intensitäten früherer Vulkanausbrüche und trägt damit zum Verständnis vergangener Klimaschwankungen bei.[48]
Informationen über den vergangenen Temperaturverlauf liefern – ähnlich wie bei Korallen – Analysen des Verhältnisses zwischen den stabilen Sauerstoffisotopen 16O und 18O, deren Auftrennung (Fraktionierung) bei der Verdunstung von Wasser temperaturabhängig erfolgt.[49] Problematisch ist allerdings, dass der Fraktionierungsprozess nicht zwangsläufig erst vor Ort zum Zeitpunkt des Niederschlages erfolgen muss. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, erlaubt das Verhältnis der Sauerstoffisotope Rückschlüsse auf den lokalen Temperaturverlauf. Eine jährliche Datierung der Eisbohrkerne ist prinzipiell möglich, erweist sich in der Praxis jedoch oft als schwierig und ungenau – insbesondere für länger zurückliegende Perioden. In größeren Tiefen von gebohrtem Gletschereis können keine Jahresschichten mehr gezählt werden. In vielen Fällen helfen dann im Eisbohrkern nachgewiesene Anzeichen von Zeitmarkern wie Spuren von Vulkanasche (zusammen mit historischen Aufzeichnungen über Vulkanausbrüche), zumindest eine grobe zeitliche Einordnung zu ermöglichen. Die Datierung ist dann umso leichter, je höher der jährliche Niederschlag ist. In Gegenden mit besonders hohem Niederschlag ist sogar eine saisonale Auflösung möglich.[50]
Im Vergleich zu anderen natürlichen Klimaarchiven erweist sich die für die Ermittlung des lokalen Temperaturverlaufs unerlässliche und als Kalibrierung (vgl. Abschnitt 2.4) bezeichnete Eichung der Eisbohrkerndaten mit instrumentell gemessenen Klimadaten als schwierig, da in den entsprechenden Regionen – wenn überhaupt – erst seit kurzer Zeit instrumentell Messungen durchgeführt werden.[51]
2.3.4 Tropfsteine
Seit einigen Jahren werden verstärkt Versuche unternommen, aus Tropfsteinen (Stalagmiten) in Höhlen Informationen über vergangene Klimaschwankungen abzuleiten. Zu diesem Zweck werden verschiedene Merkmale der säulenförmigen Formationen herangezogen, die vom Wachstum der Steine über deren isotopische Zusammensetzung bis hin zur Analyse von im Kalk eingeschlossenem organischem Material reichen.[52] Die je nach Jahreszeit unterschiedliche Menge und Verdunstung des in Höhlen vorhandenen Wassers spiegelt sich an einigen Standorten im Wachstumsmuster der Steine wieder und ermöglicht somit eine jährliche Auflösung der Klimadaten. Diese lassen sich für bis zu mehrere Jahrtausende rekonstruieren.[53]
Aufgrund einer Vielzahl verschiedener Einflussgrößen (z.B. saisonale Änderungen des Niederschlages, Verharrungsdauer des Grundwassers) auf die unterschiedlichen Merkmale der Tropfsteine, ist eine Interpretation einer einzelnen Klimavariablen – also beispielsweise der Temperatur – schwierig. Nach heutigem Wissensstand können Informationen aus Tropfsteinen zwar in vielen Fällen den Verlauf des lokalen Wasserkreislaufs dokumentieren und dadurch Hinweise auf Veränderungen in der atmosphärischen Zirkulation liefern, für die Rekonstruktion des Temperaturverlaufs der Vergangenheit sind sie aber nur eingeschränkt und eher in qualitativer Form von Nutzen.[54]
2.3.5 Geschichtete Seen- und Meeressedimentbohrkerne
Wie auch Eisbohrkerne sind Sedimente auf dem Grund einiger Seen und Ozeanböden in der Lage, jährlich auflösende Klimainformationen zu liefern. Je nach Standort bleiben dort Ablagerungen von Pollen, Algen und Ton erhalten. Die eingelagerten Pollen geben dabei Auskunft über die vergangene Vegetation in der Umgebung und erlauben damit Rückschlüsse auch auf den vergangenen Temperaturverlauf.[55]
Klimainformationen finden sich primär in den Sedimenten von Seen höherer Breitengrade, bei denen besonders viel Schmelzwasser im Frühling und Frühsommer in die Seen fließt und währenddessen organisches und anorganisches Material in den See eingeleitet wird. Seltener finden sich auch in Meeren jährliche Sedimentschichten (Warven). Dies kann an Küstenregionen und insbesondere an Flussmündungen der Fall sein, wo ungewöhnlich hohe Sedimentablagerungen stattfinden. Warven können – sofern das enthaltene biologische Material eine radiometrische Datierung zulässt – nützliche Klimainformationen in immerhin dekadischer Auflösung liefern.[56]
2.3.6 Bohrlöcher
Daten aus Bohrlöchern stellen direkte Temperaturmessungen aus Bohrungen des Bodens dar. Aus ihnen können vergangene Temperaturverläufe von höchstens dekadischer Auflösung abgeleitet werden. Mit zunehmender Tiefe und damit zunehmendem Alter verringert sich die Auflösung weiter. Die Temperaturunterschiede in den Querschnitten der Bodenbohrlöcher werden herangezogen, um daraus Rückschlüsse auf Veränderungen der Bodenoberflächentemperaturen der Vergangenheit ziehen zu können. Zu diesem Zweck muss der Effekt der sich mit der Zeit in die Tiefe verbreitenden Oberflächentemperatur berücksichtigt werden. Hierfür wiederum ist eine Analyse der jeweiligen Bodenzusammensetzungen durchzuführen. Zusätzlich müssen auch Annahmen bezüglich des geothermischen Hitzeflusses getroffen werden. Denn dieser potenzielle Wärmezufluss muss herausgerechnet werden, will man die tatsächlichen Schwankungen der Bodenflächentemperatur rekonstruieren.[57]
Als Quelle eigenen sich sowohl Erdbohrlöcher aus tropischen, mittleren und subpolaren Breitengrade, als auch Eisbohrlöcher von polaren Eiskappen. Problematisch ist die Tatsache, dass Bodentemperaturen nicht unbedingt die Oberflächentemperaturen widerspiegeln. So können beispielsweise Änderungen in der jährlichen Schneebedeckung zu Schwankungen der Bodentemperatur führen, die unabhängig von Änderungen der Oberflächentemperatur erfolgen. Auch Änderungen in der Vegetation haben einen Einfluss auf die Bodentemperatur. Es wird angenommen, dass Störvariablen wie diese (mit-) verantwortlich sind für die in einigen Fällen festgestellte geringe Zuverlässigkeit dieses Temperaturindikators, die sich beispielsweise in Abweichungen von Ergebnissen aus verschiedenen anderen, örtlich nahe gelegenen Klimaarchiven ausdrückt.[58]
2.3.7 Weitere natürliche Klimaarchive
Änderungen der Position von Gletschermoränen, die sich anhand von Moränenablagerungen nachzeichnen lassen, ermöglichen zumindest indirekt Rückschlüsse auf Zeiten wachsender und schrumpfender Gletschermassen. Die Masse eines Gletschers ist abhängig von klimatischen Faktoren. Allerdings sind Schlussfolgerungen in Bezug auf den Temperatur- oder auch den Niederschlagsverlauf der Vergangenheit schwierig, da beispielsweise sowohl höherer Niederschlag im Winter, als auch niedrigere Sommertemperaturen zu einer Erhöhung der Gesamtgletschermasse führen können.[59]
Als ein gering auflösender Temperaturindikator können Baumlinien in nördlichen Breiten und in Gebirgen dienen. Ein Rückgang der Baumlinie deutet auf niedrigere Temperaturen, ein Aufstieg auf höhere Temperaturen hin. Entscheidend ist dabei die Berücksichtigung des Alters der Bäume, denn nur in ihrer frühen Wachstumsphase reagieren Bäume besonders empfindlich auf niedrige Temperaturen und können daher als Indikator herangezogen werden. Haben sie erst einmal eine gewisse Größe erreicht, können Bäume extreme Temperaturen wesentlich besser überleben.[60]
Möglicherweise kann die Paleoklimatologie in Zukunft insbesondere für die flache Nordatlantikregion auch auf zeitlich hochauflösende Klimainformationen aus Isotopenanalysen der Kalkschalen von Weichtieren wie Muscheln zurückgreifen. Hierfür müssen jedoch noch zuverlässige Analyseverfahren entwickelt werden.[61]
2.4 Verfahren zur Temperaturrekonstruktion
Bevor die verschiedenen in Abschnitt 2.3 besprochenen natürlichen Klimaarchive zur Rekonstruktion vergangener Temperaturverläufe verwendet werden können, müssen die aus ihnen gewonnenen paleoklimatologischen Informationen geeicht werden. In der Regel wird bei diesem auch als Kalibrierung bezeichneten Verfahren auf die jeweils vor Ort des Klimaarchivs instrumentell gemessenen Temperaturen zurückgegriffen. Mit Hilfe von Regressionsanalysen wird der jeweiligen Ausprägung eines Klimaindikators eine entsprechende Temperatur zugeordnet, wobei durch die Regression ebenfalls ermittelt wird, auf welchen Teil des Jahres oder der Jahreszeit der Klimaindikator reagiert.[62]
Auf diese Weise wird prinzipiell die Rekonstruktion des lokalen Temperaturverlaufs über die gesamte Länge der vom Klimaarchiv erfassten Zeitspanne ermöglicht. Voraussetzung für dieses Verfahren sind ausreichend lange Zeitperioden, in denen sich die Information aus dem Klimaarchiv und die Aufzeichnungen lokaler instrumenteller Messdaten überschneiden. Üblicherweise wird aber für die Kalibrierung ein Teil der lokal verfügbaren Messdatenreihe zurückgehalten, um damit anschließend die Zuverlässigkeit des ermittelten Verhältnisses zwischen Indikator und gemessener Temperatur anhand unabhängiger Daten zu verifizieren.[63]
Dieses Kalibrierungsverfahren ist in solchen Regionen der Erde besonders schwierig bzw. potenziell unzuverlässig, in denen instrumentelle Messdatenreihen weniger weit zurückreichen und/oder örtlich unzureichend verteilt vorliegen. Dies trifft insbesondere für die Antarktis und die küstenfernen Bereiche Südamerikas und Afrikas zu. Da sich diese Regionen überwiegend auf der südlichen Erdhalbkugel befinden, erweist sich die Temperaturrekonstruktion der südlichen (im Vergleich zur nördlichen) Hemisphäre als wesentlich schwieriger.[64]
Möglichst lange Vergleichszeiträume zwischen Klimaarchiv und gemessenen Temperaturdaten ist nicht zuletzt deshalb wünschenswert, weil somit zuverlässigere Aussagen über die Stationarität eines Klimaarchivs getroffen werden können. Nur wenn sich Stationarität, d.h. eine über die untersuchte Zeit hinweg gleiche Reaktion des Klimaindikators auf gleiche Temperaturschwankungen nachweisen lässt, ist der Rückgriff auf das entsprechende Klimaarchiv zum Zwecke der Temperaturrekonstruktion sinnvoll.[65]
Dabei ist zu bedenken, dass der Nachweis von Stationarität eines Klimaarchivs über den (durch die Verfügbarkeit von Instrumentenmessdaten vorgegebenen) verifizierbaren Zeitraum hinaus kaum möglich ist.[66] So ist zwar beispielsweise – wie erwähnt – grundsätzlich eine hohe Korrelation zwischen Baumringen und örtlichem Temperaturverlauf nachgewiesen worden[67], allerdings kann ein solcher Nachweis nur für den Zeitraum zuverlässig erbracht, werden, für den instrumentelle Messdaten vorliegen. Und dies ist zumeist nicht vor Beginn des 19. Jahrhunderts der Fall. Gerade das an einigen Standorten nachgewiesene nicht-stationäre Wachstumsverhalten der Baumringe in den letzten paar Jahrzehnten (vgl. Abschnitt 2.3.1) hat zum Teil Zweifel an der Zuverlässigkeit von mehreren hundert Jahre zurückreichenden, auf Baumringanalysen basierenden Temperaturrekonstruktionen aufkommen lassen.[68],[69]
Neben der beschriebenen individuellen Kalibrierung einzelner Klimaarchive anhand lokaler Messdaten und der anschließenden gemeinsamen Betrachtung zur großflächigen Temperaturrekonstruktion wird in der Paleoklimatologie alternativ auch auf die Methode der so genannten Klimafeldrekonstruktion (climate field reconstruction, CFR) zurückgegriffen. Dabei findet eine gemeinsame und gleichzeitige Kalibrierung aller paleoklimatologischer Daten statt. Zu diesem Zweck werden die instrumentellen Daten in ein globales Gitternetz überführt und die gemessenen Temperaturänderungen in den einzelnen Bereichen des Netzes „trainieren“ die verschiedenen Klimaarchive. Auch für dieses Verfahren ist im Anschluss eine Vergleichsprüfung mit zurückgehaltenen instrumentellen Messdaten unerlässlich, um die Zuverlässigkeit des ermittelten Verhaltensmodells der Klimaarchive zu prüfen.[70]
Für die Temperaturrekonstruktion einer Hemisphäre oder der gesamten Erde ist es unerlässlich, auf mehrere verschiedene Arten von Klimaarchiven zurückzugreifen. Nur so ist es möglich, örtlich ausreichend gut verteilte Informationen zu erhalten. Außerdem ermöglicht die Kombination verschiedener Klimaarchive eine optimale Ausnutzung ihrer unterschiedlichen Stärken bzw. eine Kompensation der jeweiligen Beschränkungen und Verzerrungen einer jeden Quelle von Klimainformationen.[71]
3. Erkenntnisse und Diskussionen zum Temperaturverlauf der letzten 1000 Jahre
Das im Zuge der Diskussionen um den Klimawandel gestiegene Interesse an paleoklimatologischen Erkenntnissen sowie Fortschritte im Bereich der Analyse natürlicher Klimaarchive haben sicherlich dazu beigetragen, dass es in den letzten rund zehn Jahren eine Reihe von Publikationen gegeben hat, die sich der Rekonstruktion des hemisphärischen oder globalen Temperaturverlaufs der letzten rund 1000 Jahre gewidmet haben. Deutlich überwiegen dabei die in Abschnitt 3.1 besprochenen Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass wahrscheinlich sowohl der Temperaturanstieg der vergangenen 30 Jahre, als auch die heute erreichte absolute Temperaturhöhe in den vergangenen mindestens 1000 Jahren einmalige Phänomene darstellen.
Einige Wissenschaftler bestreiten jedoch diese Aussage oder halten sie zumindest aufgrund bestehender Unsicherheiten für voreilig. Abschnitt 3.2 stellt die wesentliche wissenschaftliche Kritik an der vorherrschenden Meinung dar, während Abschnitt 3.3 abschließend auf die außerwissenschaftliche Diskussion um die verschiedenen Temperaturrekonstruktionen eingeht.
3.1 Die vorherrschende Meinung in der Paleoklimatologie
Die bis heute wohl bekannteste und am häufigsten zitierte Rekonstruktion des hemisphärischen oder globalen Temperaturverlaufs wurde 1998 in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Die Autoren, Mann und Raymond Bradley von der University of Massachusetts sowie Malcolm K. Hughes von der University of Arizona rekonstruierten dabei den Temperaturverlauf der Nordhalbkugel der vergangenen 600 Jahre unter Rückgriff auf verschiedene Arten von Klimaarchiven. Neben Informationen aus Baumringen und Eisbohrkernen wurden auch Korallen sowie historische Aufzeichnungen verwendet. Die Kalibrierung der Klimaarchive fand dabei durch das in Abschnitt 2.4 angesprochene Verfahren der Klimafeldrekonstruktion statt.[72]
1999 erweiterten die Autoren ihre Rekonstruktion auf die vergangenen 1000 Jahre (siehe Abbildung 3). Die Kurve zeigt den rekonstruierten Verlauf der bodennahen Erd-Temperatur der Nordhalbkugel gemittelt über 50 Jahre. Der graue Bereich um die Kurve deutet auf die Unsicherheiten im verwendeten Datenmaterial hin. Die Rekonstruktion zeigt deutlich, dass die Erdtemperatur des letzten Jahrtausends keinen konstanten Verlauf aufwies. Neben den Schwankungen innerhalb einiger Jahrzehnte ist auch zu beobachten, dass die Temperaturen zwischen 1000 und 1400 etwas wärmer waren als in der Periode von 1400 bis 1900. Im Vergleich zu der Entwicklung im 20. Jahrhundert waren die Schwankungen bis zum Jahr 1900 aber gering. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass es trotz bestehender Unsicherheiten – insbesondere in Bezug auf die älteren Jahrhunderte – wahrscheinlich ist, dass die Erwärmung des späten 20. Jahrhunderts in der betrachteten Zeitspanne beispiellos ist und die 90er Jahre das wärmste Jahrzehnt sowie 1998 das wärmste Jahr des vergangenen Jahrtausends waren.[73]
Abbildung 3: Temperaturrekonstruktion der nördlichen Hemisphäre von Mann u. a. (1999)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Mann, M. E. u. a.: Northern Hemisphere Temperature During the Past Millennium: Inferences, Uncertainties, and Limitations, http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/millennium-camera.pdf, mit Modifikationen
Diese klare Aussage sowie die graphische Darstellung der Rekonstruktion, die auf den ersten Blick die Außergewöhnlichkeit des Temperaturverlaufs im 20. Jahrhundert erkennen lässt, haben sicherlich wesentlich zu der Bekanntheit der Veröffentlichung von Mann, Bradley und Hughes beigetragen. Diese Bekanntheit, die durch die Veröffentlichung der grafischen Rekonstruktion im dritten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) im Jahr 2001 weiter gesteigert wurde, hat allerdings auch dazu geführt, dass sich zahlreiche Wissenschaftler und andere Personen mit der Forschung der drei Geophysiker kritisch auseinander gesetzt haben.
Die verschiedenen hervorgebrachten Kritikpunkte (vgl. Abschnitt 3.2) können zum Teil durch den Hinweis entkräftet werden, dass in der Folgezeit der Veröffentlichung dieser Arbeit eine Reihe von anderen Forschern ihre eigenen Rekonstruktionen hemisphärischer oder globaler Temperaturverläufe erstellt haben und trotz unterschiedlicher Datengrundlagen sowie unterschiedlicher statistischer Rekonstruktionsverfahren im Wesentlichen zu den gleichen Ergebnissen über die Außergewöhnlichkeit der Erwärmung des späten 20. Jahrhunderts gekommen sind.[74] Jones und Mann verdeutlichen dies, indem sie eine Reihe von unabhängig voneinander rekonstruierten Temperaturverläufen der letzten 1000 Jahre für die nördliche Erdhalbkugel zusammenstellen (siehe Abbildung 4). Trotz Unterschiede im Ausmaß der Klimaschwankungen ist bei allen Rekonstruktionen die Außergewöhnlichkeit der Erwärmung der letzten Jahrzehnte ersichtlich.[75]
Abbildung 4: Temperaturrekonstruktionen der nördlichen Hemisphäre ab 1000 n. Chr.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Mann, M. E. und Jones, P. D.: Climate over past millennia, in: Reviews of Geophysics, B. 42, H. RG2002, 2004, S. 16, mit Modifikationen. Genaue Angaben zu den einzelnen Quellen der Rekonstruktionen finden sich im Literaturverzeichnis der vorliegenden Arbeit.
3.2 Die wissenschaftliche Diskussion um die Temperaturrekonstruktionen
Der wahrscheinlich am häufigsten gegen die im vorherigen Abschnitt vorgestellten hemisphärischen oder globalen Temperaturrekonstruktionen hervorgebrachte Kritikpunkt ist die Behauptung, dass diese Rekonstruktionen die tatsächlich in der Vergangenheit aufgetretenen Temperaturschwankungen unterschätzen. So wird vermutet, dass viele Klimaarchive, insbesondere die häufig verwendeten Baumringe das Ausmaß längerfristiger Temperaturschwankungen weniger ausgeprägt wiedergeben können als kurzfristige Schwankungen. Da diese Klimaarchive lediglich – je nach Datenverfügbarkeit lokaler instrumenteller Messdaten – über einen Zeitraum von zumeist maximal 150 Jahren kalibriert werden können, bleibt die verringerte Aussagekraft über längerfristige Klimaschwankungen unberücksichtigt. Insbesondere die niederfrequente Variabilität (low frequency variability), d.h. die im Laufe von mehreren Jahrzehnten und Jahrhunderten erfolgten Temperaturschwankungen werde dadurch – so die Kritiker unterschätzt.[76]
Eine viel beachtete, im Jahr 2004 in der Zeitschrift Science veröffentlichte Studie von Hans von Storch vom deutschen GKSS-Institut für Küstenforschung in Geesthacht sowie fünf weiteren Forschern widmet sich dieser Problematik und kommt zu dem Schluss, dass die tatsächlichen Temperaturschwankungen um mindestens den Faktor 2 stärker gewesen sein könnten, als die in den Rekonstruktionen von Mann und Kollegen. Von Storch und die anderen Autoren sind zu dieser Erkenntnis gekommen, nachdem sie die letzten 1000 Jahre mit einem dreidimensionalen Klimamodell simulierten. Die Klimasimulation wurde mehrfach, mit jeweils verschiedenen für plausibel gehaltenen externen Klimaeinflüssen durchgeführt.[77] Klimamodelle unterschiedlicher Art haben bereits vor dieser Studie auf – im Vergleich zu den paleoklimatologischen Rekonstruktionen – ausgeprägtere Temperaturschwankungen hingedeutet.[78]
Jones und Mann betonen allerdings, dass ihre Temperaturrekonstruktion der letzten 1000 Jahre bemerkenswert ähnlich verläuft wie verschiedene Modellsimulationen. Alle betrachteten Modelle verlaufen vollständig oder überwiegend innerhalb des Unsicherheitsbereichs der paleoklimatologischen Rekonstruktion und die Rekonstruktion befindet sich etwa im mittleren Bereich der verschiedenen Modellschätzungen. Die gegenüber den Modellergebnissen geringeren Temperaturschwankungen ihrer Rekonstruktion verteidigen sie, indem sie auf die noch bedeutsamen Unsicherheiten der Klimamodelle in Bezug auf sowohl das vergangene Ausmaß, als auch die genaue Wirkung der einzelnen Klimaeinflüsse (z.B. Sonnenstrahlung, Vulkantätigkeit) hinweisen.[79]
Von Storch und Kollegen heben demgegenüber hervor, dass auch einige paleoklimatologische Temperaturrekonstruktionen auf größere Temperaturschwankungen hindeuten, als die vieldiskutierte Rekonstruktion von Mann und Kollegen aus dem Jahr 1998. Als Beispiel wird auf eine Studie aus dem Jahr 2002 von Jan Esper von der Schweizer Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) und Kollegen verwiesen. Diese Studie zielte besonders darauf ab, durch geeignete statistische Rekonstruktionsverfahren die Informationen der als Klimaarchiv verwendeten Baumringe über langfristige Temperaturschwankungen möglichst zu erhalten. Im Ergebnis kommen sie tatsächlich zu einer höheren Klimavariabilität als Mann und Kollegen.[80]
Jones und Mann halten dem entgegen, dass das neuartige, in der Studie von Esper und Kollegen verwendete statistische Verfahren möglicherweise die langfristigen Temperaturschwankungen sogar über zeichnen könnte. Zudem könne die größere Variabilität zumindest zum Teil dadurch erklärt werden, dass die Autoren im Gegensatz zu Mann und Kollegen ausschließlich auf Baumringe als Klimaarchive zurückgreifen und damit zum einen – aufgrund der Wachstumsperioden der Bäume – nur Informationen über die warme Jahreszeit erhalten und zum anderen nur einen bestimmten Teil der Nordhalbkugel (nördlich des 30. Breitengrades) durch Klimainformationen abdecken.[81]
Über die Bedenken bezüglich der Zuverlässigkeit langfristiger Baumringchronologien hinaus findet sich in der wissenschaftlichen, von Experten begutachteten (peer-reviewed) Fachliteratur kaum fundamentale Kritik an den Temperaturrekonstruktionen von Mann und Kollegen sowie an den anderen, zu ähnlichen Ergebnissen kommenden Rekonstruktionen. Eine Ausnahme stellen diesbezüglich die Astrophysiker Willie Soon und Sallie Baliunas vom Harvard Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, Massachusetts dar. In verschiedenen, zum Teil auch von anderen Experten begutachteten Fachzeitschriften, haben diese beiden Autoren in den letzten Jahren Artikel veröffentlicht, die grundlegende Kritik an den Temperaturrekonstruktionen verschiedener Paleoklimatologen äußern.[82]
Unter anderem betonen Soon und Baliunas die bestehenden Unsicherheiten der verschiedenen in der Paleoklimatologie genutzten Klimaarchive und kritisieren die verwendeten Verfahren zur Temperaturrekonstruktion. Soon und Baliunas zweifeln grundsätzlich an dem Sinn der Erstellung quantitativer hemisphärischer oder globaler Temperaturrekonstruktionen, zumal die Klimaarchive sowohl zeitlich als auch örtlich zu große Lücken aufweisen würden und die Länge der zur Kalibrierung und Verifikation zur Verfügung stehenden instrumentellen Messdaten sehr kurz sei.[83]
Speziell an der Studie von Mann und Kollegen aus dem Jahr 1998 kritisieren Soon und Baliunas - neben der überwiegenden Verwendung von Baumringdaten - das dort verwendete CFR-Verfahren (vgl. Abschnitt 2.4).[84] Für die Verwendung dieses Verfahrens muss die Annahme getroffen werden, dass die regionalen Temperaturschwankungen während des Kalibrierungszeitraums ein zumindest ähnliches Muster aufweisen wie die Schwankungen der zu rekonstruierenden Vergangenheit. Im Gegensatz zu Mann und Kollegen[85] halten Soon und Beliunas diese Annahme nicht für plausibel.[86] In einer späteren Veröffentlichung räumte Mann ein, dass insbesondere die wahrscheinliche Veränderung des Klimas durch den Menschen im 20. Jahrhundert dazu führen könnte, dass eine gleichzeitige Kalibrierung aller verwendeten paleoklimatologischen Daten zu Verzerrungen in der Rekonstruktion früherer Jahrhunderte führt.[87]
In Bezug auf diesen Diskussionspunkt ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sowohl spätere Rekonstruktionen von Mann und Kollegen[88], als auch Rekonstruktionen anderer Wissenschaftler[89] im Wesentlichen zu den gleichen Ergebnissen führen wie die Studie von Mann und Kollegen aus dem Jahr 1998, obwohl erstere nicht auf das Verfahren der Klimafeldrekonstruktion zurückgreifen. Die Ergebnisse gleichen sich insofern, als dass sie jeweils den Schluss zulassen, dass die globale Erwärmung des 20. Jahrhunderts, insbesondere die seit den 70er Jahren, wahrscheinlich einmalig im Verlauf der letzten 1000, möglicherweise auch der letzten 2000 Jahre ist.
Diese Aussage versuchen Soon und Baliunas in ihren Veröffentlichungen zu widerlegen. Neben der Kritik an den Rekonstruktionen der führenden Paleoklimatologen führen sie hierzu ausführliche Informationen über paleoklimatologische Daten aus den verschiedenen Regionen der Erde an. Ihr Ziel ist es dabei, aufzuzeigen, dass es schon in den letzten 1000 bis 2000 Jahren immer wieder starke Schwankungen der mittleren globalen Erdtemperatur gegeben hat, die sich insbesondere in der mittelalterlichen Wärmeperiode (Medieval Warm Period, MWP) und in der kleinen Eiszeit (Little Ice Age, LIA) manifestieren. Soon und Baliunas definieren den Zeitraum der MWP mit 800 – 1300 und den der LIA mit 1300 bis 1900.[90]
Um ihre These zu testen, dass die Erwärmung des 20. Jahrhunderts nicht außergewöhnlich war, untersuchen die Autoren, ob die verschiedenen, ihnen vorliegenden Klimaarchive jeweils für sich allein betrachtet ihre größten Temperaturanomalien im 20. Jahrhundert haben oder aber während der MWP oder der LIA. Dabei sehen die Autoren die These von außergewöhnlicher Erwärmung im 20. Jahrhundert dann als widerlegt an, wenn eine Mehrzahl von Klimaarchiven entweder während der MWP besonders warmes, feuchtes oder trockenes oder während der LIA besonders kaltes, feuchtes oder trockenes Klima aufweist. Neben der Temperatur wird auch der Niederschlag berücksichtigt, da die Autoren – so die Begründung – eine isolierte Betrachtung einzelner Elemente des komplexen Klimasystems nicht für sinnvoll halten. Betrachtet werden nur 50-jahres Durchschnitte, weil eine höhere Auflösung älterer paleoklimatischer Daten oft nicht sinnvoll sei.[91]
Tatsächlich kommen Soon und Baliunas bei ihrer Betrachtung zu dem Ergebnis, dass nur drei der rund 100 betrachteten Klimaarchive tatsächlich im 20. Jahrhundert einen außergewöhnlichen Charakter aufweisen. Im Gegensatz dazu zeigen die Klimaarchive in großer Mehrheit Klimaanomalien während der MWP (in Form besondere Wärme, Feuchte oder Trockenheit) und während der LIA (in Form besonderer Kälte, Feuchte oder Trockenheit).[92] Diese Herangehensweise der Autoren sieht sich in der Fachliteratur massiver Kritik ausgesetzt.
Einer der Artikel von Soon und Baliunas erschien in der Fachzeitschrift Climate Research. Dessen damaliger Chefredakteur, von Storch, kam daraufhin zum Schluss, dass in diesem Fall das Gutachtersystem der Zeitschrift versagt hätte. Die Studie von Soon und Baliunas sei fehlerhaft gewesen und hätte nicht veröffentlicht werden dürfen. Als ihn die Herausgeber daran hinderten, in der Zeitschrift einen kritischen Leitartikel in eigener Sache zu verfassen, in dem er auch Änderungen des Gutachtersystems vorschlagen wollte, ist von Storch von seinem Posten zurückgetreten.[93]
Zwölf angesehene Klimaforscher stellten in einem gemeinsamen Aufsatz aus dem Jahre 2003[94] klar, dass die Ergebnisse der Arbeiten von Soon und Baliunas in wesentlichen Punkten nicht mit dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand übereinstimmen. So wird unter anderem auf die offensichtliche Willkür bei der Definition der MWP und der LIA hingewiesen. Sowohl außergewöhnliche Trockenheit, als auch außergewöhnliche Feuchte werden von Soon und Baliunas als Nachweis betrachtet, dass es entweder ein warmes Mittelalter, oder aber eine „Kleine Eiszeit“ gegeben haben muss. Dazu bemerken die Kritiker: „Such a criterion, ad absurdum, could be used to define an y period of climate as 'warm' or 'cold' and thus makes no meaningful contribution to discussions of past climate change.”[95] Des Weiteren wird kritisiert, dass ein Betrachtungszeitraum von 50 Jahren die besonders starke Erwärmung ab 1970 nicht angemessen berücksichtigt.[96]
Hauptsächlicher Angriffspunkt gegenüber den Arbeiten von Soon und Baliunas ist aber deren völlige Vernachlässigung des in der Paleoklimatologie immer wieder betonten Aspekts, dass aus einzelnen Betrachtungen lokaler Klimaarchive keine Rückschlüsse auf den Verlauf der globalen mittleren Temperatur gezogen werden dürfen. So ist seit langer Zeit bekannt, dass das globale Klimasystem ein wellenförmiges Muster aufweist. Dieses Merkmal sorgt dafür, dass sich bestimmte Erdregionen erwärmen können, während andere Regionen gleichzeitig abkühlen. Zwar berücksichtigen Soon und Baliunas Klimaarchive aus einer Vielzahl verschiedener Regionen der Erde, die Erkenntnisse werden aber jeweils isoliert und nicht zusammen betrachtet.[97]
Wäre letzteres geschehen, so wäre deutlich geworden, dass die beispielsweise während der (bei Soon und Baliunas außergewöhnlich lang definierten) MWP in den verschiedenen Regionen der Erde nachgewiesenen Zeitpunkte hoher Temperaturen oftmals um mehrere Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte voneinander abweichen. Bei der – von Soon und Baliunas aufgrund angeblich zu großer Unsicherheiten abgelehnten – Ermittlung bzw. Abschätzung mittlerer globaler Temperaturverläufe, hätten sich die Schwankungen der Temperaturen in den verschiedenen Regionen der Erde vermutliche (weitestgehend) ausgeglichen. Das besondere der Erwärmung des späten 20. Jahrhunderts ist hingegen, dass sie zeitgleich in nahezu allen Regionen der Erde zu beobachten ist.[98]
3.3 Die außerwissenschaftliche Diskussion um die Temperaturrekonstruktionen
Das ungewöhnliche Vorgehen der zwölf Klimaforscher, durch eine gemeinsame Veröffentlichung die Schwächen der Arbeiten von Soon und Baliunas herauszustellen, begründen sie mit der großen Aufmerksamkeit, die diese Arbeiten nach ihrer Veröffentlichung gerade außerhalb der Wissenschaft erlangt haben.[99] Neben zahlreichen Berichten in den Medien fanden beispielsweise Hinweise auf die Erkenntnisse von Soon und Baliunas ihren Weg in einen 2003 von der der US-Umweltbehörde EPA erstellten Bericht über den Zustand der Umwelt des Landes.[100],[101] Außerdem wurde Soon im selben Jahr zu einer Anhörung vor dem US-Senat eingeladen. Organisiert hatte die Veranstaltung James Inhofe, ein Senator der Republikanischen Partei, der dafür bekannt ist, die Bedeutung anthropogener Treibhausgasemissionen für das Klimasystem abzustreiten.[102]
Zwei Jahre später war es der US-Kongressabgeordnete und Republikaner Joe Barton, der sich noch deutlicher in die Wissenschaft der Klimaforschung einmischte. Mitte 2005 schrieb er Briefe unter anderem an Michael Mann und an den Vorsitzenden des IPCC, Rajendra Pachauri. In dem Brief an Mann forderte Barton – in seiner Funktion als Vorsitzender des Ausschusses für Energie und Handel des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten – diesen dazu auf, ihm Informationen zu dessen Lebenslauf, zu den Auftraggebern seiner wissenschaftlichen Arbeiten und zu den mit diesen Aufträgen möglicherweise einhergehende Bedingungen zukommen zu lassen. Auch die den Arbeiten von Mann zugrunde liegenden Rohdaten sollten dem Ausschuss zu Verfügung gestellt werden. Als Grund für dieses Interesse nennt Barton Zweifel an der Richtigkeit der wissenschaftlichen Arbeiten von Mann und den darauf basierenden Schlussfolgerungen des IPCC. Es müsse sichergestellt werden, dass eine Klimaschutzpolitik, die in Zukunft möglicherweise Billionen von Dollar kosten könnte, auf einer soliden Basis steht.[103]
Neben hochrangigen US-Politikern[104] haben auch viele Wissenschaftler das Vorgehen Bartons - speziell den aggressiven Ton seiner Briefe - kritisiert. Raymon Bradley, neben Mann einer der Autoren der bekannten Studie von 1998, wies darauf hin, dass es „absurd“ sei anzunehmen, dass die Feststellungen des dritten IPCC-Sachstandsberichts allein auf einer einzelnen Arbeit beruhen würden. Bradley vermutet, dass die Briefe den Zweck verfolgen, das Vertrauen in den IPCC zu untergraben, bevor dieser 2007 einen neuen Sachstandsbericht veröffentlicht.[105]
4. Fazit
Die Zuverlässigkeit paleoklimatologischer Temperaturrekonstruktionen vergangener Jahrhunderte und Jahrtausende hängt ganz wesentlich von der Quantität und Qualität der zur Verfügung stehenden Daten aus natürlichen Klimaarchiven ab. Trotz Verbesserungen in den vergangenen Jahren ist es nach wie vor von hoher Bedeutung, ihre Anzahl und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Zu diesem Zweck müssen die bekannten (insbesondere die relativ neu angewandten geochemischen) Analyseverfahren weiter verbessert werden und die Forschung an neuartigen Analyseverfahren und auch neuen Arten von Klimaarchiven vorangetrieben werden. Aber auch die Bedeutung der Aktualisierung und Erweiterung vorhandener Klimaarchivdaten darf nicht unterschätzt werden. So wurden viele wichtige Datenserien in den 1970er und 1980er Jahren erstellt und – wohl auch aufgrund der nicht unwesentlichen Kosten vieler Klimaarchiventnahmen – seitdem nicht mehr aktualisiert. Eine Aktualisierung der Daten aus Klimaarchiven verlängert den Zeitraum, in denen diese Daten mit den instrumentell gemessenen Temperaturen überlappen und damit auch den Zeitraum, in dem die Klimaarchivdaten kalibriert und verifiziert werden können. Dies erhöht potenziell die Zuverlässigkeit der Rekonstruktion vergangener Temperaturverläufe.
Trotz der im Laufe der vorliegenden Arbeit angesprochenen Unsicherheiten in Teilen der Datengrundlage und der Rekonstruktionsverfahren, geht heute offenbar die Mehrheit der Klimaforscher davon aus, dass die hohen Temperaturen seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts einmalig im Verlauf der letzten mindestens 1000 Jahre sind.[106] Einige Wissenschaftler sind allerdings vorsichtiger und halten eine solche Aussage angesichts der Unsicherheiten über die tatsächlichen Temperaturschwankungen der Vergangenheit (noch) für verfrüht.[107] Nur sehr wenige Wissenschaftler vertreten die Position, dass es in den letzten 1000 oder 2000 Jahren wahrscheinlich oder mit Sicherheit mindestens eine Periode gegeben hat, die wärmer war als der Zeitabschnitt seit den 1970er Jahren. Wie anhand der Arbeiten von Soon und Baliunas aufgezeigt wurde, weist allerdings der wissenschaftliche Nachweis dieser Position erhebliche Schwächen auf. Zusätzliche Zweifel an der Integrität der Arbeiten dieses sehr kleinen Anteils der Klimawissenschaftler können oftmals deren Förderer erwecken. Im Falle der in der vorliegenden Arbeit diskutierten Studie von Soon und Baliunas ist das American Petroleum Institute, ein US-Unternehmerverband der Öl- und Gasindustrie, einer der vier aufgelisteten Geldgeber.[108]
Klar ist auch: Selbst wenn die Temperaturen beispielsweise während des Mittelalters in einem Zeitabschnitt ähnlich hoch oder gar höher lagen als in den vergangenen Jahrzehnten, so wäre dies kein Widerspruch zu dem in den vergangenen Jahren weiter gefestigten Konsens in der Klimawissenschaft, dass der durch den Menschen verursachte Ausstoß der so genannten Treibhausgase wesentlich zum Anstieg der Temperaturen seit Ende des 19. Jahrhunderts beigetragen hat und voraussichtlich in Zukunft zu einem weiteren deutlichen Temperaturanstieg führen wird. Denn dieser Konsens basiert nicht nur auf der durch die Paleoklimatologie aufgezeigten Ungewöhnlichkeit der heutigen Erdtemperatur, sondern auch auf den seit langem bekannten naturwissenschaftlichen Kenntnissen über die (den natürlichen Treibhauseffekt verstärkenden) Effekte von CO2 und anderen Spurengasen in der Atmosphäre. Außerdem zeigen Klimamodellsimulationen deutlich, dass der Temperaturanstieg seit etwa 1970 nur dann zu erklären ist, wenn neben natürlichen Klimaeinflüssen wie Sonnenaktivität und Vulkantätigkeit auch der durch den Menschen verursachte Ausstoß von Treibhausgasen berücksichtigt wird.[109]
Die Versuche einiger „Klimaskeptiker“, die in der Wissenschaft geführte Diskussion über die Aussagekraft und Grenzen der Temperaturrekonstruktionen als Beleg für wissenschaftliche Zweifel am menschlichen Einfluss auf das Klimasystem zu deuten, haben daher keine Berechtigung.
Literaturverzeichnis
Briffa, K. R. u. a.: Low-frequency temperature variations from a northern tree ring density network, in: Journal of Geophysical Research, Bd. 106, H. D3/2001, S. 2929-2941.
Briffa, K. R. u. a.: Reduced sensitivity of recent tree-growth to temperature at high northern latitudes, in: Nature, Bd. 391, 1998, S. 678-682.
Crowley , T. J.: Causes of Climate Change over the Past 1000 Years, in: Science, Bd. 289, 2000, S. 270-277.
Crowley , T. J. und Lowery, T. S.: How warm was the Medieval Warm Period?, in: Ambio, H. 1/2000, S. 51-54.
Esper, J. u. a.: Low-frequency signals in long tree-line chronologies for reconstructing past temperature variability, in: Science, Bd. 295, 2002, S. 2250-2253.
Glaser, R.: Klimageschichte Mitteleuropas: 1000 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, Darmstadt 2001.
Govindasamy, B. u. a.: Land use Changes and Northern Hemisphere Cooling, in: Geophysical Research Letters, Bd. 28, H. 2/2001, S. 291-294.
Harris, P.: Bush covers up climate research, in: The Observer v. 21.09.2003, http://observer.co.uk/international/story/0,6903,1046363,00.html, Stand: 30.04.2006.
Huch, M. u. a. (Hrsg.): Klimazeugnisse der Erdgeschichte – Perspektiven für die Zukunft, Berlin 2001.
Illinger, P.: So viele Meilen bis Kyoto, in: Süddeutsche Zeitung v. 12.08.2003, http://w3g.gkss.de/staff/storch/CR-problem/SZ.030812.htm, Stand: 30.04.2006.
Jones, P. D. (Hrsg.): Climatic Variations and Forcing Mechanisms of the Last 2000 Years, NATO ASI Ser., Ser. I, Bd. 41, New York 1996.
Jones, P. D. u. a.: High-resolution palaeoclimatic records for the last millennium: Integration, interpretation and comparison with general circulation model control run temperatures, in: Holocene, H. 8/1998, S. 455-471.
Jones, P. D. u. a.: Surface air temperature and its changes over the past 150 years, in: Reviews of Geophysics, Bd. 37, H. 2/1999, S. 173-199.
Mann, M. E.: The value of multiple proxies, in: Science, Bd. 297, 2002, S. 1481-1482.
Mann, M. E. und Jones, P. D.: Climate over past millennia, in: Reviews of Geophysics, Bd. 42, H. RG2002, 2004, S. 1-42.
Mann, M. E. u. a.: Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries, in: Nature, Bd. 392, 1998, S. 779–787.
Mann, M. E. u. a.: Northern Hemisphere Temperature During the Past Millennium: Inferences, Uncertainties, and Limitations, http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/millennium-camera.pdf, 1999, Stand: 02.04.2006.
Mann, M. E. u. a.: On past temperatures and anomalous late-20th century warmth, http://w3g.gkss.de/staff/storch/pdf/Soon.EosForum20032.pdf, 2003, Stand: 02.04.2006.
National Oceanic & Atmospheric Administration, US Department of Commerce [Hrsg.]: NOAA Paleoclimatology, http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/paleo.html, Stand: 30.04.2006.
Osborn, T. J. und Briffa, K. R.: The Spatial Extent of 20th-Century Warmth in the Context of the Past 1200 Years, in: Science, Bd. 311, 2006, S. 841-844.
Pease, R.: Politics plays climate 'hockey', BBC News Science/Nature, veröffentlicht am 18.07.2005, http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4693855.stm, Stand: 01.05.2006.
Polyak, V. J., und Asmerom, Y.: Late Holocene climate and cultural changes in the southwestern United States, in: Science, Bd. 294, 2001, S. 148-151.
Soon, W., S. u. a.: Reconstructing climatic and environmental changes of the past 1000 years: A reappraisal, in: Energy & Environment, H. 2-3/2003, S. 233-296.
Stott, P. A., u. a.: External Control of 20th Century Temperature by Natural and Anthropogenic Forcings, in: Science, Bd. 290, 2000, S. 2133-2137.
UK Met Office, Hadley Centre [Hrsg.]: Global temperatures, http://www.metoffice.com/research/hadleycentre/obsdata/globaltemperature.html, Stand: 30.04.2006.
von Storch, H. u. a.: Reconstructing Past Climate from Noisy Data, in: Science, Bd. 306, 2004, S. 679-682.
[...]
[1] Vgl. Glaser, R.: Klimageschichte Mitteleuropas: 1000 Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, Darmstadt 2001, S. 6ff.
[2] Vgl. ebenda, S. 49.
[3] Vgl. Jones, P. D. u. a.: High-resolution palaeoclimatic records for the last millennium: Integration, interpretation and comparison with general circulation model control run temperatures, in: Holocene, H. 8/1998, S. 456.
[4] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D.: Climate over past millennia, in: Reviews of Geophysics, Bd. 42, H. RG2002, 2004, S. 2.
[5] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 2.
[6] Ebenda, S. 2.
[7] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 20.
[8] Vgl. ebenda, S. 4.
[9] Vgl. Jones, P. D. u. a.: High-resolution…, a.a.O., S. 457.
[10] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 4.
[11] Vgl. Jones, P. D. u. a.: Surface air temperature and its changes over the past 150 years, in: Reviews of Geophysics, Bd. 37, H. 2/1999, S. 174.
[12] Vgl. Jones, P. D. u. a.: Surface air temperature…, a.a.O., S.175.
[13] Vgl. ebenda, S. 174.
[14] Vgl. ebenda, S. 174.
[15] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 3.
[16] Vgl. ebenda, S. 4.
[17] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 6.
[18] Vgl. Glaser, R., a.a.O., S. 21.
[19] Vgl. ebenda, S. 45.
[20] Vgl. Soon, W., S. u. a .: Reconstructing climatic and environmental changes of the past 1000 years: A reappraisal, in: Energy & Environment, H. 2-3/2003, S. 247.
[21] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 7.
[22] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 7.
[23] Vgl. ebenda, S. 6.
[24] Glaser, R., a.a.O., S. 15.
[25] Vgl. Huch, M. u. a. (Hrsg.): Klimazeugnisse der Erdgeschichte – Perspektiven für die Zukunft, Berlin 2001, S. 9.
[26] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 3.
[27] Vgl. Glaser, R., a.a.O., S. 22f.
[28] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 8.
[29] So beispielsweise in den Rekonstruktionen von Jones, P. D. u. a.: High-resolution…, a.a.O. und von Mann, M. E. u. a.: Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries, in: Nature, Bd. 392, 1998, S. 779–787.
[30] Für die Temperaturrekonstruktion wird fast ausschließlich auf Nadelbäume zurückgegriffen. Und tropische Baumarten eigenen sich – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht. Vgl. Jones, P. D. u. a.: High-resolution…, a.a.O., S. 457.
[31] Vgl. Jones, P. D. u. a.: High-resolution…, a.a.O., S. 457.
[32] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 8.
[33] Vgl. Esper, J. u. a.: Low-frequency signals in long tree-line chronologies for reconstructing past temperature variability, in: Science, Bd. 295, 2002, S. 2250.
[34] Ebenda, S. 2250.
[35] Vgl. ebenda, S. 2251.
[36] Vgl. Briffa, K. R. u. a.: Reduced sensitivity of recent tree-growth to temperature at high northern latitudes, in: Nature, Bd. 391, 1998, S. 680.
[37] Eine verringerte Bodenfeuchtigkeit während der Wachstumsphase im Sommer wird wiederum aufgrund der beobachteten wärmeren Frühlinge und damit einhergehender früherer Schneeschmelze für möglich gehalten. Vgl. Briffa, K. R. u. a, a.a.O., S. 681.
[38] Vgl. ebenda, S. 681.
[39] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 8.
[40] Jones, P. D. (Hrsg.): Climatic Variations and Forcing Mechanisms of the Last 2000 Years, NATO ASI Ser., Ser. I, Band 41, New York 1996, S. 367.
[41] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 8.
[42] Vgl. Huch, M. u. a. (Hrsg.), a.a.O., S. 35.
[43] Vgl. Jones, P. D. (Hrsg.), a.a.O., S. 355.
[44] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 9.
[45] Erst 1972 wurden die jährlichen Muster in Korallenskeletten entdeckt. Vgl. Jones, P. D. (Hrsg.), a.a.O., S. 355.
[46] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 9.
[47] Vgl. Jones, P. D. u. a.: High-resolution…, a.a.O., S. 457.
[48] Vgl. Crowley , T. J.: Causes of Climate Change over the Past 1000 Years, in: Science, Bd. 289, 2000, S. 271.
[49] Vgl. Huch, M. u. a. (Hrsg.), a.a.O., S. 35.
[50] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 9.
[51] Vgl. ebenda, S. 12.
[52] Vgl. ebenda, S. 10.
[53] Vgl. Polyak, V. J., und Asmerom, Y.: Late Holocene climate and cultural changes in the southwestern United States, in: Science, Bd. 294, 2001, S. 149.
[54] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 10.
[55] Vgl. ebenda, S. 10.
[56] Vgl. ebenda, S. 10.
[57] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 10.
[58] Vgl. ebenda, S. 10.
[59] Vgl. ebenda, S. 11.
[60] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 12.
[61] Vgl. ebenda, S. 12.
[62] Vgl. ebenda, S. 12.
[63] Vgl. Jones, P. D. u. a.: High-resolution…, a.a.O., S. 456.
[64] Hinzu kommt, dass die Südhalbkugel ohnehin weniger Landmasse hat und auf Land grundsätzlich mehr instrumentelle Messdaten erhoben werden bzw. wurden als auf Meeren. Die meisten Temperaturrekonstruktionen beziehen sich daher auch auf die Nordhalbkugel. Es wird aber davon ausgegangen (und vorläufige Temperaturrekonstruktionen für die Südhalbkugel erhärten diese Vermutung), dass die mittleren Temperaturen beider Hemisphären relativ ähnlich verlaufen. Aus den Temperaturrekonstruktionen der Nordhalbkugel werden daher auch Rückschlüsse auf den mittleren globalen Temperaturverlauf gezogen. Vgl. Jones, P. D. u. a.: High-resolution…, a.a.O., S. 457.
[65] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 8.
[66] Ein Vergleich identischer Zeitabschnitte zwischen zwei unterschiedlichen, aber nah beieinander liegender Klimaarchive kann jedoch auch Rückschlüsse auf die längerfristige Zuverlässigkeit der Klimaarchive ermöglichen. Vgl. Jones, P. D. u. a.: High-resolution…, a.a.O. S. 455.
[67] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 15 und Jones, P. D. u. a.: High-resolution…, a.a.O., S. 461.
[68] Allerdings ist diesbezüglich zu betonen, dass die seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts beobachtete nicht-Stationarität nach heutigen Erkenntnissen wohl durch global wirkende menschliche Einflüsse verursacht wurde. Ähnlich weit reichende menschliche Einflüsse hat es in den Jahrhunderten zuvor wahrscheinlich nicht gegeben. In der Wissenschaft wird aber der Einfluss von Landnutzungsänderungen als mögliche Ausnahme diskutiert. Vgl. hierzu Govindasamy, B. u. a.: Land use Changes and Northern Hemisphere Cooling, in: Geophysical Research Letters, Bd. 28, H. 2/2001, S. 291-294.
[69] Vgl. Soon, W., S. u. a ., a.a.O., S. 239.
[70] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 14 ff.
[71] Vgl. ebenda, S. 17.
[72] Vgl. Mann, M. E. u. a.: Global-scale…, a.a.O., S. 779 f.
[73] Vgl. Mann, M. E. u. a.: Northern Hemisphere Temperature During the Past Millennium: Inferences, Uncertainties, and Limitations, http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/millennium-camera.pdf, S. 6.
[74] Vgl. beispielsweise Crowley , T. J. und Lowery, T. S.: How warm was the Medieval Warm Period?, in: Ambio, H. 1/2000, S. 51-54, Esper, J. u. a., a.a.O. und Jones, P. D. u. a.: Surface air temperature…, a.a.O.
[75] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 16.
[76] Vgl. beispielsweise von Storch, H. u. a.: Reconstructing Past Climate from Noisy Data, in: Science, Bd. 306, 2004, S. 679.
[77] Vgl. ebenda, S. 679 ff.
[78] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 28 für einen Vergleich mehrerer Modellergebnisse mit der Rekonstruktion von Mann und Kollegen.
[79] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 28.
[80] Vgl. die grüne Kurve in Abbildung 4 der vorliegenden Arbeit.
[81] Vgl. Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O., S. 21.
[82] Einer dieser Artikel ist Soon, W., S. u. a ., a.a.O., den Soon und Baliunas mit drei weiteren Kollegen verfasst haben.
[83] Vgl. ebenda, S. 239 ff.
[84] Vgl. ebenda, S. 258 f.
[85] Vgl. Mann, M. E. u. a.: Global-scale…, a.a.O., S. 781.
[86] Vgl. Soon, W. S. u. a., a.a.O., S. 258.
[87] Vgl. Mann, M. E.: The value of multiple proxies, in: Science, Bd. 297, 2002, S. 1481.
[88] Unter anderem in Mann, M. E. und Jones, P. D., a.a.O.
[89] So die kürzlich veröffentlichte Studie von Osborn, T. J. und Briffa, K. R.: The Spatial Extent of 20th-Century Warmth in the Context of the Past 1200 Years, in: Science, Bd. 311, 2006, S. 841-844.
[90] Vgl. Soon, W. S. u. a., a.a.O., S. 236.
[91] Vgl. ebenda, S. 236.
[92] Vgl. ebenda, S. 270.
[93] Vgl. Illinger, P.: So viele Meilen bis Kyoto, in: Süddeutsche Zeitung v. 12.08.2003, http://w3g.gkss.de/staff/storch/CR-problem/SZ.030812.htm.
[94] Mann, M. E. u. a.: On past temperatures and anomalous late-20th century warmth, http://w3g.gkss.de/staff/storch/pdf/Soon.EosForum20032.pdf.
[95] Ebenda, S. 2, Hervorhebungen im Original.
[96] Vgl. ebenda, S. 2f.
[97] Vgl. ebenda, S. 2.
[98] Vgl. Mann, M. E. u. a .: On past temperatures…, a.a.O., S. 2.
[99] Vgl. ebenda, S. 1.
[100] Vgl. Illinger, P., a.a.O.
[101] Ursprünglich waren diese Hinweise in den Passagen zum Klimawandel nicht enthalten, auf Anordnung des Weißen Hauses aber wurden sie ergänzt. Zugleich wurde die zusammenfassende Aussage „Climate change has global consequences for human health and the environment“, gestrichen. Vgl. Harris, P.: Bush covers up climate research, in: The Observer, v. 21.09.2003, http://observer.co.uk/international/story/0,6903,1046363,00.html.
[102] Vgl. Illinger, P., a.a.O.
[103] Vgl. Pease, R.: Politics plays climate 'hockey', BBC News Science/Nature, veröffentlicht am 18.07.2005, http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4693855.stm.
[104] Ein Mitglied des Ausschusses und Abgeordneter der Demokraten, Henry Waxman, forderte anschließend Barton auf, die Briefe zurückzunehmen. Auch der Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses, Sherwood Boehlert, kritisierte das Vorgehen seines Kollegen und merkte an, dass Bartons Ausschuss keinerlei Verantwortung für den Bereich der Wissenschaft habe. Vgl. ebenda.
[105] Vgl. ebenda.
[106] Vgl. beispielsweise Mann, M. E. u. a.: On past temperatures…, a.a.O., S. 1.
[107] Vgl. von Storch, H. u. a., a.a.O., S. 679.
[108] Die Autoren ergänzen die Auflistung der Geldgeber mit dem Hinweis: „The views expressed herein are those of the authors and are independent of sponsoring agencies.“ Vgl. Soon, W. S. u. a., a.a.O., S. 271 f.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument zur Temperaturrekonstruktion?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Methoden, Erkenntnisse und Herausforderungen der Paläoklimatologie, insbesondere im Hinblick auf die Rekonstruktion des Temperaturverlaufs der letzten 1000 Jahre. Es werden die Datengrundlagen (instrumentelle Daten, historische Dokumente, natürliche Klimaarchive) sowie die Verfahren zur Temperaturrekonstruktion erläutert. Zudem werden die wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Diskussionen um die Ergebnisse dieser Rekonstruktionen beleuchtet.
Welche Datengrundlagen werden für die Temperaturrekonstruktion genutzt?
Es werden im Wesentlichen drei Arten von Datengrundlagen verwendet:
- Instrumentelle Daten: Temperaturmessungen mit Messinstrumenten (thermometers), die seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts flächendeckend vorliegen.
- Historische Dokumente: Aufzeichnungen über Wetterereignisse, Ernteerträge oder Vereisungsdaten.
- Natürliche Klimaarchive (Proxies): Indirekte Temperaturangaben aus natürlichen Quellen wie Baumringe, Korallen, Eisbohrkerne, Tropfsteine und Sedimentbohrkerne.
Was sind natürliche Klimaarchive (Proxies) und welche Beispiele gibt es?
Natürliche Klimaarchive sind natürliche Quellen, die indirekte Informationen über vergangene Klimabedingungen enthalten. Beispiele hierfür sind:
- Baumringe: Breite und Dichte der Jahresringe geben Auskunft über Temperatur und andere Umweltbedingungen.
- Korallen: Chemische Zusammensetzung der Korallenskelette ermöglicht Rückschlüsse auf die Wassertemperatur.
- Eisbohrkerne: Analyse von Sauerstoffisotopen und Gaseinschlüssen im Eis gibt Auskunft über Temperatur, Niederschlag und Zusammensetzung der Atmosphäre.
- Tropfsteine (Stalagmiten): Wachstumsmuster und isotopische Zusammensetzung können Hinweise auf vergangene Klimaschwankungen geben.
- Geschichtete Seen- und Meeressedimentbohrkerne: Ablagerungen von Pollen, Algen und Ton geben Auskunft über Vegetation und Temperatur.
Welche Verfahren werden zur Temperaturrekonstruktion verwendet?
Zur Temperaturrekonstruktion werden verschiedene Verfahren eingesetzt:
- Kalibrierung: Eichung der Daten aus Klimaarchiven mit instrumentell gemessenen Temperaturen, um eine entsprechende Temperatur zuzuordnen.
- Klimafeldrekonstruktion (Climate Field Reconstruction, CFR): Gleichzeitige Kalibrierung aller paläoklimatologischen Daten.
Was ist die vorherrschende Meinung in der Paläoklimatologie bezüglich der aktuellen Erwärmung?
Die Mehrheit der Klimaforscher geht davon aus, dass der Temperaturanstieg der letzten 30 Jahre und die heute erreichte absolute Temperaturhöhe in den vergangenen mindestens 1000 Jahren beispiellose Phänomene darstellen.
Welche Kritik gibt es an den Temperaturrekonstruktionen der Paläoklimatologie?
Einige Kritikpunkte an den Temperaturrekonstruktionen sind:
- Unterschätzung der Temperaturschwankungen: Kritiker vermuten, dass viele Klimaarchive, insbesondere Baumringe, das Ausmaß längerfristiger Temperaturschwankungen unterschätzen.
- Probleme mit Baumringchronologien: Es gibt Bedenken bezüglich der Zuverlässigkeit langfristiger Baumringchronologien und der Herausrechnung von Temperaturtrends.
- Unsicherheiten bei Klimaarchiven: Einige Wissenschaftler kritisieren die bestehenden Unsicherheiten der verschiedenen Klimaarchive und der verwendeten Verfahren zur Temperaturrekonstruktion.
Was ist die wissenschaftliche Diskussion um die Temperaturrekonstruktionen?
Die wissenschaftliche Diskussion dreht sich hauptsächlich um die Genauigkeit der Rekonstruktionen, insbesondere im Hinblick auf die Darstellung langfristiger Temperaturschwankungen und die Gewichtung verschiedener Klimaarchive. Kontroverse Diskussionen gab es um die Methodik und Interpretation von Studien, die die Außergewöhnlichkeit der aktuellen Erwärmung in Frage stellen.
Welche Rolle spielt die außerwissenschaftliche Diskussion um die Temperaturrekonstruktionen?
Die außerwissenschaftliche Diskussion wird oft von politischen und wirtschaftlichen Interessen beeinflusst. Einige Akteure nutzen die wissenschaftlichen Unsicherheiten, um die Bedeutung anthropogener Treibhausgasemissionen für das Klimasystem abzustreiten oder Klimaschutzmaßnahmen zu verzögern. Dies führt zu Versuchen, die Glaubwürdigkeit von Klimaforschern und des IPCC zu untergraben.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Dokuments?
Die wichtigsten Erkenntnisse sind:
- Die Temperaturrekonstruktion der vergangenen Jahrhunderte ist von hoher Bedeutung, um die aktuelle Klimaerwärmung im historischen Kontext zu bewerten.
- Die Paläoklimatologie stützt sich auf verschiedene Datengrundlagen und Rekonstruktionsverfahren, die jeweils ihre Stärken und Schwächen haben.
- Trotz bestehender Unsicherheiten deuten viele Studien darauf hin, dass die aktuelle Erwärmung beispiellos ist.
- Die wissenschaftliche Diskussion über die Genauigkeit der Temperaturrekonstruktionen ist wichtig, um die Grenzen des Wissens aufzuzeigen und die Forschung weiter voranzutreiben.
- Die außerwissenschaftliche Diskussion ist oft von politischen und wirtschaftlichen Interessen geprägt und kann die wissenschaftliche Evidenz verzerrt darstellen.
- Citar trabajo
- Sascha Samadi (Autor), 2006, Die Rekonstruktion des globalen Temperaturverlaufs der vergangenen 1000 Jahre - Methoden, Probleme, Erkenntnisse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110138