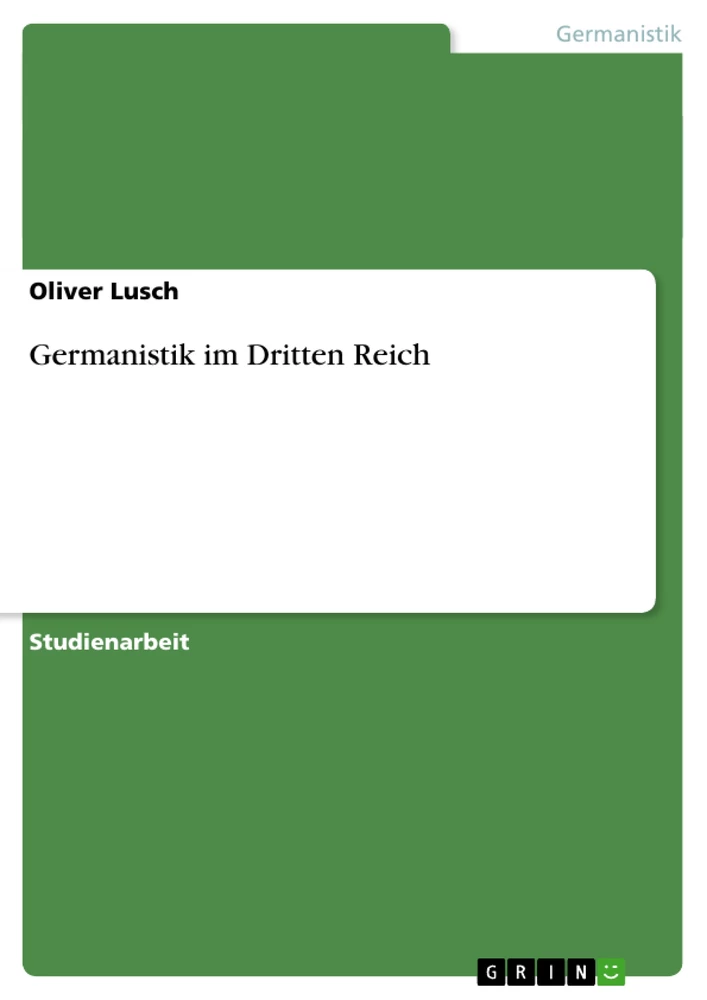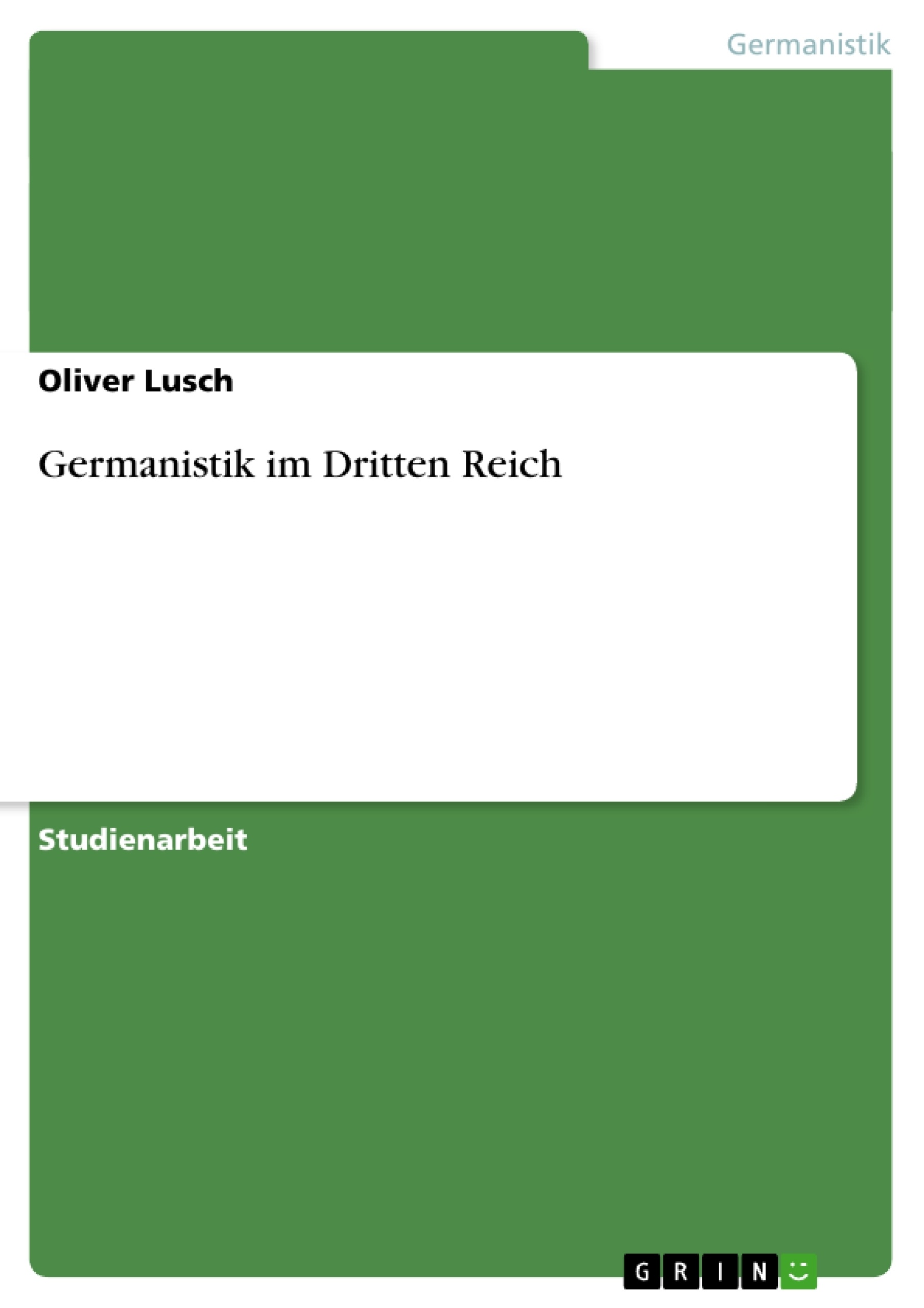Wie konnte es geschehen, dass eine Wissenschaft, deren Aufgabe es ist, die deutsche Sprache und Literatur zu erforschen und zu lehren, sich bereitwillig in den Dienst eines verbrecherischen Regimes stellte? Dieses Buch wirft ein erschütterndes Licht auf die Rolle der Germanistik im Dritten Reich. Es zeigt, wie bereitwillig sich führende Germanisten der nationalsozialistischen Ideologie anpassten, jüdische Kollegen aus dem Amt drängten und ihre Forschung in den Dienst der NS-Propaganda stellten. Anhand von konkreten Beispielen, wie den Bücherverbrennungen, der Verfolgung und Vertreibung jüdischer Gelehrter und der ideologischen Ausrichtung von Forschung und Lehre, wird die Verstrickung der Germanistik in das NS-System schonungslos offengelegt. Dabei werden nicht nur die großen Linien der Entwicklung nachgezeichnet, sondern auch Einzelschicksale von verfolgten und exilierten Wissenschaftlern beleuchtet, wie Agathe Lasch, Richard Alewyn und Walter Benjamin. Das Buch analysiert die Kontinuitäten und Brüche in der Germanistik vor, während und nach der NS-Zeit und untersucht, wie sich nationalsozialistische Denkmuster und Karrieren in der Nachkriegszeit fortsetzen konnten. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Germanischen Seminar der Berliner Universität, das als Spiegelbild der deutschen Germanistik im Dritten Reich dient. Es werden die Anpassungsleistungen der Professoren, die Auseinandersetzungen um Berufungen und die Beteiligung an propagandistischen Projekten wie dem "Kriegseinsatz der Germanistik" detailliert dargestellt. Das Buch zeigt, dass die Germanistik keineswegs ein unbeschriebenes Blatt war, sondern aktiv an der Durchsetzung der nationalsozialistischen Ideologie mitwirkte und eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit lange Zeit vermieden wurde. Es ist ein unerlässlicher Beitrag zur Aufarbeitung der deutschen Wissenschaftsgeschichte im Nationalsozialismus, der die komplexe und oft widersprüchliche Rolle der Germanistik in dieser dunklen Zeit beleuchtet und die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaftler aufwirft. Die Studie schließt mit einem Blick auf die Nachkriegszeit und die Kontinuitäten, die es ermöglichten, dass viele der während des Nationalsozialismus aktiven Professoren ihre Karrieren bruchlos fortsetzen konnten, während die Aufarbeitung der Vergangenheit lange auf sich warten ließ. Es ist eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für die deutsche Geschichte, die Wissenschaftsgeschichte und die Rolle der Intellektuellen im Nationalsozialismus interessieren. Schlüsselwörter: Germanistik, Drittes Reich, Nationalsozialismus, Wissenschaftsgeschichte, Berliner Universität, Exodus, Berufsverbot, Exil, Propaganda, Ideologie, Aufarbeitung, Kontinuität, Intellektuelle, Antisemitismus, Bücherverbrennung, Agathe Lasch, Richard Alewyn, Walter Benjamin, Julius Petersen, Forschung, Lehre.
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
1. Die deutsche Germanistik 1933
2. Berufsverbot und Exil
3. Das Berliner Germanische Seminar im Dritten Reich
4. Kriegseinsatz der Germanistik
Schluß
Bibliographie
Einleitung
Im folgenden soll das im Hauptseminar „Exodus von Wissenschaften aus Berlin“ vorgetragene Referat über „Germanistik im Dritten Reich“ in schriftlich ausgearbeiteter Form vorgelegt werden. Dabei wird es zunächst um die Ausgangssituation der Germanistik zu Beginn des Dritten Reichs und um das Verhalten ihrer Vertreter nach der Machtergreifung sowie um die Schicksale einzelner Wissenschaftler gehen, die von Berufsverbot und Vertreibung betroffen waren. Im dann folgenden Teil liegt der Fokus auf der Situation der Germanistik im NS-Regime, und hier v.a. auf der Lage in Berlin.
Die Literatur zum Thema ist relativ umfangreich, es bleibt aber festzustellen, daß nach wie vor Forschungsbedarf besteht, etwa was die Einzelschicksale exilierter Wissenschaftler angeht, - hier gibt es in der Forschungsliteratur teils sich widersprechende, teils ungenaue und insgesamt noch unvollständige Angaben -, oder auch die Situation an den einzelnen Universitäten in Deutschland. Mit der Geschichte der Germanistik an der Berliner Universität in der Zeit zwischen 1933 und 1945 haben sich seit den 80er Jahren zahlreiche Publikationen befaßt, einiges an Informationen, die in dieser Arbeit verarbeitet werden, stammt aus einer Vorlesung „Germanistische Literaturwissenschaft im Dritten Reich“ aus dem Sommersemester 2000 an der Humboldt-Universität[1].
1. Die deutsche Germanistik 1933
Auf Betreiben der Deutschen Studentenschaft, nicht etwa des NS-Studentenbundes, fand am 10. Mai 1933 in vielen deutschen Universitätsstädten die Bücherverbrennung – unter dem Motto „Wider den undeutschen Geist“ - statt. Germanisten taten sich hier als Brandredner hervor, u.a. Hans Naumann, Professor in Bonn, Gerhard Fricke, Privatdozent in Göttingen und Heiner Goebbels, promovierter Literaturwissenschaftler, in Berlin.
Um den Duktus und den Inhalt einer der Reden zu veranschaulichen, mit denen im Mai 1933 die Verbrennung der Bücher von Bertolt Brecht, Sigmund Freud, Kurt Tucholsky, Erich Maria Remarque, Erich Kästner, den Manns, Ődőn v. Horváth und vielen anderen eingeleitet wurde[2], sollen hier Auszüge aus der Ansprache von Hans Naumann, gehalten auf dem Bonner Marktplatz, dokumentiert werden:
„So verbrenne denn, akademische Jugend deutscher Nation, heute zur mitternächtigen Stunde an allen Universitäten des Reichs, – verbrenne, was du gewiß bisher nicht angebetet hast, aber was doch auch dich wie uns alle verführen konnte und bedrohte.
(...)
Wo Not an den Mann geht und Gefahr in Verzug ist, muß gehandelt werden ohne allzu großes Bedenken. Fliegt ein Buch heute Nacht zuviel ins Feuer, so schadet das nicht so sehr, wie wenn eines zu wenig in die Flammen flöge. Was gesund ist, steht schon von allein wieder auf.
(...)
Wir schütteln eine Fremdherrschaft ab, wir heben eine Besetzung auf. Von einer Besetzung des deutschen Geistes wollen wir uns befrein.
(...)
Manche unserer öffentlichen Leihbibliotheken enthielten einen Lesestoff, den meist erst die beiden letzten Jahrzehnte über uns ausgegossen haben und der in Weltanschauung und Sitte so schamlos auflösend und zersetzend war, daß wir uns bei der Durchsicht der Kataloge erschüttert fragten, wo blieben die Behörden, wo blieben die beiden Kirchen, wo blieb die innere Mission? Zu allermeist ist dies Schrifttum, das wir heute symbolisch vernichten wollen, fremdrassigen und fremdländischen Ursprungs gewesen, - aber vielleicht hat es bei uns mehr als im Ausland selber gewuchert, und es bildete - so gesehn - geradezu eine Fortsetzung des Krieges gegen Deutschland, nur jetzt mit anderen, feineren und verruchteren Mitteln und an noch verwundbareren Stellen. Wie immer, so war auch hier der internationale vaterlandslose Geselle besonders an diesem Krieg gegen Deutschland beteiligt.
(...)
Wir wollen ein Schrifttum, dem Familie und Heimat, Volk und Blut, das ganze Dasein der frommen Bindungen wieder heilig ist. Das uns zum sozialen Gefühl und zum Gemeinschaftsleben erzieht, sei es in der Sippe, sei es im Beruf, sei es in der Gefolgschaft oder in Stamm und Nation. Das zum Staat erzieht und zum Führertum und zur Wehrhaftigkeit, ein Schrifttum das also im besten und edelsten Sinne politisch ist.
(...)
Heil denn also dem neuen deutschen Schrifttum! Heil dem obersten Führer! Heil Deutschland!“[3]
Durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten und die verschiedenen Gesetze und Verordnungen, die zur Entlassung von Juden und politisch unliebsamen Personen führten, waren unter den Ordinarien der Germanistik nur wenige betroffen.
Die Vertreter der Germanistik unter den Hochschullehrern verstanden sich zum Großteil als Repräsentanten einer „Nationalphilologie“, einer „Deutschkunde“/“Deutschwissen-schaft“[4] als nationaler Leitwissenschaft und waren politisch meist konservativ bis autoritär ausgerichtet, standen der Weimarer Republik ohnehin skeptisch bis ablehnend gegenüber und bevorzugten „eine staatlich garantierte hierarchische Gesellschaftsordnung“[5]. Die akademischen Hauptströmungen der Germanistik waren geistesgeschichtliche und philologische Methoden, die sich, wenn nicht sogar direkt in die nationalsozialistische Ideologie einpassen konnten, doch nicht im Widerspruch zu ihr standen, so daß die Professoren ihre Vorlesungen wie vor 1933 weiterhalten konnten, also von einer Kontinuität des universitären Wissenschaftsbetriebs gesprochen werden kann.
Auch stammeskundliche Konzepte und andere reaktionäre Richtungen waren schon vor 1933 virulent, und latente antisemitische Ressentiments gab es auch in der Berliner Germanistik.[6]
Die Gleichschaltung durch das NS-Regime war also unter den Vertretern dieses Faches nicht wirklich vonnöten, die Germanisten schalteten sich selbst gleich bzw. es bedurfte keiner obrigkeitlichen Maßnahmen, etwa den Berufsverband den neuen Machthabern gefügig zu machen.
Die erste Kontaktaufnahme zwischen dem 1920 in „Gesellschaft für deutsche Bildung“ (GfdB)[7] umbenannten Germanistenverband und der NS-Regierung fand bereits in den ersten Februartagen 1933 statt. Auf einer Tagung des Hochschulausschusses der GfdB, die einberufen wurde, „um keine Zeit zu verlieren, den fruchtbaren Augenblick zu versäumen“[8], nahmen u.a. Friedrich Panzer, Friedrich Neumann und Karl Viëtor teil. Den endgültigen Anschluß an die Partei vollzog die GfdB am 1. und 2. April 1933, wo im Rahmen einer „Kulturpolitischen Aussprache“ zwischen Vertretern der GfdB und der NSDAP eine weitgehende Einmütigkeit festgestellt wurde. Kurz darauf stieg Friedrich Neumann zum neuen Vorsitzenden der GfdB auf, der allen Mitgliedern dieser Gesellschaft riet, sich unverzüglich zur Regierung zu bekennen und sich zu einem radikalen Handeln im Sinne der völkischen Idee zu entscheiden. Er war es, der als neuer Rektor der Göttinger Universität zum Boykott der von den Nationalsozialisten auf den Index gesetzten Bücher aufrief, worauf sein neugermanistischer Kollege Gerhard Fricke die Brandrede hielt.
Neumann verfaßte auch den Aufruf zur Reichstagswahl und zum Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund, der Anfang November 1933 in der Broschüre Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat erschien.[9]
2. Berufsverbot und Exil
Betroffen von Berufsverbot und Exil waren v.a. jüdische Germanisten, die vor 1933 an einer Habilitation bzw. an einer ordentlichen Professur gehindert worden waren, z.T. aber auch solche, die es unter den widrigen Umständen, die auch schon vor 1933 für Juden sowie linke, liberale und weibliche Fachvertreter galten, bis zu einem Ordinariat gebracht hatten.
Für das Fach Germanistik liegt noch keine vollständige Bilanz der Auswirkungen dieser Maßnahmen vor. Horst Möller spricht im Bereich der Germanistik von 56 Hochschullehrern, die nach 1933 emigrierten[10], wobei hier diejenigen außenvorgelassen werden, denen der Weg ins Exil versperrt war. Nahezu alle dieser Germanisten waren aus rassischen Gründen Vertriebene und aus dem Dienst Entlassene, betroffen vom „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ (1933) oder den „Nürnberger Gesetzen“ (1935)[11]. Betroffen waren u.a.:
Richard Alewyn (außerordentlicher Professor, 1933 entlassen), Walter A. Berendsohn (wissenschaftlicher Hilfsarbeiter mit Professorentitel, 1933 entlassen), Walther Brecht (ordentlicher Professor, 1937 entlassen), Melitta Gerhard (Privatdozentin, 1933 entlassen)[12], Paul Hankamer (ordentlicher Professor, 1936 entlassen), Max Herrmann (persönliches Ordinariat, 1933 entlassen), Agathe Lasch (außerordentliche Professorin, 1934 entlassen), Wolfgang Liepe (ordentlicher Professor, 1936 zwangsversetzt, dann entpflichtet), Werner Richter (ordentlicher Professor, 1933 entlassen), Richard Samuel (Assistent, 1933 entlassen), Georg Stefansky (Privatdozent, 1933 entlassen), Carl Wesle (ordentlicher Professor, 1934 versetzt)[13].
Im folgenden sollen einige der Einzelschicksale näher beschrieben werden:
Agathe Lasch wurde 1879 in Berlin geboren, war nach ihrem Abitur 1906 und ihrem Studium in Halle und Heidelberg u.a. Privatlehrerin, wurde 1909 mit einer Dissertation über die mittelniederdeutsche Schriftsprache von Berlin zum Dr. phil. promoviert, war Dozentin für Deutsch am Bryn Mawr College in Philadelphia und kehrte 1917 nach Deutschland zurück. Sie habilitierte in Hamburg und wurde dort zur außerordentlichen Professorin für niederdeutsche Philologie ernannt, damit war sie die erste Professorin an der Hamburger Universität. 1934 erfolgte ihre Zwangspensionierung, 1942 wurde sie deportiert, woraufhin ihr weiteres Schicksal ungewiß blieb. Vermutlich ist sie im selben Jahr im KZ Theresienstadt umgekommen.[14]
Richard Alewyn (1902-1979) studierte in Frankfurt/Main, Marburg, München und Heidelberg, promovierte 1925 und habilitierte 1931 in Berlin. Alewyn war ein Schüler Gundolfs und seit 1932 dessen Nachfolger an der Universität Heidelberg, als außerordentlicher Professor[15]. 1933 wurde er entlassen, emigrierte nach Frankreich und war Gastprofessor an der Sorbonne, bevor er in den Jahren 1935 bis 1938 im österreichischen und 1938 im schweizerischen Exil lebte und 1939 in die USA emigrierte. Hier bewarb er sich erfolglos an verschiedenen Universitäten, um schließlich Associate Professor am Queens College in New York zu werden.
Nach dem Krieg kehrte er nach Deutschland zurück: zunächst erhielt er eine Gastprofessur an der Universität Köln, 1949 ebendort eine ordentliche Professur, als Nachfolger Ernst Bertrams, der infolge der Entnazifizierung entlassen worden war, und führte bis 1955 das Germanistische Institut als Direktor. Von 1955 bis 1959 war Richard Alewyn ordentlicher Professor und Direktor des Germanischen Seminars an der FU Berlin, von 1959-1967 lehrte er an der Universität Bonn, auch hier war er Direktor des Seminars. Gastprofessuren führten ihn an zahlreiche amerikanische Universitäten.
Für Alewyn war das Exil in den USA nicht nur deshalb eine schwere Zeit, weil er sich wie viele andere Emigranten – von wenigen Ausnahmen wie Viëtor abgesehen – dort mit einer beruflichen Stellung unterhalb seines Niveaus abfinden mußte und keinen Anschluß an die amerikanische Germanistik fand. Er fungierte am College als Sprachlehrer statt als Gelehrter, und das amerikanische Universitätssystem erschien ihm allzu demokratisch und unhierarchisch, was ihm, dem sehr konservativ geprägten Professor, widerstrebte.
Vom 8.7.1933 ist von ihm folgendes Zitat überliefert: „So habe ich mich nie als etwas anderes als als arischer Deutscher gefühlt und kann auch nicht aufhören das zu tun, ohne mich selbst aufzugeben“[16]. Ebenso bizarr erscheint die Tatsache, daß er sich bei Ausbruch des 2. Weltkrieges auf dem deutschen Konsulat in New York zum Kriegsdienst meldet, wo er als Jude natürlich abgelehnt wird.[17]
Walter Benjamin, geboren 1892 in Berlin, studierte ab 1912 Germanistik und Kunstgeschichte in Freiburg i. B., Berlin, München und Bern und promovierte 1919 in Bern über den „Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik“. 1925 wird seine Habilitationsschrift über das deutsche Barock-Trauerspiel von der Universität Frankfurt/Main abgelehnt, nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern u.a. weil Benjamins unkonventionelle Lebens- und Arbeitsweise mit den Normen der akademischen Institution nicht vereinbar seien. 1933 emigrierte Benjamin nach Paris und entschloß sich 1940 nach der Besetzung Frankreichs und kurzzeitiger Internierung, in die USA zu emigrieren. Er versuchte, über Spanien aus Frankreich zu fliehen, wartete an der Grenze aber vergeblich auf sein Visum. Angesichts der drohenden Auslieferung an die Gestapo nahm sich Walter Benjamin mit einer Überdosis Morphium in dem spanischen Grenzort Port Bou das Leben. Wie Georg Lukács war Walter Benjamin Vertreter einer marxistischen Literaturtheorie. Die Verhinderung seiner Universitätskarriere ist ein Beispiel dafür, wie auch vor 1933 nicht nur jüdische, sondern auch linke Wissenschaftler, deren Methoden sich nicht in die Hauptströmungen der Zeit einpaßten, an einer Hochschullaufbahn gehindert wurden.[18] Käte Hamburger wiederum ist ein Beispiel für Wissenschaftlerinnen, denen sowohl aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Judentum als auch aufgrund ihres Geschlechts die Habilitation verwehrt wurde. Sie wurde 1896 in Hamburg geboren und verstarb 1992. Nach ihrem Abitur am Johanneum studierte sie ab 1917 in Berlin, ab 1918 in München Kunstgeschichte, Geschichte, Literaturgeschichte und Philosophie. 1922 erfolgte ihre philosophische Promotion über Schiller. Sie ging 1934 ins Exil nach Göteborg, kehrte aber nach dem Krieg nach Deutschland zurück, wo sie sich 1957 in Stuttgart habilitierte und dort bis 1976, mit Unterbrechung einer Gastprofessur am Middlebury College (Vermont), als außerplanmäßige Professorin lehrte – eine ordentliche Professur wurde ihr aus Altersgründen verwehrt.[19] Wegen ihrer Ehe mit einer Jüdin von Berufsverbot bzw. Exil betroffen waren u.a. Friedrich von der Leyen und Karl Viëtor. Friedrich v.d. Leyen studierte in Marburg, Leipzig, Berlin und München und promovierte 1894 in Berlin. Ab 1899 war er Privatdozent in München, ab 1908 außerordentlicher Professor. Gastprofessuren führten ihn 1913/14 an die Yale University, 1919 und 1932 nach Stanford sowie 1931/32 und 1936 an die Harvard University. Von 1921-1937 fungierte er als ordentlicher Professor und Direktor des Germanischen Seminars an der Universität Köln. V.d. Leyen wurde 1937 wegen der jüdischen Abstammung seiner Frau vorzeitig emeritiert, nach dem Krieg lehrte er an den Universitäten Köln (1946, als Honorarprofessor) und München (1947-1953).
Karl Viëtor studierte in Genf, München und Berlin und promovierte 1919 bei Julius Petersen zum Dr. phil. 1922 folgte die Habilitation und 1925 eine ordentliche Professur an der Gießener Universität.
Als Herausgeber der deutschwissenschaftlich orientierten Zeitschrift für Deutschkunde begrüßte Viëtor die Machtergreifung; in einem Aufsatz mit dem Titel: Die Wissenschaft vom deutschen Menschen in dieser Zeit stellte er 1933 als Jahr des deutschen Aufbruchs dar[20]. 1937 aber mußte er wegen seiner jüdischen Frau emigrieren und wurde Kuno Francke-Professor of German Art and Culture an der Harvard University.[21]
Mit Eduard Berend (1883-1973) soll auf die nähere Betrachtung der Situation am Berliner Germanischen Seminar übergeleitet werden. Berend studierte in München und Berlin, promovierte 1907 mit einer Dissertation über Jean Paul. Seine Habilitation wurde abgewiesen, er wollte sich nicht taufen lassen, um habilitieren zu dürfen. Von 1927 bis 1938 hatte er einen Werkvertrag mit der Preußischen Akademie der Wissenschaften über die Herausgabe der Jean-Paul-Ausgabe, seit 1935 zusätzlich einen von Julius Petersen (1920-1941 Ordinarius in Berlin) vermittelten Vertrag über die Mitarbeit an einer neuen Folge von Goedekers Grundriß der deutschen Dichtung.
Beide Verträge wurden 1938 gelöst. Im November 1938 wurde Eduard Berend ins KZ Sachsenhausen deportiert, nach wenigen Wochen aber wieder entlassen, Ende 1939 dann gelang ihm die Flucht in die Schweiz.
Im Juli 1948 beauftragte ihn die neugegründete Deutsche Akademie der Wissenschaften mit der Fortsetzung der Jean-Paul-Edition, 1957 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft wiederzuerkannt und der Professorentitel des Landes Baden-Württemberg verliehen. Er zog nach Marbach am Neckar um, 1963 erhielt Berend die Ehrendoktorwürde der FU Berlin.
Zu Berend, der erst relativ spät vom Berufsverbot betroffen war, ist zu sagen, daß er durch seinen niederen Status einen gewissen Schutz genoß. Er blieb vom Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums verschont, da er nur einen Werkvertrag hatte. Von 1934 an fehlte sein Name auf den Titelblättern der neu erscheinenden Bände der Edition und war nur noch dem Herausgebervorwort zu entnehmen, später selbst dies nicht mehr.[22]
Von den Germanisten am Berliner Seminar wurden folgende Personen entlassen, alle wegen ihrer jüdischen Herkunft: Werner Richter, der ins Exil ging, Richard Samuel, ein Schüler Petersens, Promovend und seit 1930 Assistent. Er ging ins Exil nach Großbritannien und stand in Verbindung mit dem Widerstand um Bonhoeffer und Niemöller.[23]
Max Herrmann ließ sich beurlauben, er wollte nicht lehren, solange die NS-Studenten-Thesen an der Friedrich-Wilhelms-Universität aushingen. Er wurde nicht offiziell beurlaubt sondern pensioniert, obwohl er seines Alters wegen hätte emeritiert werden müssen und starb 1942 im KZ Theresienstadt.[24]
3. Das Berliner Germanische Seminar im Dritten Reich
Für einen besseren Überblick sollen hier die Ordinarien am Germanischen Seminar der Berliner Universität in der Zeit von 1933-1945 in einer tabellarischen Übersicht aufgelistet werden:
Abteilung für ältere deutsche Literatur und Sprache:
Arthur Hübner 1927-1937
Julius Schwietering 1938-1945 (1946-1952 U Frankfurt/Main)
Abteilung für neuere deutsche Literatur:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Altgermanisch-nordische Abteilung:
Gustav Neckel 1920-1935, 1937-1940
Hans Kuhn 1941-1945
Abteilung für niederdeutsche Philologie:
Gerhard Cordes 1943-1945
Theaterwissenschaft:
Max Hermann (siehe Neuere deutsche Lit.)
Julius Petersen ( „ „ )
Hans Knudsen 1944-1945 außerordentlicher Professor
Soweit nicht anders angegeben: Ordinarien[25].
Die 1933 nicht von Berufsverbot und Vertreibung betroffenen Professoren der Berliner Universität verhielten sich bei der Machtergreifung wie die übrige deutsche Germanistik: sie ließen sich gleichschalten und legten z.T. einen beachtliches Ausmaß an vorauseilendem Gehorsam an den Tag.
Julius Petersen, von Februar bis August 1933 gerade zu Gastvorlesungen zu Besuch in den USA, begrüßte die Geschehnisse in Deutschland und beeilte sich noch im Ausland, den Nachweis für seine arische Abstammung zu erbringen.
Er wirkte mit bei der Umprofilierung der Zeitschrift Euphorion, deren Mitherausgeber er 1934 in Ablösung des jüdischen Herausgebers Stefansky wurde, und die in Dichtung und Volkstum umbenannt wurde. Der Berliner Ordinarius veröffentlichte hier u.a. einen Aufsatz mit dem aufschlußreichen Titel: Die Sehnsucht nach dem Dritten Reich in deutscher Sage und Dichtung (1934)[26].
In seiner Habilitationsschrift rechnete Hans Pyritz, Petersens Nachfolger ab 1942, im Vorwort mit dem Hinweis auf einen Juden als Herausgeber kritisch mit der Erstausgabe der Briefe zwischen Goethe und Marianne ab. 1946 erschien die dritte – nach Pyritz’ Aussagen im wesentlich unveränderte – Auflage seiner Arbeit, ebenso wie er Vorlesungen beispielsweise über die Romantik vor und nach 1945 im wesentlichen unverändert abhielt: lediglich die rassistischen Passagen mußten getilgt werden. Versatzstücke aus dem NS-Jargon wie „völkisch“ für „deutsch“, „Schrifttum“ für „Literatur“ oder auch „Deutschwissenschaft“ für „Germanistik“ ließen sich hier wie in vielen germanistischen Arbeiten problemlos einfügen, Vor- und Nachworte ließen sich bei Bedarf wieder tilgen.
Nach diesem Muster erwies auch Arthur Hübner, Professor für ältere Literatur, den Machthabern z.B. in seiner Schrift Goethe und das deutsche Mittelalter [27] seine Reverenz. Während der Hauptteil als eine solide durchgeführte Analyse über Goethe, das Mittelalter und Romantikkritik betrachtet werden kann, waren mindestens Einleitung und/oder Schluß in vielen Arbeiten dieser Zeit von Sympathiebekundungen an das Regime gekennzeichnet.[28]
Arthur Hübner, der bei der Machtergreifung gemeinsam mit Julius Petersen Direktor des Germanischen Seminars war, gehörte auch zu den 300 deutschen Hochschullehrern, die 1933 zur Wahl der NSDAP aufriefen.
Insgesamt waren viele Germanisten durch unterschiedliche Hilfsdienste, Zuarbeiten, durch Vortragstätigkeiten, Publikationsaufträge etc. in das NS-Regime eingebunden. Wie nah die Berliner Professoren dem Staat standen, zeigt auch deren Tätigkeit als „Rosenberg-Lektoren“, als Lektoren also des Amtes Rosenberg und dessen Zeitschrift Bücherkunde.
Auseinandersetzungen zwischen dem Seminar und staatlichen Stellen gab es nur insofern, als sich die Fakultätsmitglieder zuweilen etwa gegen Neuberufungen wanden, wenn der Vorgeschlagene ihren wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügte. Auf Max Herrmanns Stelle am Seminar folgte zunächst Gerhard Fricke, der in Göttingen die Rede zur Bücherverbrennung gehalten hatte, kurze Zeit später aber nach Kiel ging. Ihm sollte ein vom Erziehungsminister vorgeschlagener Freund Hitlers und NSDAP-Mitglied seit 1922 folgen: Heinrich Kräger.
Hier reagierte die Philosophische Fakultät aber ablehnend, man attestierte Kräger Unwissenschaftlichkeit und Mißerfolge in der akademischen Lehre und kritisierte sein hohes Alter.[29]
Petersen schlug dann 1. Franz Koch (Wien), 2. Böckmann (Hamburg) und 3. Benno v. Wiese[30] (Erlangen) vor, woraufhin
1935 Koch berufen wurde und die Auseinandersetzung zwischen Fakultät und Ministerium somit beigelegt war. Mit Koch war zudem auch ein ausgewiesener NS-Sympathisant nach Berlin berufen worden, „dessen Arbeiten in weitem Maße für die forcierte Durchsetzung eines ausgeprägt völkischen und rassenbiologisch orientierten Germanistikkonzepts symptomatisch waren“[31] und der in seinen Lehrveranstaltungen häufig „volkhafte“ Autoren der Gegenwart wie Erwin Guido Kolbenheyer behandelte, deren Literatur er einem „Verfallsschrifttum“, als dessen Vertreter er u.a. Thomas Mann ansah, gegenüberstellte.[32]
Anläßlich der 50-Jahr-Feier des Germanischen Seminars kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Petersen und dem NSDAP-Mitglied Koch. Letzterer warf seinen Kollegen und explizit Petersen eine Tendenz vor, „konsequente Nationalsozialisten ,wissenschaftlich sozusagen über die Achsel anzusehen'“, und „das, was die Führung des Dritten Reiches anstrebt, [...] [zu] sabotieren“[33], nachdem er herausgefunden hatte, daß noch bis ins Jahr 1938 einzelne jüdische Wissenschaftler wie Eduard Berend freiberuflich an von Petersen geleiteten Editionen beteiligt waren.
Julius Petersen indes verwies schuldbewußt auf die bevorstehende Kündigung der jüdischen Wissenschaftler und übertrug die Leitung der Jean-Paul-Ausgabe an Franz Koch.[34]
Eine Auseinandersetzung, die ebenfalls auf wissenschaftliche Divergenzen zurückzuführen war, hatte es schon 1934 im Seminar gegeben. In diesem Jahr gab der spätere SS-Mann Herman Wirth die Ura-Linda-Chronik heraus, die schon im 19. Jh. als Fälschung entlarvt worden war. Wirth hingegen bestand darauf, daß sie eine echte Chronik über die Geschichte des friesischen Volkes sei.
Arthur Hübner und Gustav Neckel (Ordinarius für nordische Philologie) hatten daraufhin eine Auseinandersetzung mit Wirth, der im Völkischen Beobachter Hübner als NS-Gegner bezeichnete. Hübner schien offenbar Fakten nicht ideologischer Vereinnahmung opfern zu wollen, vertrat sozusagen den traditionellen Gelehrtentypus, während Wirth als Typus des Dilettanten bezeichnet werden kann, der nach 1933 zu wissenschaftlichen Erfolgen gelangen konnte. 1937 war er an der Gründung des SS-Ahnenerbes beteiligt[35].
Festzuhalten ist, daß die Polemik gegen Wirth nur der Methode galt. Arthur Hübner war bekannt mit Rosenberg, dem ideologischen Gegner Himmlers, und fungierte als Hauptlektor im „Amt für Schrifttumspflege“ unter Rosenberg, erwies dem System also mindestens ebenso seinen Dienst wie Herman Wirth.
Werner Herden stellt dazu fest: „Die geltend gemachten Besorgnisse galten [...] nicht den politischen Ordnungsvorstellungen des neuen Regimes, wohl aber einem befürchteten oder schon erkennbaren Eindringen zweifelhafter Einflüsse in die Regionen der Philologie“[36].
Trotz der Ergebenheitsadressen an das System und der Tatsache, daß die Universitätsgermanistik ohnehin eine der Weimarer Republik ablehnend gegenüberstehende Grundausrichtung einte, beklagten sich offizielle Seiten über die unbefriedigende NS-Orientierung der Germanisten. Ein NS-Gutachten über „Lage und Aufgabe der Germanistik und deutschen Literaturwissenschaft“, vermutlich 1938/39 von Hans Rößner, der zeitweise Assistent bei Prof. Obenauer in Bonn war, für den Sicherheitsdienst der SS erstellt, moniert,
„daß gerade auf dem kulturpolitisch lebenswichtigen Gebiet der Germanistik noch ein ausgesprochen liberaler Wissenschaftsbetrieb herrscht, in dem eine Menge von gegnerischen oder zumindest reaktionären und liberalen Kräften noch am Werk ist“[37].
Und noch 1942 beklagte sich ein Fachvertreter, daß „[n]ur ganz vereinzelt [...] sich bislang literaturwissenschaftliche Untersuchungen rassekundlichen Themen zugewandt“ hätten[38].
Daß die alles andere als oppositionelle Ausrichtung der Germanistikprofessoren offiziellen Stellen nicht ausreichte, zeigt auch ein Memorandum des Amtes Rosenberg vom März 1941, in dem beklagt wird, daß auf „dem Gebiet der Germanistik an den deutschen Universitäten eine Reihe von Hochschullehrern tätig [ist], gegen die in weltanschaulicher Beziehung erhebliche Bedenken zu erheben sind“ und in dem selbst NSDAP-Mitglieder wie Gerhard Fricke, Hans Naumann oder Franz Koch „nicht als ausgesprochen nationalsozialistische Wissenschaftler“ angesehen werden[39].
Daß trotz dem im Dritten Reich so zentralen Führermythos aber keineswegs von einer kohärenten Linie der Nationalsozialisten in bezug auf die Germanistik gesprochen werden kann, und die in der Forschungsliteratur häufig konstatierte Polykratie im Nationalsozialismus auch hier zum Tragen kam, zeigt u.a. die Tatsache, daß verschiedene Behörden oder Parteiorganisationen oft zu völlig unterschiedlichen Bewertungen kamen, z.B. was die Einschätzung der politischen Zuverlässigkeit von Germanisten betraf. „In den permanenten Machtkampf waren mindestens vier Instanzen verwickelt, in denen selbst wiederum zum Teil heftige Auseinandersetzungen tobten“. Im einzelnen nennt Dainat u.a. das Amt Rosenberg, das SS-Ahnenerbe, die „Parteiamtliche Prüfungskommission“, die Parteikanzlei, den NSD-Dozentenbund sowie die Gestapo.[40]
Bei Berufungsverfahren dominierten von 1933 bis 1936/37 politische Kriterien, was sich aber als eher erfolglos im Sinne der Nationalsozialisten erwies, da viele dieser Berufenen sich als wissenschaftlich unfähig erwiesen (s.o.) oder durch Tod oder Krankheit vorzeitig ausschieden.
Ab 1938 erfolgte eine Umorientierung in der Berufungspolitik, die auch zu Berufungen von zuvor aus politischen Gründen abgelehnten Wissenschaftlern wie Max Kommerell oder Walter Rehm führten. Diese Tendenz läßt sich durch den Mangel an akademischem Nachwuchs und einem stärkeren Interesse an „funktionierenden – statt politisierten – Universitäten“[41] erklären.
Bei den Publikationsmöglichkeiten gab es etwas weichere Zugangskriterien, so daß z.B. noch 1935 ein Artikel von Richard Alewyn in der Zeitschrift für deutsche Bildung erscheinen konnte, wobei hier auch die internationale Reputation eine größere Rolle spielte: „Ins Ausland gesandte Germanisten sollten sich mit ideologischen Begriffen zurückhalten“ und eher die Klassiker behandeln.[42]
4. Kriegseinsatz der Germanistik
Die Vergabe kriegswichtiger Themen für Promotionen und Habilitationen an natur- und technikwissenschaftlichen Fakultäten wurde auch auf die Geisteswissenschaften übertragen, zuständig hierfür war der „Beauftragte des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP“, Alfred Rosenberg, der auch zum Reichskommissar für geistige Kriegsführung ernannt werden sollte, zu dieser Ernennung kam es indes nicht mehr.
Kurz vor Beginn der Westoffensive der deutschen Wehrmacht, im Frühjahr 1940, rief der Kieler Universitätsrektor, der Jurist Paul Ritterbusch, im Auftrag des Reichsministeriums für Erziehung, Wissenschaft und Volksbildung alle deutschen Geisteswissenschaftler auf, sich an einem ,Gemeinschaftswerk’ zu beteiligen, das schon bald auch als ,Kriegseinsatz’ bzw. ,Aktion Ritterbusch’ bezeichnet wurde. Dieser ,Kriegseinsatz’ sollte „von der Überlegenheit der deutschen Geisteswissenschaften im Nationalsozialismus Zeugnis ablegen und einen kriegsentscheidenden Beitrag im ideologischen Kampf gegen die Westmächte leisten.“[43]
Trotz dieser eindeutigen Charakterisierung waren alle Professoren mit wenigen Ausnahmen, - Friedrich Beißner, Max Kommerell, Walter Rehm -, zur Teilnahme bereit und lieferten pünktlich ihre Beiträge, soweit sie nicht woanders „mit der Waffe in der Hand von deutscher Art Zeugenschaft“ ablegten, wie sich Koch im Vorwort des schließlich fünfbändigen Werks Von deutscher Art in Sprache und Dichtung ausdrückte, das rund 50 Einzelbeiträge umfaßte.[44]
Das Sammelwerk verstand sich als „Beitrag zum Selbstfindungsstreben unseres Volkes und entwirft ein Bild von deutscher Art im Spiegel der deutschen Sprach- und Dichtungsgeschichte“. Wie Koch fortführt, sei bei den Germanisten, denen er unter den Geisteswissenschaftlern eine zentrale Rolle beimaß, der Frage nachgegangen worden, „was denn diese unsre deutsche Art ist und bedeutet, was es, geistig-seelisch gesehen, heißt, ein Deutscher zu sein“[45].
Daß es auch möglich war, sich diesem Projekt ohne Repressionen zu entziehen, bewiesen die Professoren Walter Rehm (Gießen und Freiburg) und Max Kommerell (Marburg), der 1937 schrieb: „Es ist jetzt sehr schwer, eine große anerkannte Position mit unverbogener Produktivität zu vereinigen. Und wenn es um diese Alternative geht, lebe ich lieber unscheinbar und leise“[46].
Schluß
Ein Exodus aus Berlin und Deutschland erfolgte bei den Germanisten in geringerem Ausmaß als bei vielen anderen Wissenschaften und Berufsgruppen, da das Fach schon vor der Machtergreifung eine ausgesprochen konservative Ausrichtung repräsentierte, die die später von der Verfolgung Betroffenen am Aufstieg in der Hierarchie hinderte.
Die Gleichschaltung der universitären Germanistik erwies sich somit als problemlos im Sinne der Nationalsozialisten.
Es gab jedoch kein kohärentes „Wissenschaftsprogramm“, das planmäßig durchgeführt worden wäre. Trotz der Berufung von Fachvertretern wie Franz Koch auf Lehrstühle rückte keines der von den Nationalsozialisten besonders bevorzugten Forschungsfelder (Vor- u. Frühgeschichte, Volkskunde, Blut-und-Boden-Literatur, Auslandsdeutschtum) ins Zentrum des Faches.
So wie von einer stark ausgeprägten Kontinuität des germanistischen Wissenschaftsbetriebes im Dritten Reich gesprochen werden kann, prägten Methoden, die vor 1933 ausgearbeitet waren, auch nach 1945 die bundesdeutschen Universitäten.
Neue Strömungen wie Psychoanalyse oder Marxismus wurden vor 1933 ebenso abgelehnt, wie internationale Entwicklungen nach dem Krieg lange ignoriert wurden.[47] Diese Kontinuität in der westdeutschen Germanistik war auch ein Grund dafür, daß kaum Emigranten als Professoren zurückkehrten.
Dagegen konnten die meisten Professoren, die auch im Nationalsozialismus in Amt und Würden waren, ihre Karriere fortsetzen. Nur wenn ihre Eingebundenheit in das NS-Regime allzu offensichtlich war, kam es bei einzelnen Professoren wie etwa Franz Koch oder Gerhard Fricke zu Problemen, gleich nach Kriegsende wieder ein Ordinariat zu erhalten. Nur wenige Ordinarien kehrten wegen Belastung nicht in den Universitätsdienst zurück (Hermann Pongs, Göttingen; Josef Nadler, Wien)[48].
In der DDR gab es zwar mehr Entlassungen als in der BRD, eine Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit erfolgte indes in Westdeutschland seit dem Germanistentag 1966 und somit früher als in den meisten anderen Disziplinen, in der DDR dagegen erst Seit Anfang der 80er Jahre.[49]
Zahlreiche Publikationen zur Problematik haben seitdem einen Beitrag zur Aufarbeitung der Rolle der Germanistik im Dritten Reich geleistet, in vielen Feldern aber besteht nach wie vor Forschungsbedarf, womit zum Thema der nationalsozialistischen Vergangenheit auch in der germanistischen Fachgeschichte weitere Arbeiten erforderlich und wünschenswert sind.
BIBLIOGRAPHIE
Quellen:
BÜCHERKUNDE: „Organ des Amtes für Schrifttumspflege bei dem Beauftragten des Führers für die gesamte geistige und weltanschauliche Erziehung der NSDAP u. der Reichsstelle zur Förderung des Deutschen Schrifttums“. Bayreuth 1937-1944.
Gerhard FRICKE: Rede Gerhard Frickes vor seinen Studierenden zu Beginn des Sommersemesters 1965 in Köln. In: Petra Boden, Rainer Rosenberg: Deutsche Literaturwissenschaft 1945-1965. Fallstudien zu Institutionen, Diskursen, Personen. Berlin 1997, 85-96.
Ders., Franz KOCH, Klemens LUGOWSKI (Hg.): Von deutscher Art in Sprache und Dichtung. 5 Bände. Stuttgart, Berlin 1941.
Hermann HAARMANN, Walter HUDER und Klaus SIEBENHAAR (Hg.): Katalog zur Ausstellung der Akademie der Künste „,Das war ein Vorspiel nur...‘. Bücherverbrennung Deutschland 1933 – Voraussetzungen und Folgen“. Berlin 1983, darin: Hans Naumann: Ansprache, gehalten auf dem Bonner Marktplatz am 10. Mai 1933, 202-204.
Arthur HÜBNER: Herman Wirth und die Ura-Linda-Chronik. Berlin/Leipzig 1934.
Julius PETERSEN: Die Sehnsucht nach dem Dritten Reich in deutscher Sage und Dichtung. In: Dichtung und Volkstum 35 (1934), 18-40, 145-182.
Die URA LINDA Chronik. Text-Ausgabe. Übersetzt von Herman Wirth. Leipzig 1934.
Karl VIËTOR: Die Wissenschaft vom deutschen Menschen in dieser Zeit. In: Zeitschrift für deutsche Bildung 9 (1933), 342-348.
Forschungsliteratur:
Beda ALLEMANN: Literatur und Germanistik nach der ,Machtübernahme’. Colloquium zur 50. Wiederkehr des 30. Januar 1933 an der Universität Bonn. Bonn 1983.
Wilfried BARNER, Christoph KÖNIG (Hg.): Zeitenwechsel. Germanistische Literaturwissenschaft nach 1945. Frankfurt/Main 1996.
Petra BODEN, Holger DAINAT (Hg.): Atta Troll tanzt noch. Selbstbesichtigungen der literaturwissenschaftlichen Germanistik im 20. Jahrhundert. Berlin 1997.
Petra BODEN: Universitätsgermanistik in der SBZ/DDR. Personal- und Berufungspolitik 1945-1958. In: Zeitschrift für Germanistik N.F. (1995), 373-383.
Klaus BRIEGLEB: Deutschwissenschaft 1933. In: K.B.: Unmittelbar zur Epoche des NS-Faschismus. Arbeiten zur politischen Philologie 1978-1988. Frankfurt/Main 1989, 103-138.
Karl-Otto CONRADY: Deutsche Literaturwissenschaft und Drittes Reich. In: Germanistik – eine deutsche Wissenschaft. Beiträge von E. Lämmert, W. Killy, K.O. Conrady, P. v. Polenz. Frankfurt/Main 1967, 71-109.
Holger DAINAT: Germanistische Literaturwissenschaft. In: Frank-Rutger Hausmann (Hg.): Die Rolle der Geistes-wissenschaften im Dritten Reich 1933-1945. München 2002, 63-86.
Ders.: Anpassungsprobleme einer nationalen Wissenschaft. Die Neuere deutsche Literaturwissenschaft in der NS-Zeit. In: BODEN/DAINAT, 103-126.
Hermann ENGSTER: Germanisten und Germanen. Germanenideologie und Theoriebildung in der deutschen Germanistik und Nordistik von den Anfängen bis 1945 in exemplarischer Darstellung. Frankfurt/Main 1986.
Jens Malte FISCHER: Zwischen uns und Weimar liegt Buchenwald. In: Merkur 41 (1987), 12-25.
Marcus GÄRTNER: Kontinuität und Wandel in der neueren deutschen Literaturwissenschaft nach 1945. Bielefeld 1997.
Hartmut GAUL-FERENSCHILD: National-völkisch-konservative Germanistik. Kritische Wissenschaftsgeschichte in personengeschichtlicher Darstellung. Bonn 1993.
Ingrid GRAUBNER: Theater an der Universität. Zum 80. Jahrestag der Eröffnung des Theaterwissenschaftlichen Instituts. In: HUMBOLDT v. 13. November 2003, S. 11. [Zu Max Herrmann].
Frank-Rutger HAUSMANN: „Deutsche Geisteswissenschaft“ im Zweiten Weltkrieg. Die „Aktion Ritterbusch“ (1940-1945). Dresden 1998.
Christa HEMPEL-KÜTER: Germanistik zwischen 1925 und 1955: Studien zur Welt der Wissenschaft am Beispiel von Hans Pyritz. Berlin 2000. Zugl. Habil.-Schrift Univ. Hamburg 1997.
Werner HERDEN: Zwischen “Gleichschaltung” und Kriegseinsatz. Positionen der Germanistik in der Zeit des Faschismus. In: Weimarer Beiträge 33 (1987), 1865-1881.
Jost HERMAND: Geschichte der Germanistik. Reinbek 1994.
Wolfgang HÖPPNER: Germanistische Literaturwissenschaft im Dritten Reich. Vorlesung, gehalten im Sommersemester 2000 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hier: Skript O.L.
Ders.: Franz Koch, Erwin Guido Kolbenheyer und das Organische Weltbild in der Dichtung. In: Zeitschrift für Germanistik. Neue Folge 9 (1999), 318-328.
Ders.: Der Berliner Germanist Franz Koch als „Literaturmittler“, Hochschullehrer und Erzieher. In: Gesine Bey (Hg.): Berliner Universität und deutsche Literaturgeschichte. Studien im Dreiländereck von Wissenschaft, Literatur und Publizistik. Frankfurt/Main 1998, 105-128.
Ders.: Franz Koch und die deutsche Literaturwissenschaft in der Nachkriegszeit. Zum Problem von Kontinuität und Diskontinuität in der Wissenschaftsgeschichte der Germanistik. In: BODEN/DAINAT, 175-192.
Michael H. KATER: Das „Ahnenerbe“ der SS 1933-1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. München ²1997.
Christoph KÖNIG, Hans-Harald MÜLLER, Werner RÖCKE (Hg.): Wissenschaftsgeschichte der Germanistik in Porträts. Berlin 2000.
Joachim LERCHENMÜLLER, Gerd SIMON: Im Vorfeld des Massenmordes. Germanistik und Nachbarfächer im 2. Weltkrieg. Eine Übersicht. Tübingen ³1997.
Utz MAAS: Die vom Faschismus verdrängten Sprachwissenschaftler – Repräsentanten einer anderen Sprachwissenschaft? In: Edith Böhne, Wolfgang Motzkau-Valeton (Hg.): Die Künste und die Wissenschaften im Exil 1933-1945. Gerlingen 1992, 445-502.
Horst MÖLLER: Exodus der Kultur. Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler in der Emigration nach 1933. München 1984.
Norbert OELLERS: Dichtung und Volkstum. Der Fall der Literaturwissenschaft. In: ALLEMANN, 232-254.
Ruth RÖMER: Der Germanenmythos in der Germanistik der dreißiger Jahre. In: ALLEMANN, 216-231.
Gerhard SAUDER (Hg.): Zum 10. Mai 1933. Die Bücherverbrennung. München 1983.
Walter SCHMITZ (Hg.): Modernisierung oder Überfremdung? Zur Wirkung deutscher Exilanten in der Germanistik der Aufnahmeländer. Stuttgart 1994.
Gudrun SCHNABEL: Gerhard Fricke. Karriereverlauf eines Literaturwissenschaftlers nach 1945. In: Petra Boden, Rainer Rosenberg: Deutsche Literaturwissenschaft 1945-1965. Fallstudien zu Institutionen, Diskursen, Personen. Berlin 1997, 61-84.
Wilhelm VOßKAMP: Kontinuität und Diskontinuität. Zur deutschen Literaturwissenschaft im Dritten Reich. In: Peter Lundgreen (Hg.): Wissenschaft im Dritten Reich. Frankfurt/Main 1985, 140ff.
Ulrich WALBERER (Hg.): 10. Mai 1933. Bücherverbrennung in Deutschland und die Folgen. Frankfurt/Main 1983.
Regina WEBER: Zur Remigration des Germanisten Richard Alewyn. In: H.A. Strauss, K. Fischer, Chr. Hoffmann, A. Söllner (Hg.): Die Emigration der Wissenschaften nach 1933. Disziplingeschichtliche Studien. München 1991, 235-256.
Klaus ZIEGLER: Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft im Dritten Reich. In: Andreas Flitner (Hg.): Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus. Eine Vortragsreihe der Universität Tübingen. Tübingen 1965, 144-159.
[...]
[1] Bezüge auf Aufzeichnungen aus diesen Vorlesungen werden im folgenden angegeben mit dem Hinweis auf: HÖPPNER 2000.
[2] Eine Auflistung der vom Verbot betroffenen Autoren mit Kurzbiographien findet sich bei HAARMANN, HUDER, SIEBENHAAR 444-454.
[3] Naumanns Rede ist dokumentiert in: HAARMANN, HUDER, SIEBENHAAR 202-204.
[4] Zum Begriff der „Deutschkunde“ s. DAINAT 2002, 80f.
[5] DAINAT 1997, 110.
[6] Zu diesem Abschnitt vgl. HERMAND 83-97.
[7] Daß diese Umbenennung als ein programmatisches Bekenntnis zu deutschnationalen Ideen verstanden werden muß, beschreibt Jost Hermand (HERMAND 85).
[8] Zitiert nach HERMAND 109.
[9] Vgl. zu diesem Abschnitt HERMAND 109.
[10] Vgl. MÖLLER 91.
[11] Vgl. WEBER 235.
[12] Mit Melitta Gerhard (Kiel) wurde 1933 die einzige Privatdozentin in der germanistischen Literaturwissenschaft aus dem Deutschen Reich vertrieben, sie emigrierte in die USA. Vgl. DAINAT 2002 , 75 und HEMPEL-KÜTER 292.
[13] Angaben nach HEMPEL-KÜTER 23.
[14] Zu Agathe Lasch vgl. MAAS, bs. 447-449, ferner HEMPEL-KÜTER 296.
[15] Auch Joseph Goebbels hatte bei Gundolf promoviert.
[16] Zitiert nach WEBER 242.
[17] Angaben zu Richard Alewyn nach KÖNIG, MÜLLER, RÖCKE 211-220, WEBER sowie GÄRTNER 297.
[18] Zu den Angaben über Walter Benjamin vgl. KÖNIG, MÜLLER, RÖCKE 274 und HERMAND 99.
[19] Zu diesem Abschnitt über Käte Hamburger vgl. KÖNIG, MÜLLER, RÖCKE 189-198.
[20] Karl Viëtor: Die Wissenschaft vom deutschen Menschen in dieser Zeit. In: Zeitschrift für deutsche Bildung 9 (1933), 342-348.
[21] Zum Abschnitt über Viëtor und v.d. Leyen vgl. HERMAND 100 und HÖPPNER 2000.
[22] Angaben über Berend nach KÖNIG, MÜLLER, RÖCKE 176-179 und VOßKAMP 155f.
[23] Vgl. HÖPPNER 2000.
[24] Zu Max Herrmann vgl. HÖPPNER 2000 und GRAUBNER.
[25] Angaben nach HÖPPNER 2000, zu Fricke vgl. darüber hinaus HEMPEL-KÜTER 292.
[26] Julius Petersen: Die Sehnsucht nach dem Dritten Reich in deutscher Sage und Dichtung. In: Dichtung und Volkstum 35 (1934), 18-40, 145-182. Die Zeitschrift Bücherkunde des Amtes Rosenberg rezensiert den Aufsatz und lehnt ihn mit der Begründung ab, daß der Nationalsozialismus kämpferisch und nicht geistig-utopisch sei (vgl. HÖPPNER 2000). Zur Zeitschrift Euphorion/Dichtung und Volkstum siehe auch OELLERS.
[27] Erschienen in der Vierteljahrsschrift der Goethe-Gesellschaft 1936.
[28] Vgl. zu diesem Phänomen HÖPPNER 2000 sowie HERMAND 110.
[29] Vgl. DAINAT 2002, 64.
[30] Zur Biographie Benno v. Wieses vgl. KÖNIG, MÜLLER, RÖCKE 221-227.
[31] HERDEN 1875.
[32] Vgl. ebd. - Zu Kochs völkisch und rassenbiologisch orientiertem Germanistikkonzept vgl. HÖPPNER 1998 und HÖPPNER 1999.
[33] Zitiert nach HERDEN 1876f.
[34] Vgl. HERDEN 1877.
[35] Zum SS-Ahnenerbe vgl. Michael H. Kater: Das „Ahnenerbe“ der SS 1933-1945. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. München ²1997.
[36] HERDEN 1873. Zur Ura-Linda-Chronik vgl. ebd. und HÖPPNER 2000.
[37] Zitiert nach DAINAT 2002, 66.
[38] Zitiert nach DAINAT 2002, 73.
[39] Zitiert nach HEMPEL-KÜTER 25.
[40] DAINAT 1997, 114.
[41] DAINAT 2002, 78.
[42] DAINAT 2002, 86.
[43] HAUSMANN 414. - Das germanistische Gemeinschaftsprojekt Von deutscher Art in Sprache und Dichtung wurde von Franz Koch, Gerhard Fricke und Clemens Lugowski i.V. mit Josef Nadler, Hans Naumann, Otto Höfler und Karl Justus Obenauer organisiert und von der DFG finanziert. Die potentiellen Mitarbeiter wurden vom 5.-7. Juli 1940 zu einer vorbereitenden ersten Tagung in den Saal des Goethemuseums in Weimar eingeladen.
[44] Gerhard FRICKE, Franz KOCH, Klemens LUGOWSKI (Hg.): Von deutscher Art in Sprache und Dichtung. 5 Bände. Stuttgart, Berlin 1941, hier S. V. - Einige Titel von Einzelbeiträgen: Julius Petersen, Grimmelshausens Simplicissimus als deutscher Charakter; Willi Flemming, Die deutsche Seele des Barocks; Benno von Wiese, Die deutsche Leistung der Aufklärung; Leo Weisgerber, Die deutsche Sprache im Aufbau des deutschen Volkslebens; Walther Mitzka, Bauern- und Bürgersprache im Ausbau des deutschen Volksbodens; Ewald Geisler, Deutsches Wesen in Laut und Lautung.
[45] FRICKE, KOCH, LUGOWSKI VI.
[46] Zitiert nach VOßKAMP 147. Zum gesamten Kapitel über den Kriegseinsatz der Germanistik vgl. HAUSMANN, bs. 169-176.
[47] Vgl. HAHN 251.
[48] Vgl. HERMAND 114 und HAHN 249.
Häufig gestellte Fragen zur "Germanistik im Dritten Reich" Analyse
Was ist der Fokus dieser Analyse?
Diese Analyse konzentriert sich auf die Situation der Germanistik (deutsche Philologie) im Dritten Reich, insbesondere die Ausgangslage 1933, die Auswirkungen von Berufsverboten und Exil, sowie die Rolle des Berliner Germanischen Seminars während des Nationalsozialismus.
Welche Ereignisse prägten die Germanistik im Jahr 1933?
Die Bücherverbrennungen im Mai 1933, initiiert von der Deutschen Studentenschaft, bei denen Germanisten wie Hans Naumann als Brandredner auftraten, markieren einen Wendepunkt. Die Germanistik, oft konservativ und national orientiert, passte sich schnell an das NS-Regime an.
Wer war von Berufsverboten und Exil betroffen?
Vor allem jüdische Germanisten, aber auch politisch unliebsame Wissenschaftler. Beispiele sind Richard Alewyn, Agathe Lasch, Walter Benjamin, und Karl Viëtor. Ihnen wurde entweder die Habilitation verwehrt, sie wurden entlassen oder zur Emigration gezwungen.
Wie verhielten sich die Germanisten am Berliner Germanischen Seminar?
Die nicht von Berufsverboten betroffenen Professoren passten sich an das NS-Regime an. Julius Petersen begrüßte die Ereignisse und bemühte sich um den Nachweis seiner arischen Abstammung. Es gab auch Auseinandersetzungen, etwa um Neuberufungen, aber eher aus wissenschaftlichen als aus politischen Gründen.
Was war die "Aktion Ritterbusch"?
Ein Gemeinschaftswerk, initiiert vom Reichsministerium für Erziehung, Wissenschaft und Volksbildung, bei dem Geisteswissenschaftler, darunter auch Germanisten, Beiträge leisten sollten, um die Überlegenheit der deutschen Geisteswissenschaften zu demonstrieren und einen Beitrag zum ideologischen Kampf gegen die Westmächte zu leisten.
Gab es Widerstand gegen die NS-Ideologie in der Germanistik?
Obwohl die meisten Germanisten sich anpassten, gab es Ausnahmen wie Walter Rehm und Max Kommerell, die sich der "Aktion Ritterbusch" entzogen. Es gab auch Kritik von offizieller Seite, dass die Germanistik nicht ausreichend NS-orientiert sei.
Wie sah die Kontinuität nach 1945 aus?
Methoden und Denkweisen, die vor 1933 entwickelt wurden, prägten die Germanistik auch nach 1945. Neue Strömungen wurden zunächst abgelehnt, und viele Professoren, die im Nationalsozialismus tätig waren, konnten ihre Karriere fortsetzen.
Welche Rolle spielte das Amt Rosenberg in der Germanistik des Dritten Reiches?
Das Amt Rosenberg, unter der Leitung von Alfred Rosenberg, spielte eine bedeutende Rolle bei der ideologischen Ausrichtung und Überwachung der Germanistik im Dritten Reich. Es gab Auseinandersetzungen zwischen dem Seminar und staatlichen Stellen, insbesondere bei Neuberufungen, wenn die vorgeschlagenen Kandidaten den wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügten. Rosenberg-Lektoren wurden eingesetzt, um die wissenschaftliche Arbeit der Germanisten zu überprüfen.
- Arbeit zitieren
- Oliver Lusch (Autor:in), 2003, Germanistik im Dritten Reich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110405