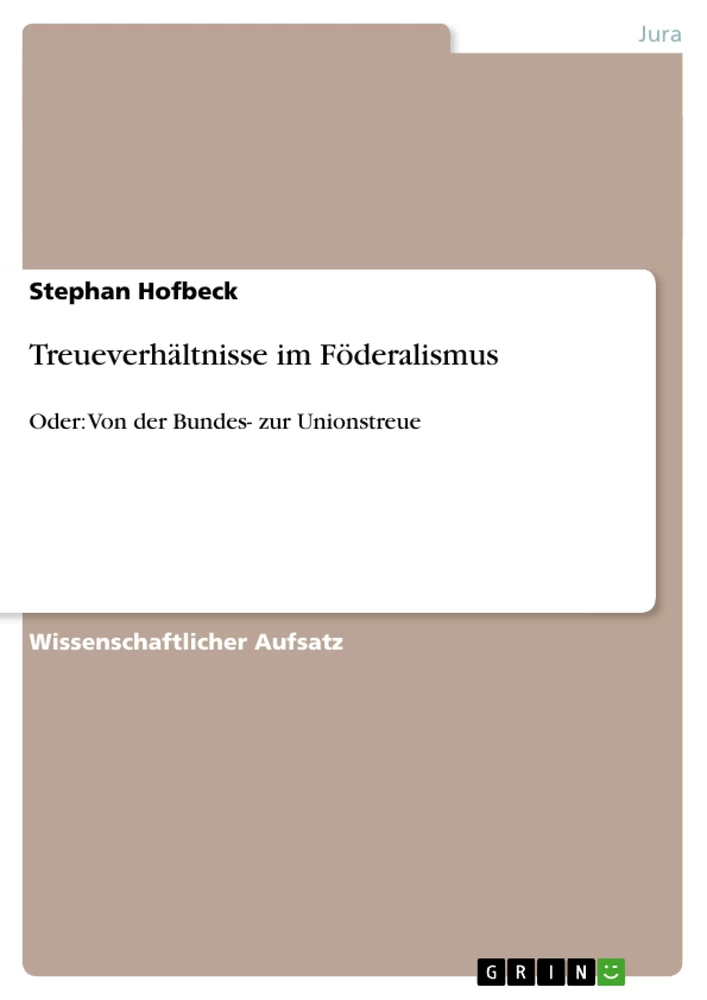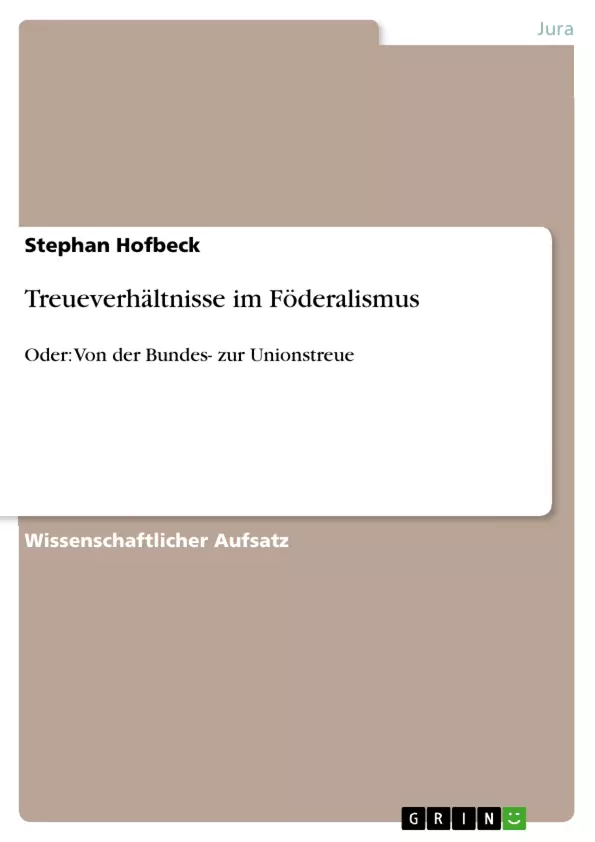Kaum ein Student im Grundstudium hat noch nichts von ihr
gehört, doch die Wenigsten dürften sich ihrer Bedeutung
bewusst sein: Die Bundestreue. Nicht nur in
staatsorganisationsrechtlichen Klausuren spielt sie eine
Rolle, auch im Zuge der europäischen Integration kommt
ihr ein nicht zu unterschätzender Part neben der noch
immer nahezu unbekannten Unionstreue zu.
stud. iur. Stephan Hofbeck, Bayreuth
Treueverhältnisse im Föderalismus
Oder: Von der Bundes- zur Unionstreue*
Kaum ein Student im Grundstudium hat noch nichts von ihr gehört, doch die Wenigsten dürften sich ihrer Bedeutung bewusst sein: Die Bundestreue. Nicht nur in staatsorganisationsrechtlichen Klausuren spielt sie eine Rolle, auch im Zuge der europäischen Integration kommt ihr ein nicht zu unterschätzender Part neben der noch immer nahezu unbekannten Unionstreue zu.
I. Die Bundestreue
1. Terminologie
„Bund und Kantone unterstützen einander in der Erfüllung ihrer Aufgaben und arbeiten zusammen. Sie schulden einander Rücksicht und Beistand,“ legt Art. 44 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft fest. Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland spielt also die Treue eine zentrale Rolle, vielmehr erscheint sie in föderativen Systemen geradezu unverzichtbar, denn ähnliche Grundsätze finden sich auch in der belgischen Verfassung, sowie in anderen Bundesstaaten wie Australien, Österreich, Spanien und den USA[1]. Dies wurde schon früh vom BVerfG erkannt, so dass es von der „verfassungsrechtlichen Pflicht[2] “ der Glieder des Bundes sowie des Bundes selbst sprach, sich die Treue zu halten und sich zu verständigen. Vielfach wird auch vom Grundsatz des bundesfreundlichen Verhaltens[3] gesprochen, andere verkomplizieren[4] die Begriffsvielfalt durch Differenzierung zwischen Bundes- und Ländertreue, wobei man wohl zutreffender von der Bündnistreue sprechen müsste[5].
2. Historie
Die Tradition reicht bis in das Deutsche Reich von 1871 zurück[6]. Ausschlaggebend für das heutige Verständnis der Bundestreue war jedoch Rudolf Smend [7] mit seinem Aufsatz „Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchischen Bundesstaat“ von 1916[8]. Als normative Grundlage nannte er das ungeschriebene Verfassungsrecht. Nach ihm ergäben sich die Pflichten der Bundestreue nicht mehr aus einem Subordinationsverhältnis des Reichs zu den Ländern, sondern aus einem Kooperationsverhältnis des „Bundes zu seinen Verbündeten[9] “. Mit der elastischen Rechtsfigur der Bundestreue könne man die Lücken des geschriebenen Verfassungsrechts zur adäquaten Einzelfall-Lösung ergänzen[10]. Nachdem im Geltungsbereich der WRV die Bundestreue ein tristes „Schattendasein“ fristete[11] und im Nationalsozialismus gänzlich an Bedeutung verloren hat[12], wurde ihre trostlose Existenz durch einzelne Ausprägungen im Grundgesetz[13] und nicht zuletzt sehr früh durch das BVerfG aufgewertet. In seiner Entscheidung vom 21.05.1952, in welcher es sogar ausdrücklich auf die Arbeit Smends Bezug nahm, kam es zu seiner Auffassung, dass der verfassungsrechtliche Grundsatz des Föderalismus „die Rechtspflicht des Bundes und aller seiner Glieder zu ‚bundesfreundlichem Verhalten’[14] “ enthält; dies war die Geburtsstunde der heutigen Bundestreue.
3. Normative Grundlage
a) Uneinig ist man sich bzgl. der normativen Grundlage der Bundestreue. Bleckmann glaubte – schwer vertretbar – die Grundlage in Art. 72 II Nr. 2 GG a.F.[15] zu erkennen[16], andere versuchen die Bundestreue als Verfassungsgewohnheitsrecht anzuerkennen, oder aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleiten[17].
b) Eine weitere Ansicht betrachtet die Bundestreue als „staatsrechtliche Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben[18] “, also als Spezialausformung des aus Art. 3 I GG ableitbaren allgemeinen Missbrauchs- und Willkürverbotes. Dennoch befürworten selbst ihre Vertreter die Herleitung der Rechtsfigur aus dem Bundesstaatsprinzip, da dies näher am Verfassungstext liege[19].
c) Wie schon eingangs erwähnt, hat das BVerfG bereits in einer seiner ersten Entscheidungen erkannt, dass die Bundestreue dem Bundesstaatsprinzip entspreche[20]. An dieser Auffassung hielt es im Laufe seiner Judikatur fest[21]. Dennoch kann der fortwährende Verweis auf den Bundesstaat nicht aufschlussreich sein, ohne die Funktion der Bundestreue eben in diesem Bundesstaat zu begreifen.
aa) Es liegt in der Natur der Sache, dass dort, wo Menschen agieren, stets versucht wird, konträre Interessen zu verwirklichen. Nichts anderes gilt bei Bund und Ländern, hinter denen letztlich auch nur der menschliche Geist waltet. Auch sie verfolgen zum Teil gegenläufige Interessen, welche den jeweils anderen Teil zu schädigen vermögen. Würde man diese Divergenz nicht regeln, so bestünde die Gefahr des Auseinanderbrechens des Bundesstaates. Ein solcher Regulator ist die Bundestreue. Sie bildet die conditio sine qua non des Bundesstaates[22] und regelt die Egoismen des Bundes und der Länder, so dass das „natürliche Streben, den Bundesstaat zu sprengen[23] “ im Zaum gehalten wird.
bb) Die Bundestreue fungiert folglich als Schlussstein im föderalen Gesamtgefüge[24]. Sie dient dazu, das aufgrund der Egoismen stets vorhandene Konfliktpotential zwischen den Beteiligten zu zerstreuen, um so eine Demontage der Beziehungen zu verhindern. Wie schon Smend erkannte, werden mit der Verfassung selbst sowie mit der Bundestreue die vorhandenen Lücken in den Bund-Länder-Beziehungen geschlossen[25] und somit das von der Verfassung vorgegebene Gleichgewicht erhalten.
4. Rechtsfolgen
Man kann vorwegnehmen, dass die Bundestreue alleine nicht geeignet ist, Rechte und Pflichten zu begründen. Sie ist grds. von akzessorischer und nachrangiger Natur, was bedeutet, dass die Bundestreue gegenüber speziellen verfassungsrechtlichen Regelungen zurücktritt und nur innerhalb eines bereits bestehenden Rechtsverhältnisses Anwendung findet. Ihre Wirkungsweise ist dreidimensional, verpflichtet sind somit Bund und Länder untereinander und gegeneinander[26].
a) Klassische Fallgruppen
aa) Kompetenzausübungsschranke. Große Relevanz hat die Bundestreue im Bereich der Kompetenzen[27]. Den Beteiligten ist es nicht gestattet, diese in egoistischer Weise zu gebrauchen. Bei Bedarf müssen sie zum Wohle der übrigen Beteiligten auf die eigenen Ziele verzichten[28]. Ebenso muss vermieden werden, dass es durch die Kompetenzausübung zu widersprüchlichen Regelungen kommt, die letztlich den Bürger belasten[29]. Die besondere Bedeutung wurde im Bereich des Rundfunkwesens vom BVerfG herausgestellt. Die Gesetzgebungskompetenz für diesen Bereich liegt gem. Art. 70, 30 GG bei den Ländern, so dass sich überregionale Rundfunkveranstalter – wie sie heute in einer großen Zahl vorhanden sind – ggf. „einem ganzen Bündel unterschiedlicher landesrechtlicher Normierungen[30] “ ausgesetzt sehen. Demnach ist Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Systems eine Kooperation der Länder, um die jeweiligen landesrechtlichen Regelungen abzustimmen. Diese Notwendigkeit der Zusammenarbeit ergibt sich unmittelbar aus dem Grundsatz der Bundestreue[31].
bb) Verfahrenspflichten. Darüber hinaus begründet die Bundestreue auch Verfahrenspflichten. Sie regelt die Art und Weise des Vorgehens der Beteiligten bzgl. Fragen von gesamtstaatlichen Interesse[32]. Somit ist es Pflicht des Bundes, sich bei Angelegenheiten, welche auch die Länder betreffen, mit diesen abzustimmen. Im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung obliegt es dem Bund, vor Erteilung einer Weisung die Länder zu hören und die Verständigung mit ihnen zu suchen[33]. Doch diese Verfahrenspflichten erschöpfen sich nicht nur im Verhältnis Bund-Ländern. So kann es auch umfassende Auskunftsansprüche eines Landes gegen ein benachbartes Land geben, z.B. bzgl. Sicherheitsvorkehrungen eines angrenzenden Kernkraftwerkes[34]. Eine weitere Fallgruppe bildet die Pflicht eines Landes, von der Befugnis zur Landesaufsicht gegen Kommunen gebrauch zu machen, wenn eine Gemeinde die Verfassungsordnung stört und der Bund mangels Kompetenz nicht eingreifen kann. Zudem existiert für alle Beteiligten ein Rechtsmissbrauchsverbot[35].
b) Moderne Fallgruppen
Eine ganz neue Bedeutung erfährt die Rechtsfigur der Bundestreue zunehmend im europarechtlichen Bereich.
aa) Vollzug von Gemeinschaftsrecht. Grds. trifft die Pflicht zum Vollzug des Gemeinschaftsrechts die Mitgliedsstaaten an sich. Diese berührt jedoch nicht die verfassungsgemäße Zuständigkeit von Bund und Ländern, was aber den Bund nicht von seiner Verantwortung gegenüber den Gemeinschaften befreit[36]. Abhilfe schafft die Integrationsermächtigung des Art. 23 I GG i.V.m. der Bundestreue. Hieraus wird die Vollzugspflicht der Länder hergeleitet[37]. Voraussetzung ist jedoch die kompetenzielle Zuständigkeit dieser[38]. Ist sie gegeben, so ergibt sich die umfassende Pflicht der Länder das Gemeinschaftsrecht zu vollziehen. Im Falle einer Pflichtverletzung sind die im Grundgesetz vorhandenen Maßnahmen bis hin zum Bundeszwang denkbar.
bb ) Regress des Bundes gegen die Länder. Durch den vom EuGH entwickelten gemeinschaftsrechtlichen Staatshaftungsanspruch[39] können die Mitgliedsstaaten bei Verletzung der Vollzugspflicht in Anspruch genommen werden. Allerdings kann die Bundestreue keine Grundlage für Haftungsansprüche des Bundes wegen Pflichtverletzungen der Länder darstellen[40], so dass sich aus ihr lediglich die beiderseitige Pflicht ableiten lässt, sich bei Bedarf um einen ausgewogenen Haftungsausgleich zu bemühen[41].
cc) Vertretung von Länderinteressen durch den Bund. Eine weitere Bedeutung kommt der Bundestreue im Rahmen der Vertretung der Länderinteressen durch den Bund auf europarechtlicher Ebene zu. Da den Mitgliedsstaaten die Repräsentation vor den Europäischen Gemeinschaften gebührt, sind die Länder folglich nicht in der Lage ihre verfassungsrechtlich zugewiesenen Kompetenzen gegenüber den Gemeinschaftsorganen wahrzunehmen. Um dem entgegenzuwirken obliegt es dem Bund, sich aktiv für die Belange der Länder einzusetzen und deren verfassungsmäßigen Rechte zu vertreten[42].
II. Die Unionstreue
1. Begriff
Angefangen von der „Pflicht zur Solidarität[43] “ bis hin zum „Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit[44] “ lassen sich viele Variationen finden. Zunehmend stößt man auch auf den Begriff der „Gemeinschaftstreue[45] “. Um jedoch der Bedeutung und Tragweite dieses Rechtsgrundsatzes gerecht zu werden, empfiehlt es sich von der „Unionstreue[46] “ zu sprechen. Im nicht-deutschsprachigen Schrifttum wird zumeist von „principle/duty of solidarity[47] “, „duties to co-operate in good faith[48] “ oder „coopération loyale[49] “ gesprochen.
2. Entstehungsgeschichte
Entwickelt wurde die Unionstreue in verschiedenen Entscheidungen des EuGH [50], in welchen er den Inhalt des Art. 10 EG präzisierte. Ausgehend vom Wortlaut enthält die Norm Vertragserfüllungspflichten[51] für die Mitgliedsstaaten. So werden in Art. 10 I EG Handlungspflichten statuiert, während in Art. 10 II EG ein allgemeines Beeinträchtigungsverbot normiert ist. Nach dem EuGH bestünden eine Vielzahl an Treuepflichten zwischen den Mitgliedsstaaten und der EG. Dies geht soweit, dass gem. EuGH Art. 10 EG die Mitgliedsstaaten sogar an im Grunde unverbindliche Empfehlungen und Stellungnahmen der Kommission binden könne[52].
3. Normative Grundlage
Um die normative Grundlage der Unionstreue besser verstehen zu können, bedarf es zugleich einer Positionierung von Art. 10 EG im Gesamtgefüge des Gemeinschaftsrechts. Diese ist strittig.
a) Eine Ansicht betrachtet Art. 10 EG als maßgeblich und abschließend und verneint die Existenz der Unionstreue. Begründet wird dies damit, dass alle Verpflichtungen der EU gegenüber den Mitgliedsstaaten im Unionsvertrag von Maastricht fixiert wurden. Allerdings lesen die Vertreter dieser Meinung entgegen dem Wortlaut des Art. 10 EG auch Verpflichtungen der Gemeinschaftsorgane gegenüber den Mitgliedsstaaten hinein[53]. Andere argumentieren, den Grundsatz der Bundestreue gebe es nur in Bundesstaaten, die EU sei aber kein Bundesstaat[54].
b) Nicht zuletzt der EuGH geht in verschiedenen Entscheidungen offenbar von der Existenz eines über Art. 10 EG stehenden Grundsatzes aus, indem er feststellt, die Mitwirkungspflichten lägen „namentlich“ bzw. „insbesondere“ dem Art. 10 EG zugrunde. Demnach ist Art. 10 EG lediglich eine pars pro toto-Regelung[55]. Zudem wird der o.g. Meinung entgegengehalten, dass selbst im allgemeinen Völkerrecht ein Rücksichtnahmegebot existiere. Mit zunehmender Integration müsse dieses graduell zunehmen, so dass die Unionstreue in der EU jedenfalls nicht ausgeschlossen sei[56]. Ganz im Gegenteil liegt der EU eine föderative Verfassungsstruktur[57] zugrunde, welche in der Unionstreue Ausdruck findet. Ein Bundesstaat im Sinne der deutschen Staatslehre muss also nicht Voraussetzung für die Annahme eines solchen Treueverhältnisses sein. Zentraler Punkt ist auch nicht der Bundesstaats-, sondern der Treueaspekt[58]. Zudem ist die Unionstreue „schlechterdings fundamental[59] “ für die Sicherung der Funktionsfähigkeit der EU als Rechtsgemeinschaft. Nicht zuletzt in Art. I-5 II 1 EVV hat die Unionstreue ihren Niederschlag gefunden, alle übrigen vorhandenen Entwürfe sehen die Unionstreue ebenso als Selbstverständlichkeit an[60].
4. Rechtsfolgen
Die Unionstreue ist ebenso wie die Bundestreue rechtlich verbindlich und justiziabel. Eine Verletzung kann mit einer Vertragsverletzungsklage gem. Art. 227 EG geltend gemacht werden[61]. Auch wirkt sie dreidimensional und gilt nur im Rahmen bestehender Rechtsverhältnisse, wobei auch hier der Grundsatz der Subsidiarität einschlägig ist, so dass gesetztes Unionsrecht stets vorgeht[62]. Die Unionstreue wird durch die Subprinzipien der Kooperation sowie der Rücksichtnahme operationalisiert und durch die Loyalität – der „Geist“ (vgl. Art. 11 II EU) der Kooperation und Rücksichtnahme – modifiziert. Diese prägen die dualistische Natur der Unionstreue, woraus sich Handlungs- und Unterlassungspflichten ergeben[63]. Diese dürfen allerdings nicht als abschließend betrachtet werden.
a) Handlungspflichten
Die Handlungspflichten der Mitgliedsstaaten ggü. der EU sind bereits umfangreich in Art. 10 I EG normiert, welche der EuGH bei zahlreichen Gelegenheiten verfeinert hat[64]. Die Unionstreue kann lediglich ergänzende Pflichten begründen, wie die Pflicht zur Konsultation und Information, sowie zum Beistand und zur Solidarität. Im umgekehrten Verhältnis existiert keine vergleichbare Ausprägung. Eine Handlungspflicht der Union ggü. dem Mitgliedsstaat aus der Unionstreue wäre die Pflicht zur aktiven Unterstützung der Mitgliedsstaaten bei der Durchführung des Gemeinschaftsrechts auf nationaler Ebene. Auch für das Verhältnis betreffend die Mitgliedsstaaten untereinander fehlt eine umfassend normierte Regelung. So gibt z.B. Art. 11 II EU eine Pflicht zur Loyalität und gegenseitiger Solidarität im Rahmen der GASP auf. Diese kann jedoch gem. Art. 11 II EU i.V.m. der Unionstreue auf das gesamte Verhältnis untereinander ausgedehnt werden. Daneben sind noch Kooperations- und Beistandspflichten denkbar[65]. Zudem ergibt sich aus der Unionstreue auch die Pflicht der Mitgliedsstaaten, im Rahmen der Durchführung des Europäischen Gemeinschaftsrechts durch andere Mitgliedsstaaten getroffene Entscheidungen anzuerkennen und ggf. zu vollstrecken[66].
b) Unterlassungspflichten
Ebenso wie bei den Handlungspflichten enthält Art. 10 II EG in Form eines allgemeinen Beeinträchtigungsverbotes eine abschließende Regelung der Unterlassungspflichten der Mitgliedsstaaten gegenüber der EU[67]. Unterlassungspflichten der EU sind abgesehen von Einzelausprägungen nicht konkretisiert. Jedoch lässt sich aus der Unionstreue eine direkte Kompetenzausübungsschranke herleiten, welche Rechtsmissbrauch sowie Regelungen aus sachfremden Motiven verbietet. Zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten besteht die Pflicht, ihre völkerrechtlichen Kompetenzen außerhalb des europäischen Vertragsrechts nicht zum Nachteil der übrigen Mitgliedsstaaten auszuüben. So entschied der EuGH, dass eine Verletzung der Unionstreue vorliege, wenn „eine Maßnahme zur Durchführung eines solchen von den Mitgliedsstaaten außerhalb der Verträge geschlossenen Übereinkommens oder des davon abgeleiteten Rechts das Funktionieren der Gemeinschaftsorgane behindern würde[68].“
III. Resümee
Man erkennt, dass es innerhalb föderativer Verbände stets ein – geschriebenes oder ungeschriebenes – Treueverhältnis gibt, welches den Fortbestand sichert, gesetztes Recht ergänzt und flexibilisiert. Dieses Treueverhältnis wirkt dreidimensional und verpflichtet einer Ehe ähnlich jeden Partner. Weiterhin kann festgestellt werden, dass sich aus solch einem Treueverhältnis umfangreiche und nicht zu unterschätzende Rechtsfolgen ergeben, deren Ausformung der Judikativen obliegt. Es steht zu erwarten, dass im Speziellen die Bundes- und Unionstreue bei zunehmender Integration nicht an Bedeutung verlieren, sondern wohl eher gewinnen werden, damit das immer größer werdende föderale Geflecht aus einzelnen staatlichen Elemente nicht irgendwann zu zerfallen beginnt. Bleibt nur abzuwarten, wie der Bund seiner „Doppelehe“ gerecht werden wird.
[...]
* Der Autor ist Student der Rechtswissenschaft an der Universität Bayreuth.
[1] Vgl. Unruh, EuR 2002, 41 (47 f.).
[2] BVerfGE 1, 299 (315) = NJW 1952, 737.
[3] Vgl. Groß, DÖV 1961, 404 (404).
[4] Vgl. Bayer, Die Bundestreue, 1961, S. 26.
[5] Vgl. Ossenbühl, NVwZ 2003, 53 (53); im Folgenden wird der gebräuchlichere Terminus der Bundestreue jedoch verwendet.
[6] Vgl. Bauer, Die Bundestreue, 1992, S. 38 ff.
[7] Deutscher Staats- und Kirchenrechtler, * 15.01.1892, † 05.07.1975; vgl. Bickenbach, JuS 2005, 588 (588 f.).
[8] Vgl. Smend, Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchischen Bundesstaat – Staatsrechtliche Abhandlungen, 2. Aufl. (1968), S. 51.
[9] Smend (o. Fußn. 8), S. 51.
[10] Vgl. Smend (o. Fußn. 8), S. 56.
[11] Vgl. Unruh, EuR 2002, 41(50).
[12] Vgl. Bayer (o. Fußn. 4), S. 20 f.
[13] Siehe Art. 35, 36, 72 II, 106 III, IV, 109 I GG; bestätigt durch BVerfGE 34, 216 (232) = NJW 1973, 609.
[14] BVerfGE 1, 299 (315) = NJW 1952, 737.
[15] In der Fassung vor dem Gesetz zur Änderung des GG vom 27.10.1994.
[16] Vgl. Bleckmann, JZ 1991, 900 (901).
[17] Vgl. Bauer (o. Fußn. 6), S. 237 ff.
[18] Sachs, in: Sachs, GG, 3. Aufl. (2003), Art. 20 Rdnr. 68.
[19] Vgl. Herzog, in: Maunz/Dürig, GG III, 1992, Art. 20 IV Rdnr. 63.
[20] Vgl. BVerfGE 1, 299 (315) = NJW 1952, 737.
[21] Vgl. BVerfGE 43, 291 (348) = NJW 1977, 1282.
[22] Vgl. Unruh, EuR 2002, 41 (52).
[23] Unruh, EuR 2002, 41 (53).
[24] Vgl. Unruh, EuR 2002, 41 (53).
[25] Vgl. Smend (o. Fußn. 8), S. 51.
[26] Vgl. Degenhart, Staatsrecht I – Staatsorganisationsrecht, 20. Aufl. (2004), Rdnr. 224a.
[27] Vgl. Bauer (o. Fußn. 6), S. 284.
[28] Vgl. Sachs (o. Fußn. 18), Art. 20 Rdnr. 70.
[29] Vgl. Degenhart (o. Fußn. 26), Rdnr. 220.
[30] BVerfGE 73, 118 (196) = NJW 1987, 239.
[31] Vgl. BVerfGE 73, 118 (196 f.) = NJW 1987, 239.
[32] Vgl. Degenhart (o. Fußn. 26), Rdnr. 223.
[33] Vgl. BVerfGE 81, 310 (337 f.) = NJW 1990, 3007.
[34] Vgl. Steinberg, NJW 1987, 2345 (2345).
[35] Vgl. Unruh, EuR 2002, 41 (57).
[36] Vgl. Streinz, in: Isensee/Kirchhof, HdbStR VII, 1992, § 182 Rdnr. 44.
[37] Vgl. Streinz, Europarecht, 7. Aufl. (2005), Rdnr. 541.
[38] Vgl. Dederer, NVwZ 2001, 258 (261).
[39] Grundlegend EuGH, Slg. 1991, 5357 = EuZW 1991, 758.
[40] Vgl. Bauer (o. Fußn. 6), S. 340 f.
[41] Im Ergebnis auch BVerwGE 104, 29 (35) = NJW 1998, 471.
[42] Vgl. BVerfGE 92, 203 (231) = EuZW 1995, 277.
[43] EuGH, Slg. 1973, 101 (115) = EuR 1973, 226.
[44] BVerfGE 89, 155 (202) = NJW 1993, 3047.
[45] Vgl. Wuermeling, EuR 1987, 237 (240).
[46] Vgl. Zuleeg, NJW 2000, 2846 (2847).
[47] Vgl. Lasok, Law and Institutions of the European Union, 7. Aufl. (2001), S. 51.
[48] Vgl. Lenaerts/Nuffel, Constitutional Law of the European Union, 1999, S. 410 Rdnrn. 10-11.
[49] Vgl. Verhoeven, Droit de la Communauté Européenne, 1996, S. 335.
[50] Vgl. EuGH, Slg. 1983, 255 (287) = DVBl 1983, 691; EuGH, Slg. 1989, 3700 (3706).
[51] Vgl. Geiger, EGV, 3. Aufl. (2000), Art. 10 Rdnr. 1.
[52] Vgl. Bleckmann, Europarecht, 6. Aufl. (1997), Rdnr. 685.
[53] Vgl. Streinz (o. Fußn. 37), Rdnr. 162 f.
[54] Vgl. Kahl, in: Calliess/Ruffert, EGV, 1999, Art. 10 Rdnr. 4.
[55] Vgl. Bleckmann (o. Fußn. 52), Rdnr. 685.
[56] Vgl. Bleckmann (o. Fußn. 52), Rdnr. 698.
[57] Die EU ist basierend auf der Subsidiarität von föderalistischer Natur; vgl. Häberle, AöR 1994, 169 (186).
[58] Vgl. Kahl (o. Fußn. 54), Art. 10 Rdnr. 6.
[59] Kahl (o. Fußn. 54), Art. 10 Rdnr. 11.
[60] Vgl. Häberle, DÖV 2003, 429 (429).
[61] Vgl. Unruh, EuR 2002, 41 (61).
[62] Vgl. Unruh, EuR 2002, 41 (62).
[63] Vgl. Kahl (o. Fußn. 54), Art. 10 Rdnrn. 7 ff.
[64] Vgl. Kahl (o. Fußn. 54), Art. 10 Rdnrn. 19 ff.
[65] Vgl. Unruh, EuR 2002, 41 (63).
[66] Vgl. Bleckmann, DVBl 1976, 483 (486).
[67] Vgl. Kahl (o. Fußn. 54), Art. 10 Rdnrn. 45 ff.
Häufig gestellte Fragen zu "Treueverhältnisse im Föderalismus"
Was ist die Bundestreue?
Die Bundestreue ist ein ungeschriebener Verfassungsgrundsatz, der Bund und Länder zur gegenseitigen Rücksichtnahme und Unterstützung in der Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet. Sie dient als Kitt im föderalen System, um Konflikte zu minimieren und das Auseinanderbrechen des Bundesstaates zu verhindern.
Woher kommt der Begriff Bundestreue?
Die Idee der Bundestreue reicht bis ins Deutsche Reich von 1871 zurück. Maßgeblich für das heutige Verständnis war Rudolf Smends Aufsatz von 1916, der die Bundestreue als ungeschriebenes Verfassungsrecht begründete, das die Lücken des geschriebenen Rechts ergänzt.
Worauf basiert die Bundestreue?
Die Bundestreue wird primär aus dem Bundesstaatsprinzip (Art. 20 GG) abgeleitet. Sie gilt als Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Verhältnis zwischen Bund und Ländern.
Welche Rechtsfolgen hat die Bundestreue?
Die Bundestreue ist eine akzessorische und nachrangige Pflicht. Sie begründet keine eigenen Rechte und Pflichten, sondern wirkt innerhalb bestehender Rechtsverhältnisse. Sie manifestiert sich in Kompetenzausübungsschranken und Verfahrenspflichten und beeinflusst den Vollzug von Gemeinschaftsrecht.
Was sind klassische Fallgruppen der Bundestreue?
Klassische Fallgruppen sind die Kompetenzausübungsschranke, bei der Bund und Länder ihre Kompetenzen nicht egoistisch ausüben dürfen, sowie Verfahrenspflichten, die die Art und Weise des Vorgehens in Fragen von gesamtstaatlichem Interesse regeln.
Was ist die Unionstreue?
Die Unionstreue, auch Gemeinschaftstreue genannt, ist ein Rechtsgrundsatz des Unionsrechts, der die Mitgliedsstaaten zur loyalen Zusammenarbeit mit der Europäischen Union verpflichtet. Sie leitet sich aus Art. 4 Abs. 3 EUV (früher Art. 10 EG) ab.
Wie ist die Unionstreue entstanden?
Die Unionstreue wurde durch Entscheidungen des EuGH entwickelt, der den Inhalt des Art. 10 EG präzisierte und Treuepflichten zwischen den Mitgliedsstaaten und der EG begründete.
Worauf basiert die Unionstreue?
Die Unionstreue basiert auf Art. 4 Abs. 3 EUV und wird als pars pro toto-Regelung verstanden, die über die bloßen Vertragserfüllungspflichten hinausgeht und ein allgemeines Rücksichtnahmegebot beinhaltet.
Welche Rechtsfolgen hat die Unionstreue?
Die Unionstreue ist rechtlich verbindlich und justiziabel. Verstöße können mit einer Vertragsverletzungsklage geahndet werden. Sie wirkt dreidimensional und gilt im Rahmen bestehender Rechtsverhältnisse. Sie manifestiert sich in Handlungs- und Unterlassungspflichten, wie die Pflicht zur Konsultation und Information.
Was sind Handlungs- und Unterlassungspflichten im Rahmen der Unionstreue?
Handlungspflichten sind z.B. die Pflicht zur Konsultation und Information, Beistand und Solidarität. Unterlassungspflichten beinhalten ein allgemeines Beeinträchtigungsverbot gegenüber der EU sowie eine Kompetenzausübungsschranke, die Rechtsmissbrauch verbietet.
- Quote paper
- Dipl.-Jur. Univ. Stephan Hofbeck (Author), 2006, Treueverhältnisse im Föderalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110478