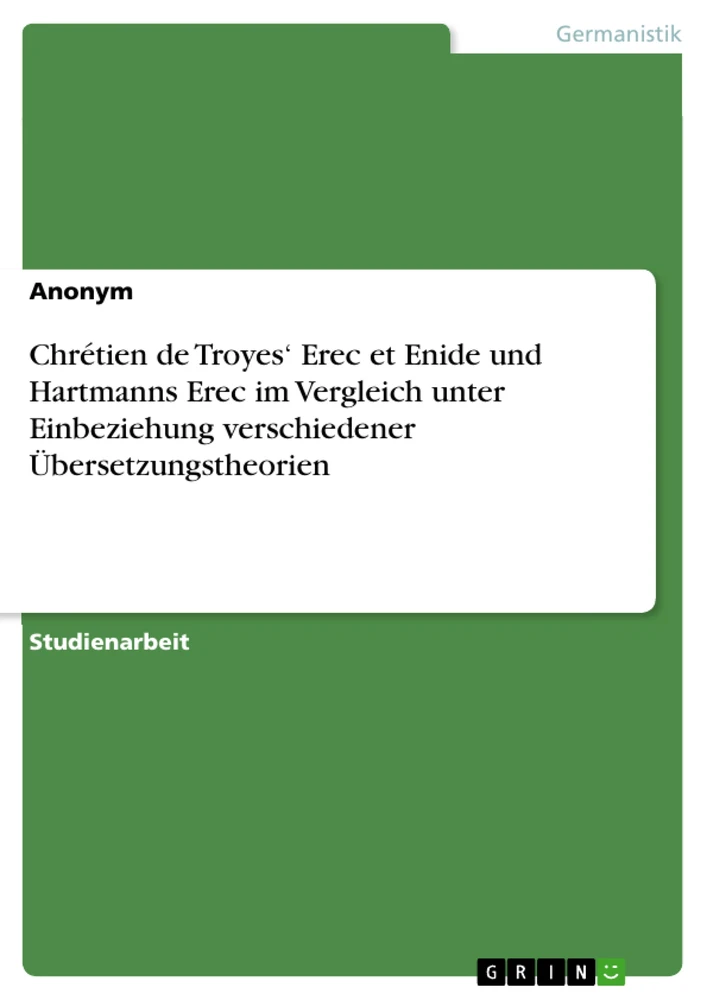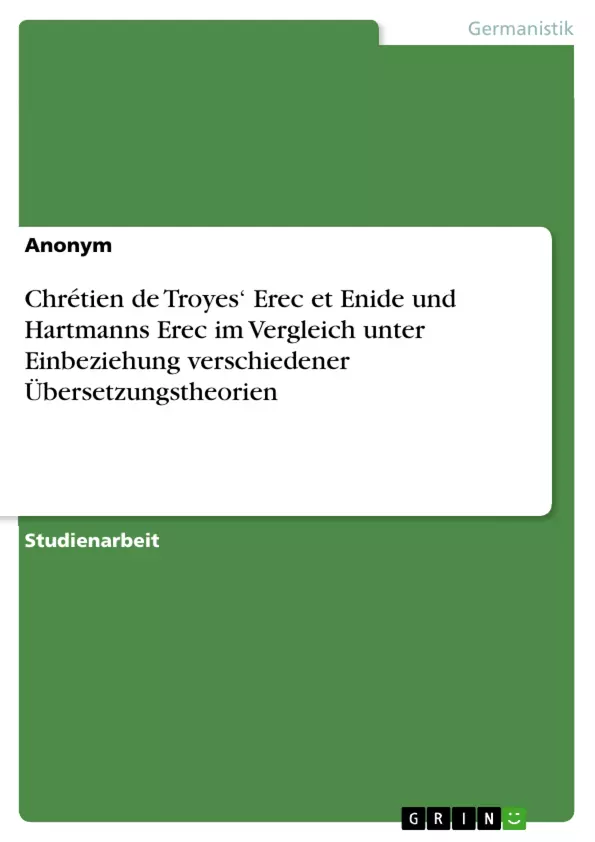Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich mit dem Artusroman "Erec et Enide" (Chretien de Troyes) und der deutschen Übersetzung Hartmanns von Aue. Zunächst werden generelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Romane beleuchtet. Dazu werden verschiedene Übersetzungstheorien herangezogen und es wird der Versuch angestellt, diese Theorien der Übersetzung Hartmanns zuzuordnen.
Hartmann von Aue, dessen Schaffenszeit auf 1180-1200 datiert wird, gehört zu den bedeutungsvollsten und beliebtesten Autoren des Mittelalters. Seine Texte spiegeln die adelige Welt um 1200 wider, Sprache, Form und Aufbau entsprechen dem, was die höfische Literatur dieser Zeit ausmachte. Im deutschsprachigen Raum kann Hartmann von Aue als Schöpfer der Gattung des Artusromans gesehen werden, viele später bedeutende Autoren orientierten sich an seinen Werken. Zu seiner Person lässt sich kaum etwas sagen, alle Angaben die in späteren Texten über ihn gemacht wurden, gehen über Spekulationen nicht hinaus. Der Charakteristik seiner Reimsprache und weiteren Angaben von Heinrich von Türlin nach, kam er aus Südwestdeutschland und kann an einem der Adelshöfe zwischen dem Bodensee und der Schwäbischen Alb verortet werden. Dass er hochgebildet war, wird durch die selbstreflexiven Äußerungen in den Prologen des Iwein und des Armen Heinrich deutlich. Er verfügte über ein makelloses Französisch, welches ihm die Adaptionen seiner Artusromane möglich machte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Übersetzungstheorien
- 2.1 Martin Luther: Einbürgerung
- 2.2 Friedrich Schleiermacher: Verfremdung
- 2.3 Johann Wolfgang Goethe: Schlicht-prosaische, parodistische und identifizierende Übersetzungstheorie
- 2.4 Wilhelm von Humboldt: Verfremdung
- 2.5 Worstbrock: Wiedererzählen
- 3. Vergleich zwischen Chrétiens und Hartmanns Roman unter Einbezug der Übersetzungstheorien
- 3.1 Adaption Courtoise
- 3.2 Enites zweites Pferdegeschenk
- 3.3 Erzählkonzeptionen und Erzählwelten bei Hartmann und Chrétien
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Hartmanns Erec im Vergleich zu Chrétiens Erec et Enide und analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Texte unter Einbezug verschiedener Übersetzungstheorien. Die Arbeit beleuchtet, inwiefern sich Hartmanns Adaption von Chrétiens Werk als eine eigenständige literarische Schöpfung betrachten lässt und welche Rolle die Übersetzungstheorien im Vergleich der beiden Werke spielen.
- Adaptionsstrategien von Hartmann von Aue
- Vergleich der Erzählkonzeptionen und Erzählwelten der beiden Werke
- Anwendung verschiedener Übersetzungstheorien auf die Adaption des Erec
- Einfluss von Chrétiens Erec et Enide auf Hartmanns Erec
- Analyse der spezifischen Veränderungen, die Hartmann in seinem Erec vornimmt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die Entstehungszeit und die Relevanz von Hartmanns Erec und stellt die Überlieferungssituation des Textes dar. Es wird auf die unterschiedlichen Ausmaße der beiden Romane hingewiesen und die Frage nach den Ursachen für diese Diskrepanz aufgeworfen. Das zweite Kapitel widmet sich den verschiedenen Übersetzungstheorien, die in der Arbeit zur Analyse des Erec-Vergleichs herangezogen werden. Kapitel drei fokussiert den Vergleich zwischen Chrétiens und Hartmanns Roman unter Einbezug der vorgestellten Übersetzungstheorien. Es werden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede im Hinblick auf die Adaption, spezifische Elemente der Handlung sowie die Erzählkonzeptionen und Erzählwelten der beiden Werke dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Übersetzungstheorie, Artusroman, Adaption, Chrétien de Troyes, Hartmann von Aue, Vergleichende Literaturwissenschaft, Erec et Enide, Erec, deutschsprachige Literatur, Mittelalterliche Literatur, Erzählkonzeption, Erzählwelt, Handlungsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Chrétiens und Hartmanns Erec?
Hartmann adaptiert den französischen Stoff für ein deutsches Publikum, verändert Erzählwelten und fügt eigene Reflexionen zur höfischen Welt hinzu.
Welche Übersetzungstheorien werden im Vergleich genutzt?
Die Arbeit zieht Theorien von Martin Luther (Einbürgerung), Schleiermacher (Verfremdung) und Goethe herbei, um Hartmanns Vorgehen zu analysieren.
Was versteht man unter "Adaption Courtoise"?
Es bezeichnet die höfische Anpassung eines Stoffes an die gesellschaftlichen Ideale und literarischen Normen des Adels um 1200.
Wer war Hartmann von Aue?
Ein hochgebildeter Dichter des Mittelalters, der als Schöpfer des deutschsprachigen Artusromans gilt und fließend Französisch beherrschte.
Wie wird Enites Rolle im Vergleich dargestellt?
Die Arbeit untersucht spezifische Szenen, wie das Pferdegeschenk, um die Unterschiede in der Figurendarstellung und Symbolik aufzuzeigen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Chrétien de Troyes‘ Erec et Enide und Hartmanns Erec im Vergleich unter Einbeziehung verschiedener Übersetzungstheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1105467