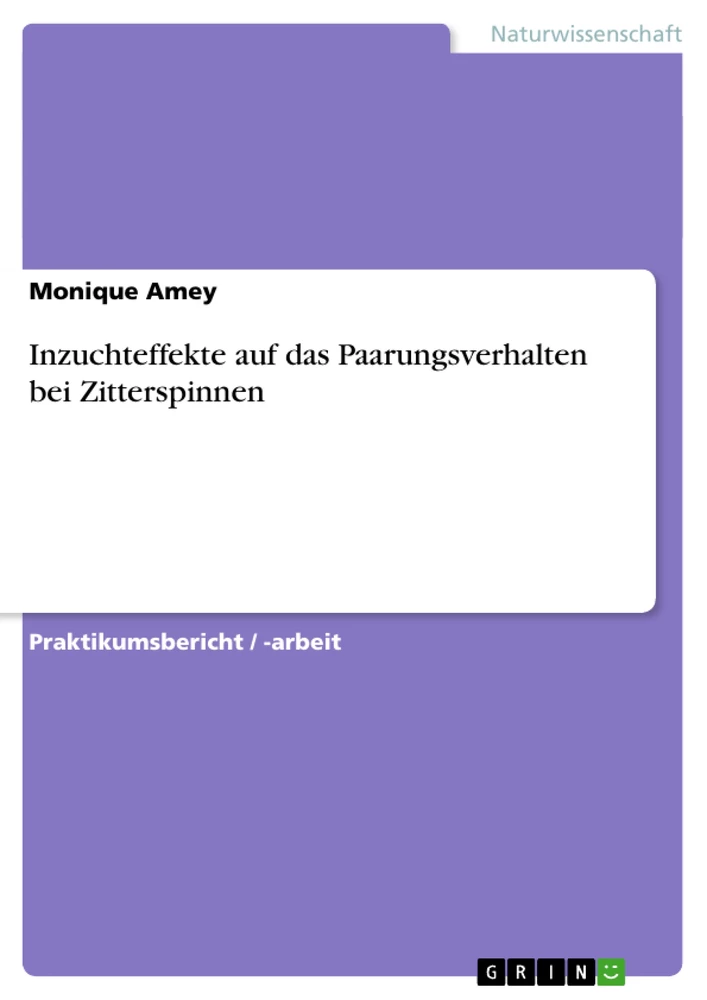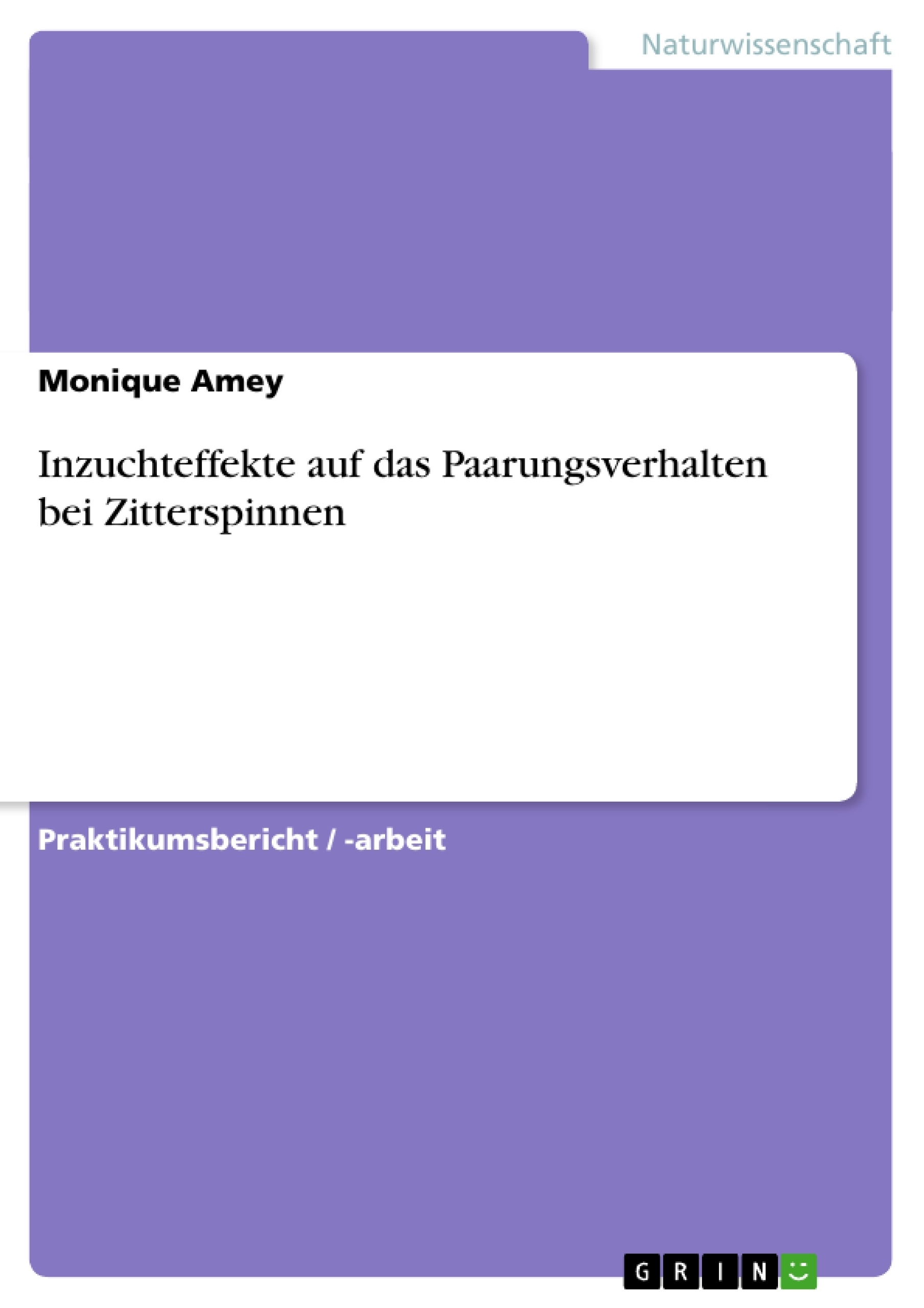Bisher wurden in mehreren Studien an der Zitterspinne (Pholcus phalangioides) das Paarungsverhalten und im Besonderen das Phänomen Polyandrie untersucht. Da die Zitterspinne ein gewisses Inzuchtpotential aufweist, beschäftigten wir uns in unserem Versuch mit der Frage, ob Inzucht einen Effekt auf das Paarungsverhalten hat.
Genauer untersuchten wir, ob Inzucht die Anzahl Tasterbewegungen und somit auch den Vaterschaftserfolg beeinflusst, oder welche Rolle Inzucht beim Abbruch der Kopulation im Bezug auf die Geschlechter spielt. Eine der wichtigsten Fragestellungen bestand darin, ob Inzucht einen Einfluss auf die Wiederpaarungswarscheinlichkeit hat.
Wir führten Doppelverpaarungen durch, wobei wir zuerst verwandte und nicht verwandte Tiere in getrennten Gruppen verpaart haben. Bei dieser Erstverpaarung hatte die Verwandtschaft keinen Effekt auf die Akzeptanz des Partners. Es kopulierten 100% der Versuchstiere.
Bei der Wiederverpaarung, bei der Verpaarungen mit nicht verwandten Männchen durchgeführt wurden, waren die Weibchen wesentlich wählerischer und ließen weniger oft eine Kopulation zu. Es konnte allerdings kein direkter Zusammenhang mit Inzuchteffekten hergestellt werden.
Die Anzahl Tasterbewegungen sowie der geschlechterabhängige Abbruch der Kopulation konnten nicht auf Inzucht zurückgeführt werden.
Bei der Kopulationsdauer der Wiederverpaarung zeigte sich, dass Weibchen, die sich bei der Erstverpaarung mit einem Verwandten gepaart haben, eine längere Kopulation zulassen als die normal verpaarten Weibchen.
Ist dieses Verhalten eine Strategie zur Inzuchtvermeidung? Im Gegensatz zur Erstverpaarung hat die Wiederverpaarungsdauer für den Vaterschaftserfolg des jeweiligen Männchens eine Bedeutung, da bekannt ist, dass die Anzahl der Tasterbewegungen in den wenigen Minuten der Zweitverpaarung den Anteil an der Nachkommenschaft bestimmt.
Zusammenfassung:
Bisher wurden in mehreren Studien an der Zitterspinne (Pholcus phalangioides) das Paarungsverhalten und im Besonderen das Phänomen Polyandrie untersucht. Da die Zitterspinne ein gewisses Inzuchtpotential aufweist, beschäftigten wir uns in unserem Versuch mit der Frage, ob Inzucht einen Effekt auf das Paarungsverhalten hat.
Genauer untersuchten wir, ob Inzucht die Anzahl Tasterbewegungen und somit auch den Vaterschaftserfolg beeinflusst, oder welche Rolle Inzucht beim Abbruch der Kopulation im Bezug auf die Geschlechter spielt. Eine der wichtigsten Fragestellungen bestand darin, ob Inzucht einen Einfluss auf die Wiederpaarungswarscheinlichkeit hat.
Wir führten Doppelverpaarungen durch, wobei wir zuerst verwandte und nicht verwandte Tiere in getrennten Gruppen verpaart haben. Bei dieser Erstverpaarung hatte die Verwandtschaft keinen Effekt auf die Akzeptanz des Partners. Es kopulierten 100% der Versuchstiere.
Bei der Wiederverpaarung, bei der Verpaarungen mit nicht verwandten Männchen durchgeführt wurden, waren die Weibchen wesentlich wählerischer und ließen weniger oft eine Kopulation zu. Es konnte allerdings kein direkter Zusammenhang mit Inzuchteffekten hergestellt werden.
Die Anzahl Tasterbewegungen sowie der geschlechter-abhängige Abbruch der Kopulation konnten nicht auf Inzucht zurückgeführt werden.
Bei der Kopulationsdauer der Wiederverpaarung zeigte sich, dass Weibchen, die sich bei der Erstverpaarung mit einem Verwandten gepaart haben, eine längere Kopulation zulassen als die normal verpaarten Weibchen.
Ist dieses Verhalten eine Strategie zur Inzuchtvermeidung? Im Gegensatz zur Erstverpaarung hat die Wiederverpaarungsdauer für den Vaterschaftserfolg des jeweiligen Männchens eine Bedeutung, da bekannt ist, dass die Anzahl der Tasterbewegungen in den wenigen Minuten der Zweitverpaarung den Anteil an der Nachkommenschaft bestimmt.
Einleitung:
In verschiedenen Verhaltensstudien an der Zitterspinne hat man festgestellt, dass sie sich mehrfach verpaart. Dabei kann Polyandrie der Steigerung der weiblichen Fitness (Ridley 1993 cit. In Zeh & Zeh 2001), der Steigerung des Vaterschaftserfolges durch einen entstehenden Spermienwettbewerb (Watson 1991; Madsen et al. 1992, Birkhead et al.1993 cit. in Zeh & Zeh 2001), der Risikostreuung bei der Wahl des Partners (Watson 1991, 1998 cit. In Zeh & Zeh 2001) sowie der Inzuchtvermeidung (Zeh & Zeh 1996, 1997 cit. In Zeh & Zeh 2001) dienen. Es stellte sich die Frage, ob Polyandrie eine Strategie zur Inzuchtvermeidung ist, da es anscheinend gleichzeitig mit Polyandrie ein gewisses Inzuchtpotential gibt, wie auch im Fall der Zitterspinne.
Allerdings gibt es zu diesem Thema nur wenig Literatur.
Nicht nur wegen des vorhandenen Inzuchtpotentials, sondern auch aufgrund einer reduzierten Akzeptanz der Weibchen gegenüber den Männchen bei der Wiederverpaarung, eignet sich die Zitterspinne sehr gut für unsere Versuche.
Die weiblichen Spinnen sind zum Teil sehr aggressiv und wehren jegliche Kopulationsversuche der Männchen ab. Es galt zu klären, ob Inzucht bei diesem Vehalten eine Rolle spielt oder nicht. Ebenso sollte bestimmt werden, welchen Einfluß Inzucht auf den Vaterschaftserfolg hat, denn hier sind die bestimmenden Verhaltensweisen bekannt. Die Tasterbewegungen sind für den Anteil an der Vaterschaft entscheidend, da sie mit der Spermienübertragung korrellieren (Uhl, unveröff.).
Weiterhin wurde überprüft, inwiefern sich die Kopulationsdauer im Falle der Inzucht gegenüber normaler Kopulationen verändert. Dazu wurden im Versuch Weibchen mit verwandten Männchen verpaart und andere Weibchen mit nichtverwandten Männchen. Von beiden Gruppen haben wir das Kopulationsverhalten registriert und verglichen.
Für unsere Auswertung stellten wir folgende Überlegungen an: Reagieren die Weibchen auf die Verpaarung mit Brüdern, indem sie sich mit größerer Wahrscheinlichkeit wiederverpaaren? Oder reagieren Männchen auf die Verpaarung mit Schwestern, indem sie weniger Tasterbewegungen ausüben?
Die Ergebnisse unseres Versuches deuten darauf hin, dass es keine Inzuchteffekte auf das Paarungsverhalten der Zitterspinne gibt. Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass sich Inzucht auf einzelne Verhaltensmerkmale auswirkt.
Methoden:
Pholcus phalangioides
Die Zitterspinne (Pholcus phalangioides) ist ein Kosmopolit und zählt zur Familie der Pholcidae. Sie kann bis zu drei Jahren alt werden und ist ganzjährig mit geschlechtsreifen Tieren vertreten. Ihr Körper wird 0,7 bis 1 cm groß, während ihre Beine eine Länge von bis zu 5 cm erreichen können. Sie ist grau-weiß gefärbt mit bräunlicher Zeichnung an Vorder- und Hinterleib.
Der Name Zitterspinne leitet sich von Ihrem interessanten Verhalten ab, das als Abwehrfunktion gegen Räuber dient. Durch eine heftige kreisförmige Schwingbewegung, verschwinden ihre Umrisse, was dem Fraßfeind das Ausmachen der Spinne optisch erschwert.
Die Geschlechtsorgane der Weibchen und Männchen zeigen deutliche Unterschiede. Männchen verfügen über große Pedipalpen, mit deren Hilfe die Spermien übertragen werden. Sie tragen sie wie "Boxhandschuhe“ am Kopfende. Die Weibchen hingegen weisen nur kleine beinartige Taster auf. Ihre Genitalöffnung befindet sich ventral am Hinterleib. Nach der Eiablage tragen sie die rund 40 Eier in einem hauchdünnen Seidenkokon mit Hilfe der Mundwerkzeuge mit sich (NABU NRW 2003).
Versuchstiere und Haltungsbedingungen
Insgesamt wurden 31 weibliche Spinnen für die Verpaarungen verwendet. Sie wurden in sogenannten Paarungsbehältern gehalten. Die für die jeweiligen Verpaarungen verwendeten Männchen wurden in Extrabehältern gehalten und für die Versuche in den Behälter der Weibchen gesetzt (Schäfer, Uhl 2002).
Versuchsdurchführung
Die Tiere wurden vor dem Versuch in zwei Gruppen eingeteilt, und zwar in die Gruppe N für nicht verwandt bei der Erstverpaarung und in Gruppe V für verwandt bei der Erstverpaarung. Diese Einteilung ist vom Versuchsleiter vorgenommen worden, ohne dass die Verwandtschaft bei der Durchführung des Versuches für die Praktikanten bekannt war. Die Gruppe N enthielt 16 Weibchen und Gruppe V enthielt 15 Weibchen. Diese wurden jeweils mit einem Männchen erstverpaart und alle Weibchen mit jeweils einem nichtverwandten Männchen wiederverpaart. Die Wiederverpaarung erfolgte jeweils einen Tag später. Fand keine Kopulation statt, wurden nach 1.5 Stunden die Tiere wieder getrennt. Auch wenn das Männchen gebalzt hat, aber nicht vom Weibchen akzeptiert wurde, erfolgte die Trennung. Im Versuch kopulierte jedes Männchen nur einmal oder gar nicht.
Datenanalyse
Es wurden folgende Größen gemessen: Größe und Masse der Tiere, wobei die Größe anhand des Abstandes zwischen Patella und Tibia des ersten Beinpaares bestimmt wurde und die Masse bei den Weibchen, die nach der zweiten Kopulation gemessen wurde. Weiterhin wurden aufgenommen: der Zeitpunkt des Zusammensetztens und der Kopulationsbeginn, wobei hier das Einführen der Pedipalpen des Männchen in die Geschlechtsöffnung des Weibchens als Startpunkt der Kopulation gilt. Die Kopulations-dauer in Minuten und die Anzahl der Tasterbewegungen pro 3 min Intervall sind ebenfalls wichtige Daten, die erhoben wurden.
Die statistischen Analysen unserer Daten erfolgte mit Hilfe des Computerprogrammes SPSS 10.0. Es wurden zweiseitige Tests mit einem Signifikanzlevel von a = 0,05 angewandt.
Die Daten Kopulationsdauer und Anzahl Tasterbewegungen erwiesen sich als normalverteilt (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest), weshalb wir hier für die weitere Analyse den T-Test verwendeten. Bei diesen Daten sind die Standardfehler (SE) der Mittelwerte angegeben.
Ergebnisse:
Größenvergleich / Massenvergleich
Zu Beginn unserer Tests überprüften wir, ob die Größe, Masse und das Alter der Versuchstiere in den Gruppen “Verwandt” und “Nicht Verwandt” eine Rolle spielen.
Aufgrund zeitgleicher Züchtungen, konnte das Alter als beeinflussender Faktor ignoriert werden. Es besteht auch kein signifikanter Unterschied in der Größe zwischen den Gruppen “Verwandt” und “Nicht Verwandt” bei den Männchen, welche für die Erstverpaarung verwendet wurden (U-Test, n1=14, n2=14, U=84, p=0,52).
Die Größen der Männchen beider Gruppen bei der Wiederverpaarung weichen nicht signifikant voneinander ab (U-Test, n1=15, n2=14, U=97, p=0,73).
Bei den Weibchen beider Gruppen findet man keinen signifikanten Unterschied in der Größe (U-Test, n1=15, n2=14, U=100, p=0,83).
Die Masse der Weibchen beider Gruppen unterscheidet sich nicht signifikant (U-Test, n1=14, n2=14, U=84,5, p=0,53).
Man kann also ausschließen, dass die Größe bzw. Masse der unterschiedlichen Männchen und Weibchen in unserem Versuch eine Rolle spielen.
Verpaarungswahrscheinlichkeit
Bei der Erstverpaarung kommt es bei 100 Prozent der Versuchstiere zur Kopulation.
Es stellt sich bei der Wiederverpaarung die Frage: Unterscheiden sich die Gruppen V und N in ihrer Verpaarungswahrscheinlichkeit?
Die Tiere der Gruppe V verpaaren sich zu 80% wieder, während sich die Tiere aus der Vergleichsgruppe N nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ein zweites Mal verpaaren.
Im Test zeigte sich, dass sich die Gruppen nicht signifikant voneinander unterscheiden (Chi2-Test, Chi2=3,04, df=1, p=0,08).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: Wiederverpaarungs-Wahrscheinlichkeit der Tiere aus den Gruppen N und V
Kopulationsdauer
Um herauszufinden, ob sich die Gruppen N und V in ihrer Kopulationsweise unterscheiden, haben wir die Kopulationsdauer registriert und verglichen.
Frage: Gibt es einen Unterschied in der Kopulationsdauer der Gruppen N und V bei der ersten bzw. zweiten Kopulation?
Bei der ersten Kopulation haben sich die Tiere der Gruppen N und V in etwa gleich lang verpaart. Die Kopulationsdauer für N beträgt im Durchschnitt 49,2 ± 6,03 Minuten und für Gruppe V 51,3 ± 7,94 Minuten.
Für die Erstverpaarung zeigte sich, dass die Gruppen N und V nicht signifikant in ihrer Kopulationsdauer variierten (T-Test, T=-0,22, n1=16, n2=15, p=0,83) (Abb. 2). Die Wiederverpaarungsdauer ist erheblich kürzer als die der Erstverpaarung.
Bei den „nicht verwandten“ Tieren beträgt diese im Durchschnitt 3,5 ± 0,46 Minuten; bei den „Verwandten“ dauert die zweite Verpaarung durchschnittlich 5,6 ± 0,60 Minuten.
Bei der Wiederverpaarung besteht ein signifikanter Unterschied in der Kopulationsdauer der Gruppen N und V (T-Test, T=-2,52, n1=8, n2=12, p=0,02) (Abb. 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Durchschnittliche Kopulationdauer der Gruppen N und V bei der 1. Verpaarung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Durchschnittliche Kopulationsdauer der Wiederverpaarung bei N und V
Tasterbewegungen
Anhand der Abb. 4 ist zu erkennen, dass während der ersten 15 Minuten der Kopulation deutlich mehr Tasterbewegungen ausgeführt werden als in der restlichen Kopulationszeit. In den ersten Minuten finden durchschnittlich 20 Bewegungen statt, während sich im weiteren Verlauf der Wert auf 1 bis 2 Bewegungen pro 3 min Intervall einpendelt.
Im Durchschnitt dauert eine Erstverpaarung rund 50 Minuten. Die Kopulationsdauer variiert von 15 Minuten bis 105 Minuten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Anzahl Tasterbewegungen bei der Erstverpaarung eingeteilt in 3 min Intervalle
Wir untersuchten die Fragestellung: Gibt es Unterschiede in der Anzahl der Tasterbewegungen bei der ersten Kopulation zwischen den Gruppen V und N ?
In Abb. 5 wird deutlich, dass es keinen großen Unterschied in Anzahl Tasterbewegungen zwischen den Gruppen N und V gibt. Gruppe N tätigt im Durchschnitt 131 ± 12,72 Bewegungen und Gruppe V 119 ± 8,4.
Wir stellten fest, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen N und V im Bezug auf die Anzahl der Tasterbewegungen gibt ( T-Test, T=0,79, n1=16, n2=15, p=0,45) (Abb.5).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Durchschnittliche Anzahl Tasterbewegungen von V und N bei der Erstverpaarung
Den gleichen Test führten wir für die zweite Kopulation durch und stellten keine Signifikanz fest (T-Test, T=-1,35, n1=8, n2=12, p=0,20).
Gruppe V hat mit 29 ± 3,21 eine etwas höhere Anzahl an Bewegungen als Gruppe N mit 23 ± 2,85 (Abb. 6).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Durchschnittliche Anzahl der Tasterbewegungen bei der Wiederverpaarung von N und V
Abbruch der Kopulation
Gibt es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern der Gruppen N und V im Bezug auf den Abbruch der Kopulation bei der ersten und zweiten Verpaarung?
Der Anteil der Weibchen beider Gruppen liegt hier etwas über dem der Männchen, d.h. in Gruppe N brechen 7 Männchen gegenüber 9 Weibchen ab, in Gruppe V sind es 7 Männchen und 8 Weibchen.
Wir kamen zu dem Ergebnis, dass die Gruppen der Erstverpaarung nicht signifikant voneinander abweichen, d.h. es brechen in etwa gleich viele Männchen wie Weibchen die erste Kopulation ab (Chi2-Test, Chi2=0,027, df=1, p=0,87) (Abb.7).
Der Faktor „Verwandt“oder „Nicht Verwandt“ spielte hier also keine Rolle.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: Abbruch der Kopulation der Männchen bzw. Weibchen aus den Gruppen V und N im Vergleich (Erstverpaarung)
Bei der Wiederverpaarung wurde der gleiche Test angewandt mit dem Ergebnis, dass sich auch hier kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen N und V ergab (Chi2-Test, Chi2=0,093, df=1, p=0,76) (Abb.8). An dieser Graphik wird deutlich, dass sich die Gruppen N und V in der Verteilung von Männchen und Weibchen nicht unterscheiden. In beiden Gruppen brechen viel weniger Männchen als Weibchen die Kopulation ab.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Abbruch der Kopulation der Männchen bzw. Weibchen der Gruppen N und V im Vergleich (Wiederverpaarung)
Man kann also den Faktor Verwandtschaft hier ebenfalls ausschließen, was uns veranlasste, diese Variable zu ignorieren und nur die erste und zweite Verpaarung einander gegenüber zu stellen.
Wir untersuchten, ob es eine Signifikanz im Abbruch der verschiedenen Geschlechter bei der Erst- und Wiederverpaarung gibt. Das Verhältis Männchen zu Weibchen in Bezug auf den Kopulationsabbruch war bei der Erstverpaarung 14:17 und bei der Wiederverpaarung 2:18.
Es besteht ein signifikanter Unterschied: in der Wiederverpaarung brechen viel mehr Weibchen die Kopulation ab, als bei der der Erstverpaarung (Chi2-Test, Chi2=6,98, df=1, p=0,008) (Abb. 9).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9: Abbruchhäufigkeit der Männchen und Weibchen bei Erst- und Wiederverpaarung
Diskussion:
Unsere Versuche zeigten keinen direkten bzw. statistisch nachweisbaren Einfluss von Inzucht auf das Paarungsverhalten der Zitterspinne.
Nachdem sich alle Tiere erstverpaart hatten, stellte sich bei der Wiederverpaarung heraus, dass sich die Inzuchtgruppe (V) zwar öfter wiederverpaarte, es sich hierbei aber nicht um ein signifikantes Ergebnis handelt. Die Versuchsgruppen wiesen weder bei der Erst- noch bei der Zweitverpaarung eine unterschiedliche Anzahl an Tasterbewegungen auf. Wir stellten außerdem fest, dass der Abbruch der Kopulation von Männchen oder Weibchen nicht abhängig von der Verwandtschaft ist.
Im Gegensatz zur Erstkopulation unterscheiden sich die verwandten von den nicht verwandten Spinnen signifikant in der Wiederverpaarungsdauer. Die Tiere der Gruppe V kopulierten im Durchschnitt länger als die der Gruppe N. Von entscheidender Bedeutung ist bei der Kopulation die Anzahl der Tasterbewegungen der Männchen. Sie korreliert mit der Menge der übertragenen Spermien, d.h. sie beeinflusst direkt den Vaterschaftserfolg (Uhl unveröff.). Die längere Kopulationszeit bedeutet hier keinen gesteigerten Vaterschaftserfolg, da nicht gleichzeitig mehr Tasterbewegungen durchgeführt wurden. Aus diesem Grund handelt es sich hier nicht um einen Inzuchteffekt.
Der Einfluss von Inzucht auf die Wiederverpaarungswarscheinlichkeit der Zitterspinnen ist in unserem Experiment nicht vollständig geklärt worden. Da das Ergebnis nur knapp über der Signifikanzschwelle lag (p=0,08), müsste überprüft werden, ob sich der Wert mit einer höheren Anzahl an Versuchstieren ändert. In diesem Fall könnte sich herausstellen, dass sich die Inzuchtgruppe eher wiederverpaart als die Gruppe der Nichtverwandten.
In vergangenen Experimenten wurde herausgefunden, dass die Größe der Männchen als auch der Weibchen bei der Kopulation eine wichtige Rolle spielt (Schäfer, Uhl unveröff.). Zum Beispiel führen kleine Männchen im Vergleich zu großen Männchen mehr Tasterbewegungen aus. In unserem Versuch haben wir die Größen der Versuchstiere von Gruppe N und V miteinander verglichen und keinen signifikanten Unterschied festgestellt. Vernachlässigt wurden die Größenunterschiede innerhalb einer Gruppe, welche zur Überdeckung möglicher Inzuchteffekte führen könnten. Aus diesem Grund sollte dieser Faktor in Folgeexperimenten berücksichtigt werden.
Bereits in Studien an der Zauneidechse (Lacerta agilis) wurde beobachtet, dass sich die Tiere mit gleicher Warscheinlichkeit mit nicht Verwandten und mit Verwandten paaren. Bei den Untersuchungen der Inzuchteffekte stellte man fest, dass es phänotypische Auswirkungen in Form von Mißbildungen auf die Nachkommen gibt (Olsson, Gullberg & Tegelström 1996). Bei der Zitterspinne kopulierten die Weibchen bei der Erstverpaarung mit allen Männchen, egal ob diese mit ihnen verwandt waren oder nicht. Diese Beobachtung lässt darauf schließen, dass die Weibchenwahl bei der ersten Kopulation der Zitterspinnen genau wie bei den Zauneidechsen keine Strategie zur Inzuchtvermeidung darstellt.
Was wir in unserem Versuch nicht untersucht haben, ist die Auswirkung von Inzucht auf die Nachkommen oder wie hoch der Vaterschaftsanteil der verwandten Männchen gegenüber den nicht verwandten ist. Diese Fragen könnten in weiteren Versuchen im Bezug auf Inzuchteffekte geklärt werden.
Literaturverzeichnis:
NABU NRW 2003: Spinne des Jahres 2003: Die Große Zitterspinne. www.nabu.de (Weitere Informationen: http://www.arages.de/)
Olsson, M., Gullberg, A. & Tegelström, H. 1996: Malformed offspring, sibling matings and selection against inbreeding in the sand lizard (Lacerta agilis). J. Evol. Biol., 9, 229-242.
Schäfer, M. A. & Uhl, G. 2002: Determinants of paternity success in the spider Pholcus phalangioides (Pholcidae: Araneae): the role of male and female mating behaviour. Behav Ecol Sociobiol, 51, 368-377.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Studie über das Paarungsverhalten der Zitterspinne (Pholcus phalangioides)?
Das Ziel der Studie war es, zu untersuchen, ob Inzucht einen Effekt auf das Paarungsverhalten der Zitterspinne hat, insbesondere auf die Anzahl der Tasterbewegungen (und damit den Vaterschaftserfolg), den Abbruch der Kopulation und die Wahrscheinlichkeit der Wiederverpaarung.
Wie wurde die Studie zur Inzucht beim Paarungsverhalten der Zitterspinne durchgeführt?
Es wurden Doppelverpaarungen durchgeführt. Zuerst wurden verwandte und nicht verwandte Tiere getrennt verpaart. Anschließend wurden alle Weibchen mit nicht verwandten Männchen wiederverpaart. Das Paarungsverhalten wurde beobachtet und verschiedene Parameter wie Kopulationsdauer und Anzahl der Tasterbewegungen wurden gemessen.
Hatte Inzucht einen Einfluss auf die Akzeptanz des Partners bei der Erstverpaarung?
Nein, bei der Erstverpaarung hatte die Verwandtschaft keinen Einfluss auf die Akzeptanz des Partners. 100% der Versuchstiere kopulierten.
Wie unterschied sich die Wiederverpaarung bei verwandten und nicht verwandten Zitterspinnen?
Bei der Wiederverpaarung waren die Weibchen wählerischer und ließen weniger oft eine Kopulation zu. Es konnte kein direkter Zusammenhang mit Inzuchteffekten hergestellt werden. Interessanterweise zeigten Weibchen, die sich bei der Erstverpaarung mit einem Verwandten gepaart hatten, eine längere Kopulationsdauer bei der Wiederverpaarung.
Hat Inzucht die Anzahl der Tasterbewegungen während der Kopulation beeinflusst?
Nein, die Anzahl der Tasterbewegungen konnte nicht auf Inzucht zurückgeführt werden.
Hatte Inzucht einen Einfluss darauf, welches Geschlecht die Kopulation abbrach?
Nein, der geschlechterabhängige Abbruch der Kopulation konnte nicht auf Inzucht zurückgeführt werden. Allerdings brachen bei der Wiederverpaarung deutlich mehr Weibchen die Kopulation ab als bei der Erstverpaarung.
Was bedeutet die längere Kopulationsdauer bei der Wiederverpaarung von verwandten Zitterspinnen?
Es wird spekuliert, dass dies eine Strategie zur Inzuchtvermeidung sein könnte, da die Kopulationsdauer bei der Wiederverpaarung eine Bedeutung für den Vaterschaftserfolg hat. Da aber nicht gleichzeitig mehr Tasterbewegungen durchgeführt wurden, handelt es sich nicht um einen direkten Inzuchteffekt.
Was waren die wichtigsten Ergebnisse der Studie über Inzucht und Paarungsverhalten bei Zitterspinnen?
Die Studie deutet darauf hin, dass es keine direkten Inzuchteffekte auf das Paarungsverhalten der Zitterspinne gibt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Inzucht sich auf einzelne Verhaltensmerkmale auswirkt. Die Wiederverpaarungsdauer war bei den Tieren signifikant länger, die sich bei der Erstverpaarung mit einem Verwandten gepaart hatten.
Welche Faktoren wurden in der Studie kontrolliert, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse korrekt sind?
Die Größe, Masse und das Alter der Versuchstiere wurden verglichen, um sicherzustellen, dass diese Faktoren keinen Einfluss auf das Paarungsverhalten haben. Es konnte ausgeschlossen werden, dass diese Faktoren eine Rolle spielen.
Welche weiterführenden Studien werden vorgeschlagen, um die Auswirkungen von Inzucht auf Zitterspinnen besser zu verstehen?
Es wird vorgeschlagen, die Auswirkungen von Inzucht auf die Nachkommen sowie den Vaterschaftsanteil verwandter Männchen im Vergleich zu nicht verwandten Männchen in weiteren Versuchen zu untersuchen. Außerdem sollten die Größenunterschiede innerhalb einer Gruppe in Folgeexperimenten berücksichtigt werden.
- Arbeit zitieren
- Monique Amey (Autor:in), 2003, Inzuchteffekte auf das Paarungsverhalten bei Zitterspinnen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110550