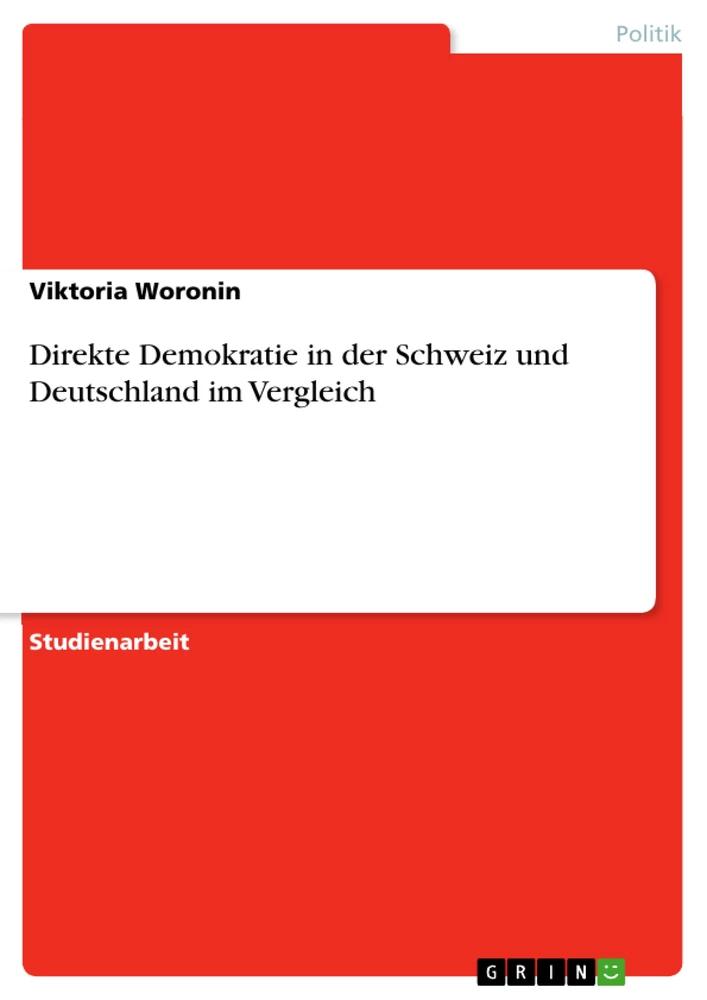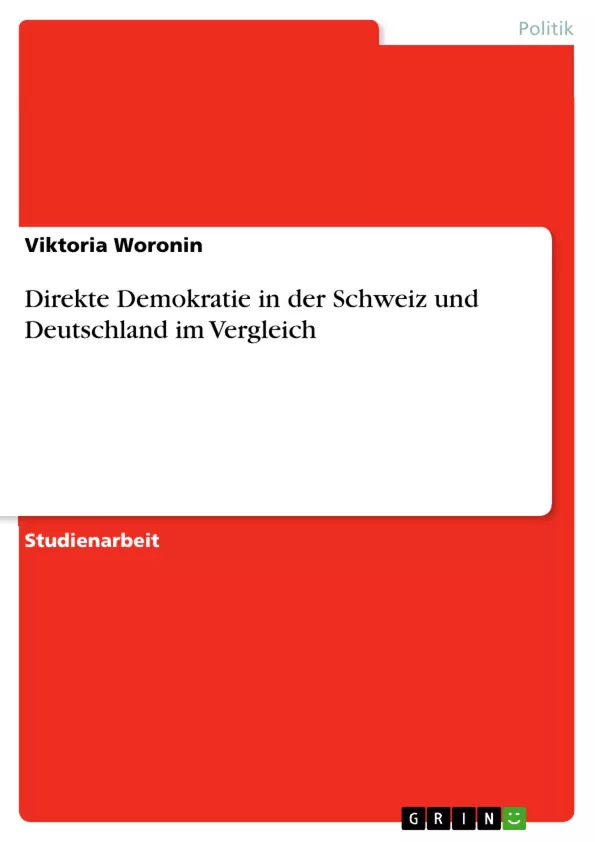Die Fragestellung, der in der vorliegenden Arbeit nachgegangen wird, lautet, inwiefern die Demokratiequalität eines Landes steigt, wenn es Möglichkeiten zur direktdemokratischen Partizipation gibt. Die unabhängigen Variablen sind hierbei die Möglichkeiten, direktdemokratisch partizipieren zu können und die abhängige Variable ist die Demokratiequalität. Dabei sollen zwei Hypothesen verifiziert beziehungsweise falsifiziert werden, wovon die erste lautet: Wenn BürgerInnen viele Möglichkeiten zur direktdemokratischen Partizipation haben, ist die Demokratiequalität hoch. Die zweite lautet: Es ist zu erwarten, dass die Demokratiequalität in Deutschland steigt, wenn es Möglichkeiten zur direktdemokratischen Partizipation auf Bundesebene gibt. Angesichts der oft formulierten Forderung, in Deutschland auf Bundesebene direktdemokratische Elemente einzuführen, erscheint die Überprüfung dieser Hypothese als sehr relevant.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Hinführung
- 2.1. Begriffsdefinitionen
- 2.1.1. Direkte Demokratie
- 2.1.2. Repräsentative Demokratie
- 2.2. Methodische Vorgehensweise
- 3. Direkte Demokratie in der Schweiz
- 4. Direkte Demokratie in Deutschland
- 5. Vergleich und Diskussion
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die Demokratiequalität eines Landes steigt, wenn es Möglichkeiten zur direktdemokratischen Partizipation gibt. Dabei werden die direkte Demokratie in der Schweiz und in Deutschland im Vergleich analysiert. Ziel ist es, die Auswirkungen direktdemokratischer Elemente auf die Demokratiequalität in beiden Ländern zu untersuchen und die Hypothese zu prüfen, dass die Demokratiequalität steigt, wenn Bürger*innen mehr Möglichkeiten zur direktdemokratischen Partizipation haben.
- Direkte Demokratie: Definition und Abgrenzung zur repräsentativen Demokratie
- Methodische Vorgehensweise und Messung von Demokratiequalität
- Direktdemokratische Partizipationsmöglichkeiten in der Schweiz und Deutschland
- Vergleich der direkten Demokratie in der Schweiz und Deutschland
- Diskussion über die Auswirkungen der direkten Demokratie auf die Demokratiequalität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der direkten Demokratie ein und erläutert die Relevanz der Forschungsfrage. Sie beleuchtet die aktuelle Debatte um die Krise der repräsentativen Demokratie und die wachsende Popularität direktdemokratischer Elemente. Die Arbeit geht auf zwei zentrale Hypothesen ein, die im Verlauf der Arbeit überprüft werden sollen.
Das zweite Kapitel definiert die Begriffe „direkte Demokratie“ und „repräsentative Demokratie“, um die Unterschiede zwischen den beiden Formen der Demokratie zu verdeutlichen. Es werden die Ursprünge der Demokratie erläutert und die verschiedenen Formen direkter Demokratie vorgestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der direkten Demokratie in der Schweiz, die als Vorbild für andere Länder gilt. Es werden die verschiedenen Formen der direkten Demokratie in der Schweiz dargestellt und ihre Auswirkungen auf die Demokratiequalität analysiert.
Das vierte Kapitel beleuchtet die direkte Demokratie in Deutschland und analysiert die bestehenden Möglichkeiten der direktdemokratischen Partizipation auf Bundesebene.
Das fünfte Kapitel vergleicht die direkte Demokratie in der Schweiz und in Deutschland und diskutiert die Frage, ob direkte Demokratie zwangsläufig zu einer Steigerung der Demokratiequalität eines Landes führt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der direkten Demokratie, der repräsentativen Demokratie, der Demokratiequalität, der politischen Partizipation und dem bürgerschaftlichen Engagement. Dabei stehen die direkte Demokratie in der Schweiz und in Deutschland im Fokus. Wichtige Schlüsselbegriffe sind außerdem: Volkssouveränität, Volksentscheid, Initiative, Referendum, Politikverdrossenheit, und die Messung der Demokratiequalität.
Häufig gestellte Fragen
Steigt die Demokratiequalität durch direkte Partizipation?
Die Arbeit untersucht genau diese Hypothese durch einen Vergleich zwischen der Schweiz und Deutschland.
Warum gilt die Schweiz als Vorbild für direkte Demokratie?
Wegen ihrer ausgeprägten Instrumente wie Volksinitiativen und Referenden, die in der Arbeit detailliert analysiert werden.
Gibt es in Deutschland direkte Demokratie auf Bundesebene?
Die Arbeit beleuchtet die aktuelle Situation und diskutiert die Forderungen nach Einführung solcher Elemente auf Bundesebene.
Was ist der Unterschied zwischen direkter und repräsentativer Demokratie?
In der repräsentativen Demokratie entscheiden gewählte Vertreter, während in der direkten Demokratie das Volk unmittelbar über Sachthemen abstimmt.
Was versteht man unter "Politikverdrossenheit" in diesem Kontext?
Es wird untersucht, ob direktdemokratische Elemente ein Mittel gegen die zunehmende Distanz der Bürger zur Politik sein können.
- Quote paper
- Viktoria Woronin (Author), 2018, Direkte Demokratie in der Schweiz und Deutschland im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1109066