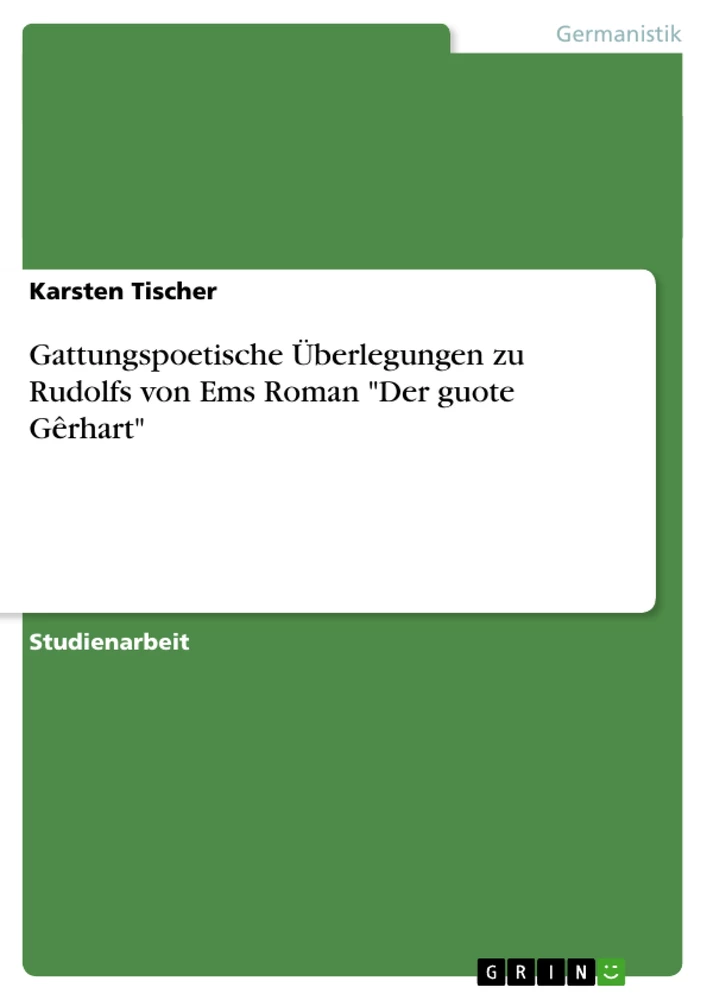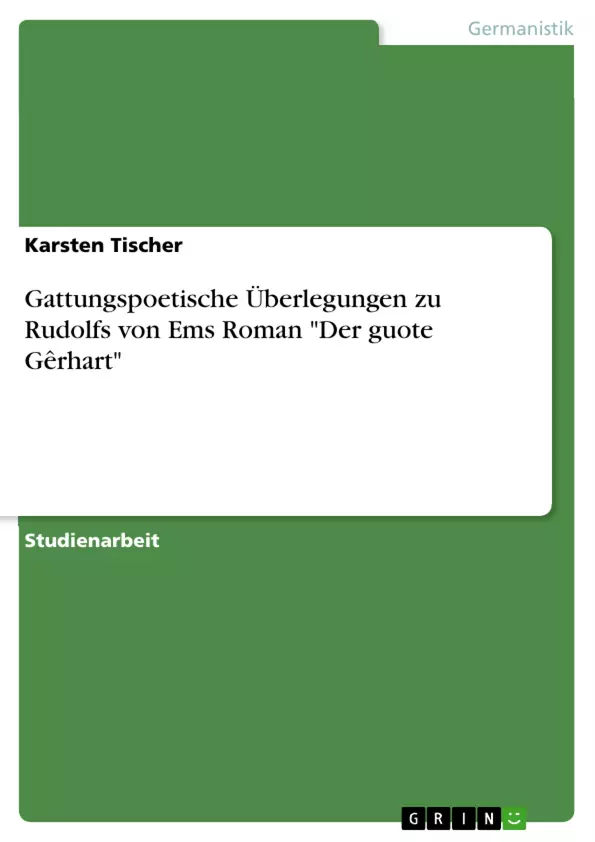„Der Roman hat im Laufe seiner langen Geschichte so vielgestaltige Gebilde hervorgebracht, daß man ihn als eine literarische Gattung innerhalb des Epischen nicht definieren kann, wohl aber beschreiben, wie er in einer bestimmten Zeit ausgesehen hat, was er erzählt, wie er gebaut war und – sofern man darüber etwas weiß – was Autoren und Publikum von ihm hielten.“
Mit diesen Worten steigt Xenja von Ertzdorff in ihre Untersuchung zum literarischen Schaffen des Rudolfs von Ems ein. Gerade das Erstlingswerk des späthöfischen Autors Rudolf, ‚Der guote Gêrhart’ bedient hervorragend diese Formulierung. Denn obwohl sich die Wissenschaftler bei dem um 1210/11 bis 1214/15 entstandenen Werk formal auf die Gattung des ‚Versromans’ einigen konnten, ist eine exakte Festlegung aus der inhaltlichen Perspektive heraus nicht wirklich erfolgt. Dementsprechend verschieden fallen die Interpretationen unter diesem Gesichtspunkt aus. Das bestätigt, was Wolfgang Walliczek über Rudolfs Werk festhält: Es ist ein „literarische[s] Novum“ und lässt sich demzufolge nur schwer in die gängigen Kategorien einordnen. Dennoch wurde es natürlich versucht, denn wie schon Umberto Eco sagte, „[...] sprechen [Bücher] immer von anderen Büchern, und jede Geschichte erzählt eine längst schon erzählte Geschichte.“ Diese Annahme bestätigt Hilkert Weddige, wenn er sagt, dass es damals „[...] nicht auf die Erfindung neuer Stoffe [ankommt].“
Die folgenden Seiten sollen die verschiedenen Einordnungsversuche erläutern und begründen, inwieweit ‚Der guote Gêrhart’ in die jeweilige Gattung hineinpasst.
Inhalt
1 Einleitung
2 Der Artusroman – Gêrhart als edler Ritter
3 Die Patrizierdichtung – Ein Lob auf den Kaufmann
4 Die Propagandadichtung – Der politische Gêrhart
5 Die Streitnovelle – Der vollkommene Gêrhart
6 Schluss
7 Bibliographie
Ein formaler Hinweis
Quellennachweise aus dem Primärtext finden sich im laufenden Text, in Klammern nach dem jeweiligen Zitat, in folgenden Format: (V. [Verszeile]). Dieses Format ist nicht zu verwechseln mit Jahresangaben in Klammern.
Alle Nachweise von Zitaten aus der Sekundärliteratur erfolgen in Fußnoten am Ende der jeweiligen Seite.
1 Einleitung
Der Roman hat im Laufe seiner langen Geschichte so vielgestaltige Gebilde hervorgebracht, daß man ihn als eine literarische Gattung innerhalb des Epischen nicht definieren kann, wohl aber beschreiben, wie er in einer bestimmten Zeit ausgesehen hat, was er erzählt, wie er gebaut war und – sofern man darüber etwas weiß – was Autoren und Publikum von ihm hielten.[1]
Mit diesen Worten steigt Xenja von Ertzdorff in ihre Untersuchung zum literarischen Schaffen des Rudolfs von Ems ein. Gerade das Erstlingswerk des späthöfischen Autors Rudolf, ‚Der guote Gêrhart’ bedient hervorragend diese Formulierung. Denn obwohl sich die Wissenschaftler bei dem um 1210/11 bis 1214/15 entstandenen Werk formal auf die Gattung des ‚Versromans’ einigen konnten, ist eine exakte Festlegung aus der inhaltlichen Perspektive heraus nicht wirklich erfolgt.[2] Dementsprechend verschieden
fallen die Interpretationen unter diesem Gesichtspunkt aus. Das bestätigt, was Wolfgang Walliczek über Rudolfs Werk festhält: Es ist ein „literarische[s] Novum“[3] und lässt sich demzufolge nur schwer in die gängigen Kategorien einordnen. Dennoch wurde es natürlich versucht, denn wie schon Umberto Eco sagte, „[...] sprechen [Bücher] immer von anderen Büchern, und jede Geschichte erzählt eine längst schon erzählte Geschichte.“[4] Diese Annahme bestätigt Hilkert Weddige, wenn er sagt, dass es damals
„[...] nicht auf die Erfindung neuer Stoffe [ankommt].“[5]
Die folgenden Seiten sollen die verschiedenen Einordnungsversuche erläutern und begründen, inwieweit ‚Der guote Gêrhart’ in die jeweilige Gattung hineinpasst.
2 Der Artusroman – Gêrhart als edler Ritter
Generell lässt sich zunächst festhalten, dass die „höfische Literatur zwischen 1170 und 1230/50 [...] auch als ‚ritterlich-höfische’ [...] bezeichnet [wird]“[6] „Frankreich ist richtungsweisend für die höfische Literatur und Kultur Deutschlands.“[7] „Zahlreiche französische Modewörter [...] bezeugen die Intensität dieses Einflusses.“[8] Und abgesehen vom ‚Nibelungenlied’ ist die ‚Artusepik’ der beliebteste epische Texttyp des Mittelalters.[9] Diese wurde durch Chrétien de Troyes (ca. 1135-1188) in Frankreich begründet und fand mit den Romanen ‚Erec’ und ‚Iwein’ von Hartmann von Aue auch ihren Weg nach Deutschland.[10]
Demnach würde es nicht verwundern, wenn Rudolf sich dieses Musters für den ‚Guoten Gêrhart’ bedient hatte. Schließlich sah er sich selbst als „Dienstmann“[11], was ihn nach dem Verständnis mancher Germanisten auch zum ‚Ritter’ machte.[12] Das Ritterideal mit seinen Tugendwerten diente nämlich für den gesamten Adel als Vorbild für angemessenes Verhalten.[13] Zusätzlich sei erwähnt, dass sich Rudolf den höfischen Meistern, Hartmann, Wolfram und Gottfried, verpflichtet fühlte.[14] Lange galt er sogar als „unkreativer Nachahmer der großen Meister“[15], was ihm dem Titel des ‚Epigonen’ einbrachte. Diese Annahme ist heute so nicht mehr gültig, wie das oben angeführte Zitat des ‚literarischen Novums’ schon vermuten lässt. Das schließt jedoch nicht aus, dass ‚Der guote Gêrhart’ ein Artusroman sein könnte.
Das wohl auffälligste Schema, das Rudolf anscheinend vom Artusroman übernommen hat, ist der ‚doppelte Kursus’. Die Binnengeschichte gliedert sich in zwei Zyklen.
Der Kaufmann Gêrhart beginnt seine Reise in seiner Heimatstadt Köln in Richtung „Sarant“ (V. 1198). Gewöhnlich ist der Ausgangspunkt eines Artusromans der Hof des legendären britischen Königs, doch Rudolf könnte mit dem Transfer in die Rheinstadt dem gewünschten Wirklichkeitsbezug seiner Erzählung Rechnung getragen haben, um somit dem sonst märchenhaften Charakter der Artusepik entgegenzuwirken.[16] Auch die „Handlungsträger sind nicht mehr fiktive, sondern pragmatisch behandelte realistische Figuren.“[17] Damit zollt Rudolf wahrscheinlich der „sozialen Realität“[18] Tribut, welche weit entfernt war vom Ideal des edlen Ritters. [G]egen 1200 können wir feststellen, daß sich die Feudaldichtung mit einem tief gehenden Widerspruch auseinanderzusetzen beginnt, nämlich mit der Tatsache, daß die in ihr gestaltete Idealwelt mit der sozialen und politischen Wirklichkeit der Feudalgesellschaft [...] in keiner Weise übereinstimmte.[19]
Statt eines „Sich-Einsetzens des Starken für den Schwachen“[20] gab es u.a. zahlreiche Kreuzzüge mit Hunderttausenden von Opfern.[21]
Nichtsdestoweniger bleibt der ‚doppelte Kursus’ als Muster erhalten. Mit einem „ungewitter winde vil“ (V. 1223) beginnt Gêrharts ‚âventiure’, die ihn bis nach „Marroch“ (V. 1413) verschlägt. Dass Marokko damals ein Land von Heiden war, in das der christliche Kaufmann gelangte, entspricht dem Zweck der Kreuzzüge, der bekanntlich der Kampf gegen die Ungläubigen war. Allerdings versucht Gêrhart nicht die dort ansässigen Heiden zu bekehren, sondern vielmehr ein gutes Geschäft zu machen. Für die Bekehrung wäre der Kölner Kaufmann aus Sicht der Kirche wahrscheinlich auch gänzlich ungeeignet gewesen, da gerade jene Institution das Händlertum „mit moralischer Skepsis betrachtete“[22] und u.a. den Zins verbot.[23]
Trotzdem waren die Fernhändler der damaligen Zeit weit mehr als „kühl kalkulierende, nüchterne, allein am Profit orientierte Rechner“[24]. Im Seehandel gingen sie ein enormes Risiko auf ihren Fahrten ein und gebrauchten für ihre Reisen „noch lange Zeit den Begriff der aventiure “[25]. Sie nannten „sich daher im Mittelalter selbstbewusst beruflich
‚Abenteurer’.“[26] Sonja Zöller führt noch weitere Übereinstimmungen von Rittern und
Kaufleuten an: So waren beide Gruppen vom „‚allgemeinen Ehrbegriff des Adels’ beeinflußt“[27] und ein Kaufmann konnte durch Reichtum und Reputation auch in den Adel, und somit in das Rittertum, aufsteigen.[28] Weiterhin lassen sich in der deutschen höfischen Literatur öfters Bewertungen von Kaufleuten finden, die mit Begriffen aus dem „ritterlich-höfischen Bereich“[29] beschrieben werden.[30] Doch auch außerhalb der Fiktion, so Sonja Zöller, war „[d]er ritterliche Kaufmann [...] eine Erscheinung der historischen Realität.“[31] Hier wurde ihm auch die „ethische Verpflichtung“[32] übertragen, sich um die Armen zu sorgen.[33]
[...]
[1] Xenja von Ertzdorff: Rudolf von Ems. Untersuchungen zum höfischen Roman im 13. Jahrhundert. München: Fink 1967. S. 7f.
[2] Vgl. Otto Neudeck: Erzählen von Kaiser Otto. Zur Fiktionalisierung von Geschichte in mittelhochdeutscher Literatur. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2003 (= Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit 18). S. 202.
[3] Walliczek, Wolfgang: Rudolf von Ems. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Bd. 8: Rev-Sit. 2. Aufl. Hrsg. von Kurt Ruh. Berlin, New York: de Gruyter 1992. S. 328.
[4] Sonja Zöller: Kaiser, Kaufmann und die Macht des Geldes. Gerhard Unmaze von Köln als Finanzier der
Reichspolitik und der ‚Gute Gerhard’ des Rudolf von Ems. München: Fink 1993 (= Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur 16). S. 167.
[5] Hilkert Weddige: Einführung in die germanistische Mediävistik. 5. Aufl. München: Beck 2003. S. 191.
[6] Weddige 2003: S. 187.
[7] Ebd. S. 190.
[8] Ebd.
[9] Vgl. Thomas Bein: Germanistische Mediävistik. Eine Einführung. 2. Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2005 (= Grundlagen der Germanistik 35). S. 172.
[10] Vgl. Weddige 2003: S. 194f.
[11] Walliczek 1992: S. 322.
[12] Vgl. Weddige 2003: S. 171f.
[13] Vgl. Werner Wunderlich: Der ‚ritterliche’ Kaufmann. Literatursoziologische Studien zu Rudolf von Ems’ ‚Der guote Gêrhart’. Kronberg: Scriptor 1975 (= Scriptor Hochschulschriften.
Literaturwissenschaft 7). S. 10.
[14] Vgl. Walliczek 1992: S. 325f.
[15] Neudeck 2003: S. 193.
[16] Vgl. Weddige 2003: S. 194f.
[17] Wunderlich 1975: S. 171.
[18] Walliczek 1992: S. 328.
[19] Wunderlich 1975: S. 11.
[20] Bein 2005: S. 173.
[21] Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden. 21. Aufl. Bd. 15: KIND-KRUS. Leipzig, Mannheim: F.A. Brockhaus 2006. S. 737.
[22] Zöller 1993: S. 99.
[23] Vgl. ebd. S. 102.
[24] Zöller 1993: S. 93.
[25] Ebd.
[26] Ebd.
[27] Ebd.
[28] Vgl. ebd.
[29] Ebd. S. 94.
[30] Vgl. ebd.
[31] Ebd. S. 95.
[32] Ebd. S. 96.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text 'Der guote Gêrhart'?
Der Text analysiert Rudolf von Ems' Werk ‚Der guote Gêrhart’ und untersucht, inwieweit es in verschiedene literarische Gattungen, insbesondere den Artusroman, einzuordnen ist.
Was ist der ‚doppelte Kursus’ und welche Rolle spielt er?
Der ‚doppelte Kursus’ ist ein Erzählmuster, das im Text als möglicher Einfluss des Artusromans auf ‚Der guote Gêrhart’ identifiziert wird. Die Binnengeschichte ist in zwei Zyklen gegliedert.
Inwiefern ähnelt Gêrharts Reise einer ‚âventiure’?
Gêrharts Reise von Köln nach Marokko wird als ‚âventiure’ bezeichnet, was dem Begriff der Abenteuerreise von Rittern ähnelt. Fernhändler dieser Zeit riskierten viel auf ihren Reisen und gebrauchten für ihre Reisen den Begriff der aventiure.
Welche Rolle spielen Kaufleute im Vergleich zu Rittern?
Der Text erörtert die Gemeinsamkeiten zwischen Kaufleuten und Rittern, wie z.B. den Ehrbegriff des Adels und die Möglichkeit des Aufstiegs in den Adel durch Reichtum. Es wird auch die ethische Verpflichtung der Kaufleute, sich um die Armen zu kümmern, erwähnt.
Welche Kritik gab es an Rudolf von Ems' Werk?
Rudolf von Ems wurde lange Zeit als "unkreativer Nachahmer der großen Meister" und "Epigone" betrachtet, was heute jedoch nicht mehr uneingeschränkt gilt. Die Einordnung als ‚literarisches Novum’ wird nun stärker betont.
Warum wird der Artusroman als Vergleich herangezogen?
Die höfische Literatur und Kultur Deutschlands wurde maßgeblich durch Frankreich beeinflusst, insbesondere die Artusepik durch Chrétien de Troyes. Rudolf von Ems fühlte sich den höfischen Meistern verpflichtet. Die Arbeit analysiert, inwieweit Rudolf sich dieses Musters für den ‚Guoten Gêrhart’ bedient hat.
Was wird über die soziale Realität des Mittelalters gesagt?
Der Text betont, dass die Idealwelt der Feudaldichtung oft nicht mit der sozialen und politischen Realität der Feudalgesellschaft übereinstimmte. Statt "Sich-Einsetzens des Starken für den Schwachen" gab es beispielsweise zahlreiche Kreuzzüge mit vielen Opfern.
Wie wird das Verhältnis der Kirche zum Händlertum dargestellt?
Die Kirche betrachtete das Händlertum mit moralischer Skepsis und verbot u.a. den Zins.
- Quote paper
- Karsten Tischer (Author), 2007, Gattungspoetische Überlegungen zu Rudolfs von Ems Roman "Der guote Gêrhart", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110924