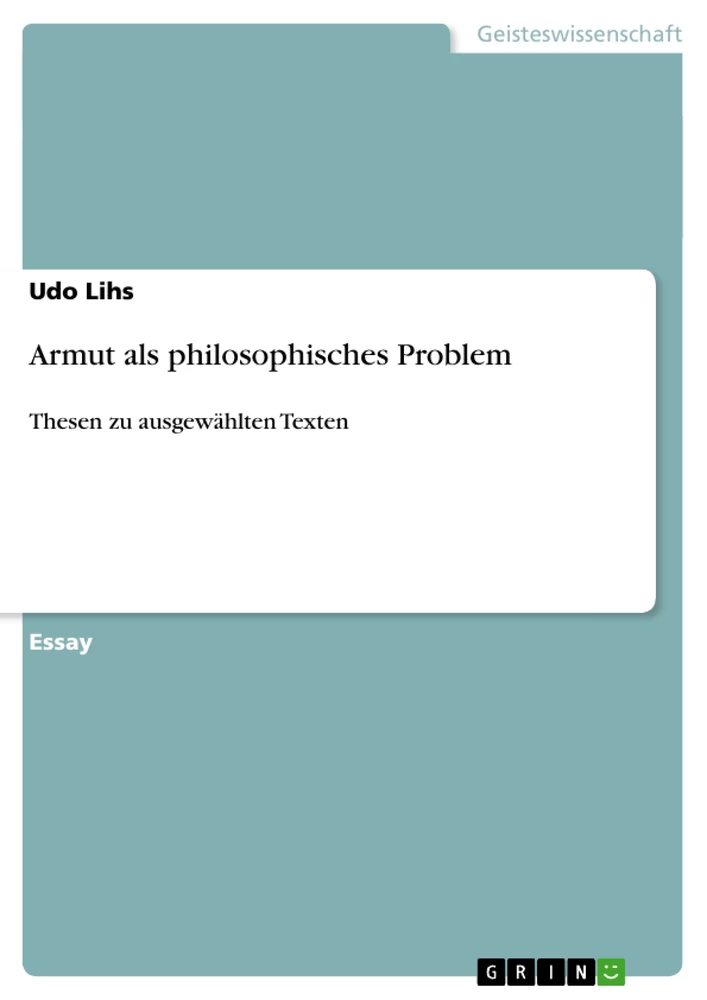Kurze Darstellung, wie in der Ethik das Thema "Armut" bearbeitet wird.
Text:
G. Cullity: „Wohltätigkeit, Rechte und Staatsbürgerschaft“. In: B. Bleisch, P. Schaber (Hg.): „Weltarmut und Ethik“. Paderborn, 2007.
Thesen:
Cullity postuliert in seinem Text eine Hilfspflicht, d.h. für ihn besteht zweifelsfrei eine moralische Pflicht der Menschen darin, Bedürftigen zu helfen, unabhängig davon, wie weit entfernt sie leben, ob sie Staatsbürger sind oder nicht. Cullitys Moral der Hilfspflicht basiert auf Humanität: Er leitet die Hilfspflicht von der Achtung gegenüber der Autonomie der Menschen, konkret von der Berücksichtigung der Bedürfnisse des Menschen ab und negiert damit die übliche Rechtfertigung der Hilfe über das allgemeine Menschenrecht, da aus dem Menschenrecht keine Pflicht des Helfens, sondern eher ein Anspruch hervorgeht. In dem Zusammenhang kritisiert er das geläufige Prinzip des „fairen Anteils“, insofern er davon ausgeht, dass dieser Anteil nicht ausreiche, um die Bedürfnisse der Verzweifelten tatsächlich zu befriedigen. Im Fokus seines Textes steht allerdings nicht nur die Humanität an sich, sondern vor allem das Individuum als autonomes Mitglied innerhalb eines Kollektivs, innerhalb eines Staates, im Kontrast zum „Fremden“. Er betont, dass wir nicht in einer kosmopolitischen Welt leben und daher die Hilfspflicht abhängig von den Verteilungsrechten einer in Grenzen lebenden Gemeinschaft, innerhalb eines Staates, ist. Das Individuum ist daher innerhalb eines Kollektivs, d.h. als Staatsbürger, moralisch verpflichtet, Bedürftigen, v.a. Fremden, aus der Bedürftigkeit heraus zu helfen.
Text:
Avishai Margalit: „Politik und Würde“. Frankfurt a.M., 1999: S. 260-284
Thesen:
Im Zentrum der Überlegungen des Jerusalemer Philosophieprofessors Avishai Margalit steht die Entwürdigung von armen Menschen, während sie Hilfe von der Gesellschaft beziehen. Margalit erwähnt dabei den Wohlfahrtsstaat und differenziert daraufhin zwischen der Wohlfahrts- und der Wohltätigkeitsgesellschaft und versucht, herauszufinden, welche dieser beiden Gesellschaften Demütigungen vermeiden kann. Dabei betont er Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den jeweiligen Gesellschaften, indem er die jeweiligen Motivationen und Vorsätze, zu helfen und die sich daraus resultierenden Lebensbedingungen der Armen für jede Gesellschaft erörtert: Während die Wohlfahrtsgesellschaft private Organisationen bildet, über die bürokratisch die Hilfe verwaltet wird und so die Armen ihre Hilfe erhalten, baut die Wohltätigkeits- gesellschaft auf das Mitleid und die Barmherzigkeit Einzelner, die die Hilfe direkt an die Armen weitergeben, wobei Margalit betont, dass diese Wohltätigkeit ein Über- legenheitsgefühl und eine Selbstgerechtigkeit impliziert, was sich entwürdigend auf die Armen auszuwirken scheint. Gleichzeitig sei die Bürokratie der Wohlfahrtsgesellschaft ebenfalls entwürdigend, da in dem Zusammenhang häufig der Vorwurf laut wird, diese Armen seien durch den Empfang von Leistungen einerseits faule „Parasiten“ (S. 273), wobei andererseits scheinen sie durch kapitalistische Lebensbedingungen in diese Abhängigkeit gedrängt worden zu sein. Margalit trotzt den Vorwürfen gegen die Wohlfahrtsgesellschaft, indem er schließlich zu der Erkenntnis gelangt, dass ein Anrecht bzw. ein Anspruch auf Hilfe in einem Wohlfahrtsstaat weniger entwürdigend ist, als das Geschenk des Barmherzigen, für das der Arme sich dankbar zeigen muss, weil er sich, gemäß einer Theorie des Ausgleich, verpflichtet fühlt, etwas zurückzugeben, obwohl er „mit leeren Händen da steht.“ (S. 283).
Text:
T. Pogge: „Globale Verteilungsgerechtigkeit“. In: S. Gosepath und J.-C. Merle (Hg.): „Weltrepublik: Globalisierung und Demokratie“. München, 2002: S. 220-234
Thesen:
Pogge beschäftigt er sich mit der egalitären Frage, wie, aufgrund wachsender globaler Armut, Güter auf der Welt gerecht verteilt werden können. Pogges Argumentation für eine „bessere Welt“, d.h. für eine gerechte Verteilung verläuft dabei aber nicht ergebnis- oder prozessorientiert. Er konzentriert sich auf Verteilungsstrukturen; Im Zentrum des Textes stehen ethische und moralische Verteilungsregeln. Gegenstand seines Textes ist ein mögliches Regelsystem sowie seine Bedingungen.
Zunächst betont Pogge die tugendhafte Pflicht, zu helfen und grenzt diese von einer Großzügigkeit, von der Wohltätigkeit ab. Weiterhin stellt Pogge eine Reihe von Möglichkeiten vor, eine Solidargemeinschaft innerhalb einer Gruppe einzurichten, differenziert dabei vor allem zwischen juridischen, ethischen und moralischen Ver- und Geboten. In dem Zusammenhang kritisiert er unsolidarische strukturelle Bedingungen des freien Weltmarktes, die einer globalen Verteilungsgerechtigkeit zuwider laufen, indem reiche Länder den Weltmarkt zu „ihrem eigenen Gunsten beeinflussen“. (S. 228). Der Weltmarkt verstoße in diesem Zusammenhang gegen Rechts-, wie Tugendpflichten in Umverteilungsprozessen, z.B. durch Wettbewerbsverzerrungen. Somit verschärfen die ungerechten Strukturen des freien Marktes Ungleichheiten in der Verteilung der Güter und potenzieren damit die globale Armut.
Häufig gestellte Fragen
G. Cullity: „Wohltätigkeit, Rechte und Staatsbürgerschaft“ – Worum geht es in diesem Text?
Cullitys Text argumentiert für eine Hilfspflicht, die auf Humanität basiert und nicht auf Menschenrechten. Er betont die Pflicht, Bedürftigen zu helfen, unabhängig von Staatsbürgerschaft oder Entfernung, kritisiert aber auch das Prinzip des "fairen Anteils" als unzureichend. Cullity fokussiert auf das Individuum als autonomes Mitglied innerhalb eines Staates und sieht die Hilfspflicht abhängig von den Verteilungsrechten dieser Gemeinschaft.
Avishai Margalit: „Politik und Würde“ – Was sind die Kernaussagen des Textes?
Margalit analysiert die Entwürdigung von Armen durch Hilfeleistungen. Er vergleicht Wohlfahrts- und Wohltätigkeitsgesellschaften, um herauszufinden, welche Demütigungen vermeiden kann. Während die Wohltätigkeitsgesellschaft auf Mitleid basiert und Überlegenheitsgefühle implizieren kann, kann auch die Bürokratie der Wohlfahrtsgesellschaft entwürdigend sein. Margalit argumentiert, dass ein Anrecht auf Hilfe im Wohlfahrtsstaat weniger entwürdigend ist als das Geschenk des Barmherzigen.
T. Pogge: „Globale Verteilungsgerechtigkeit“ – Welche Thesen vertritt Pogge?
Pogge thematisiert die gerechte Verteilung von Gütern angesichts globaler Armut, mit Fokus auf ethische und moralische Verteilungsregeln. Er grenzt die Hilfspflicht von Großzügigkeit ab und kritisiert unsolidarische strukturelle Bedingungen des freien Weltmarktes, die globale Verteilungsgerechtigkeit behindern. Er argumentiert, dass Armut ein Problem der Gerechtigkeit ist, nicht der Wohltätigkeit, konkret ein Problem der ungerechten Verteilung der Güter.
- Citation du texte
- Udo Lihs (Auteur), 2007, Armut als philosophisches Problem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/111150