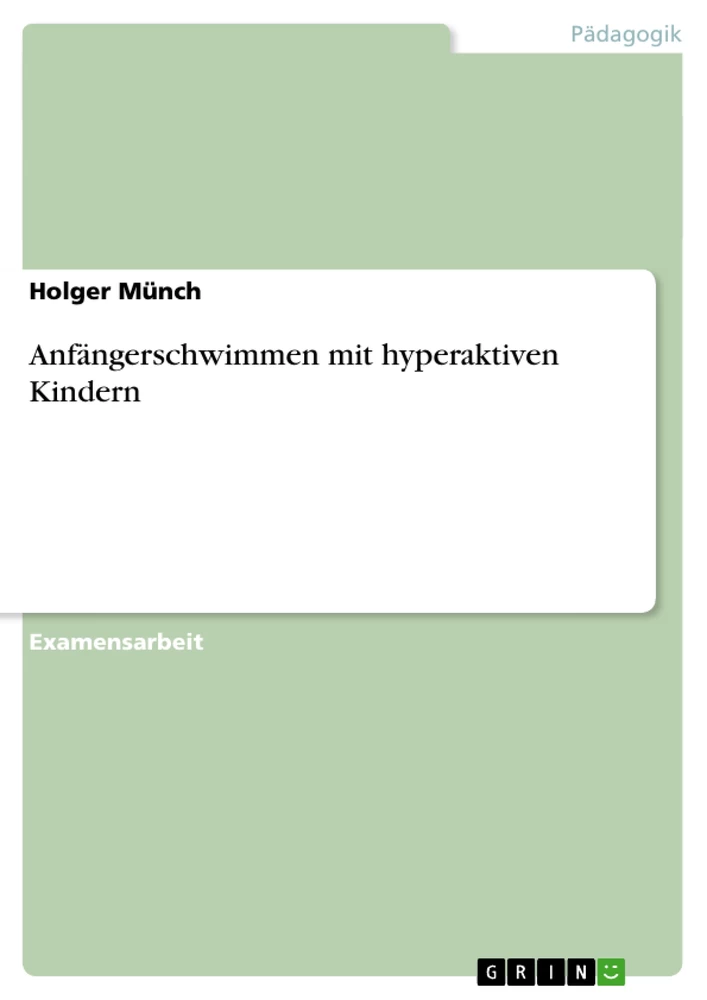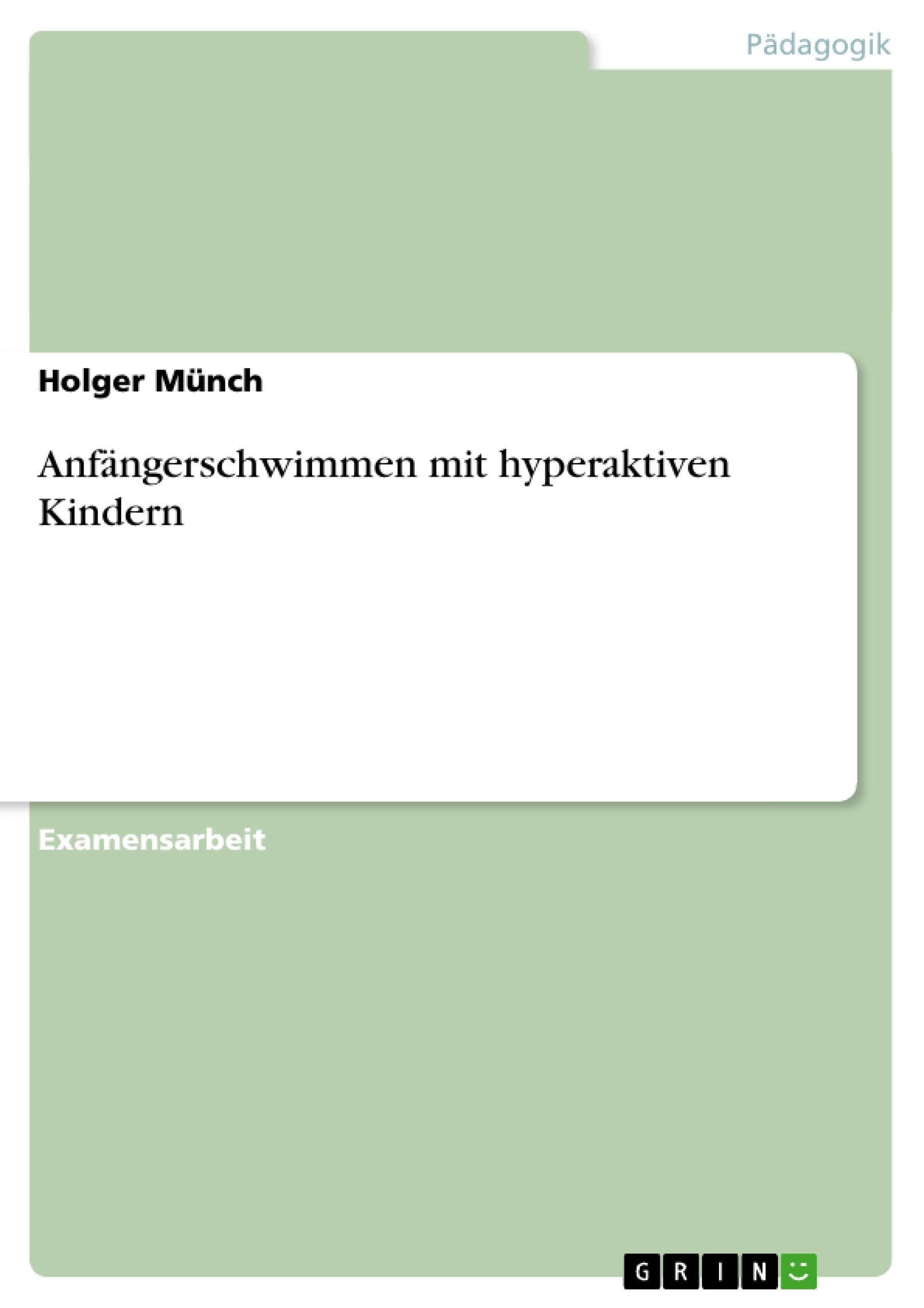Während des Studiums war ich immer bemüht, praktische Erfahrung für meinen späteren Beruf zu erlangen. So besuchte ich ein Seminar bei Herrn STROHKENDL zum Anfängerschwimmen, in dessen Rahmen ich einen Jungen (Philipp) mit hyperaktiven Störungen beim Erlernen des Schwimmens begleitete.
Das hyperaktive Syndrom (HKS), ist eine der bekanntesten und weitverbreitesten (ca.5% der Kinder) Behinderungsformen der heutigen Zeit.
Schon 1845 lieferte der Arzt Heinrich Hoffman mit dem "Zappel - Philipp" die klassische Beschreibung von einem hyperaktiven Kind.
So gibt es heute eine Fülle von Veröffentlichungen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen; Erscheinungsbild, Verursachung und Behandlungsmöglichkeiten.
Die Veröffentlichungen haben die größte Gemeinsamkeit im Erscheinungsbild, die vermuteten Ursachen der Störungen reichen von minimaler cerebraler Dysfunktion bis hin zu Hyperaktivität als Zivilisationsstörung.
Entsprechend der Thesen für die Verursachung der Störung gab und gibt es Diskussionen über die Namengebung für die hyperaktiven Störungen. In der Hauptsache handelt es sich um MCD (minimale cerebrale Dysfunktion), ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom) und HKS (hyperkinetisches Syndrom). Aus diesem Grund werde ich zuerst auf die verschiedene Begrifflichkeit von Hyperaktivität eingehen und im weiteren dann die Chronologie der Ursachenforschung, den Verlauf der Störung und die Diagnostik darstellen.
Ebenso vielfältig sind die Therapieansätze, in meiner Hausarbeit beschränke ich mich auf den Ansatz von der Kölner Gruppe um Döpfner, die das Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten (THOP) entwickelt haben.
THOP umschließt die ganze Bandbreite von psychologischen und verhaltenstherapeutischen Interventionen bei Kindern mit hyperaktiven Störungen, anhand derer die primären und sekundären Schwierigkeiten der Kinder deutlich werden.
[...]
In dem empirischen Teil der Arbeit beschreibe ich meine Erfahrung mit einem Jungen (Philipp) mit hyperaktiven Störungen aus dem Seminar "Anfängerschwimmen mit körperbehinderten Kindern" geleitet von Hr. Strohkendl.
Inhaltsverzeichnis
- THEORETISCHER HINTERGRUND
- Einleitung
- Begrifflichkeit
- Chronologie der Ursachenforschung
- Verlauf und Symptomatik
- Verursachende Faktoren von hyperkinetischen Störungen
- Genetische Faktoren
- Neurologische Faktoren
- Aspekt allergischer Reaktionen auf Nahrungsmittelbestandteile
- Bedeutung spezifischer Hirnstrukturen
- Psychosoziale Faktoren
- Biopsychosoziales Konzept
- Diagnose hyperkinetischer Störungen
- Symptome hyperkinetischer Störungen
- Sekundäre Schwierigkeiten von Kindern mit HKS
- Interventionsverfahren
- Medikamentöse Intervention
- Verhaltenstherapeutische Interventionen
- Eltern- und Familienzentriertes Verfahren
- Schulzentrierte Verfahren
- Patientenzentrierte Interventionen
- Selbstinstruktionstraining
- Selbstmanagement-Methoden
- Spieltraining
- Problemlösetraining
- Ärger-Kontrolltraining
- Soziales Kompetenztraining
- Zusammenfassung
- Hyperaktivität aus motopädagogischer Sicht
- Psychomotorische Auffälligkeiten von hyperaktiven Kindern
- Motopädagogische Interventionen
- Allgemeine methodische Grundsätze
- Vestibulär stimulierende Aktivitäten
- Entwicklung von Bremskräften und Bewegungssteuerung
- Konzentrationsverbesserung mit geschlossenen Augen
- Schulung der visuellen Aufmerksamkeit
- Überwindung der Impulsivität
- Sportliches Handeln als Mittel zur Selbstdisziplinierung
- Zusammenfassung
- Hyperaktive Kinder in der Schule für Körperbehinderte
- Anfängerschwimmen als Förderunterricht
- Anfängerschwimmen mit hyperaktiven Kindern
- Modelle des Anfängerschwimmens
- Wilkes Modell
- Innenmosers Ansatz
- Modell Strohkendl
- Gestaltung des Schwimmbades
- Das Prinzip der Einzelbetreuung
- Das Verhältnis Lehrer Schüler
- Inhaltliche Strukturen Strohkendls Modell
- Methodisch-Didaktisches Vorgehen
- Struktur einer Anfängerschwimmstunde nach Strohkendl
- Zusammenfassung
- Wasser als ordnendes Element
- Hyperaktives Syndrom (HKS) und seine Ursachen
- Diagnostik und Therapie von HKS
- Motopädagogische Interventionen bei hyperaktiven Kindern
- Anfängerschwimmen als Förderunterricht in der Schule für Körperbehinderte
- Die Bedeutung des Modells von Strohkendl für den Schwimmunterricht mit hyperaktiven Kindern
- Die Einleitung führt in die Thematik des hyperaktiven Syndroms ein, beschreibt die verschiedenen Begriffsbezeichnungen und beleuchtet die Chronologie der Ursachenforschung.
- Kapitel 1 behandelt die Ursachen von hyperkinetischen Störungen, insbesondere die genetischen, neurologischen, psychosozialen und umweltbedingten Faktoren.
- Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Diagnose hyperkinetischer Störungen und den damit verbundenen sekundären Schwierigkeiten.
- Kapitel 3 präsentiert verschiedene Interventionsverfahren, sowohl medikamentöse als auch verhaltenstherapeutische Ansätze, mit einem Fokus auf die Kölner Gruppe um Döpfner und deren Therapieprogramm THOP.
- Kapitel 4 betrachtet Hyperaktivität aus motopädagogischer Sicht und beleuchtet die psychomotorischen Auffälligkeiten hyperaktiver Kinder sowie die Bedeutung von motopädagogischen Interventionen.
- Kapitel 5 beschreibt die Besonderheiten der Schule für Körperbehinderte im Kontext der Förderung hyperaktiver Kinder.
- Kapitel 6 behandelt das Anfängerschwimmen als Förderunterricht und stellt verschiedene Modelle des Schwimmunterrichts vor, insbesondere das Modell von Strohkendl, welches sich als besonders geeignet für hyperaktive Kinder erweist.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Anfängerschwimmen für hyperaktive Kinder und verfolgt das Ziel, die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten dieses Bildungsbereichs aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der Integration von motopädagogischen und verhaltenstherapeutischen Interventionen im Schwimmunterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem hyperaktiven Syndrom (HKS), dessen Diagnostik, Therapie, motopädagogischen Interventionen und der Anwendung im Anfängerschwimmen, insbesondere im Kontext der Schule für Körperbehinderte. Das Modell von Strohkendl wird als besonders geeignete Methode für den Schwimmunterricht mit hyperaktiven Kindern vorgestellt.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Schwimmen für hyperaktive Kinder besonders geeignet?
Wasser wirkt als „ordnendes Element“, das den Kindern hilft, ihre Bewegungen besser zu steuern und Reize zu kanalisieren.
Was sind die Kernsymptome von HKS/ADS?
Dazu gehören motorische Unruhe (Zappel-Philipp-Syndrom), Aufmerksamkeitsdefizite und impulsives Verhalten.
Was zeichnet das Schwimmmodell nach Strohkendl aus?
Es basiert auf dem Prinzip der Einzelbetreuung, einem engen Lehrer-Schüler-Verhältnis und einer spezifischen methodisch-didaktischen Struktur der Unterrichtsstunde.
Was versteht man unter motopädagogischen Interventionen?
Dies sind gezielte Bewegungsübungen zur Verbesserung der visuellen Aufmerksamkeit, der Bewegungssteuerung und zur Überwindung von Impulsivität.
Was ist das Therapieprogramm THOP?
THOP ist ein Programm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten, das psychologische und verhaltenstherapeutische Ansätze kombiniert.
Welche Rolle spielen neurologische Faktoren bei Hyperaktivität?
Die Forschung diskutiert minimale cerebrale Dysfunktionen (MCD) und die Bedeutung spezifischer Hirnstrukturen als mögliche Ursachen.
- Quote paper
- Holger Münch (Author), 2002, Anfängerschwimmen mit hyperaktiven Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11173