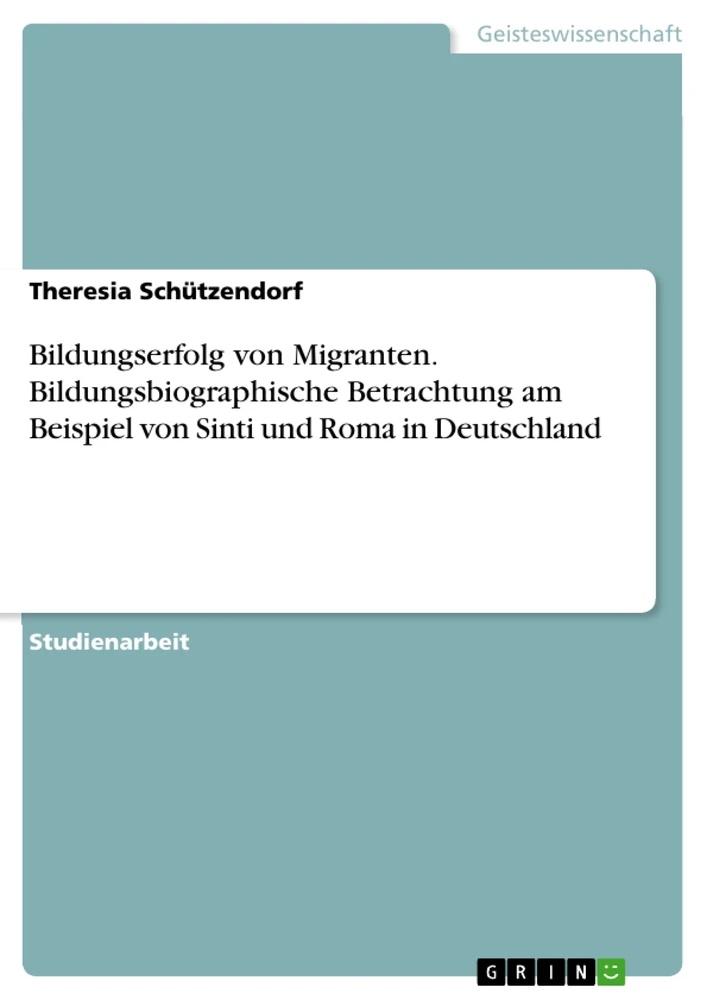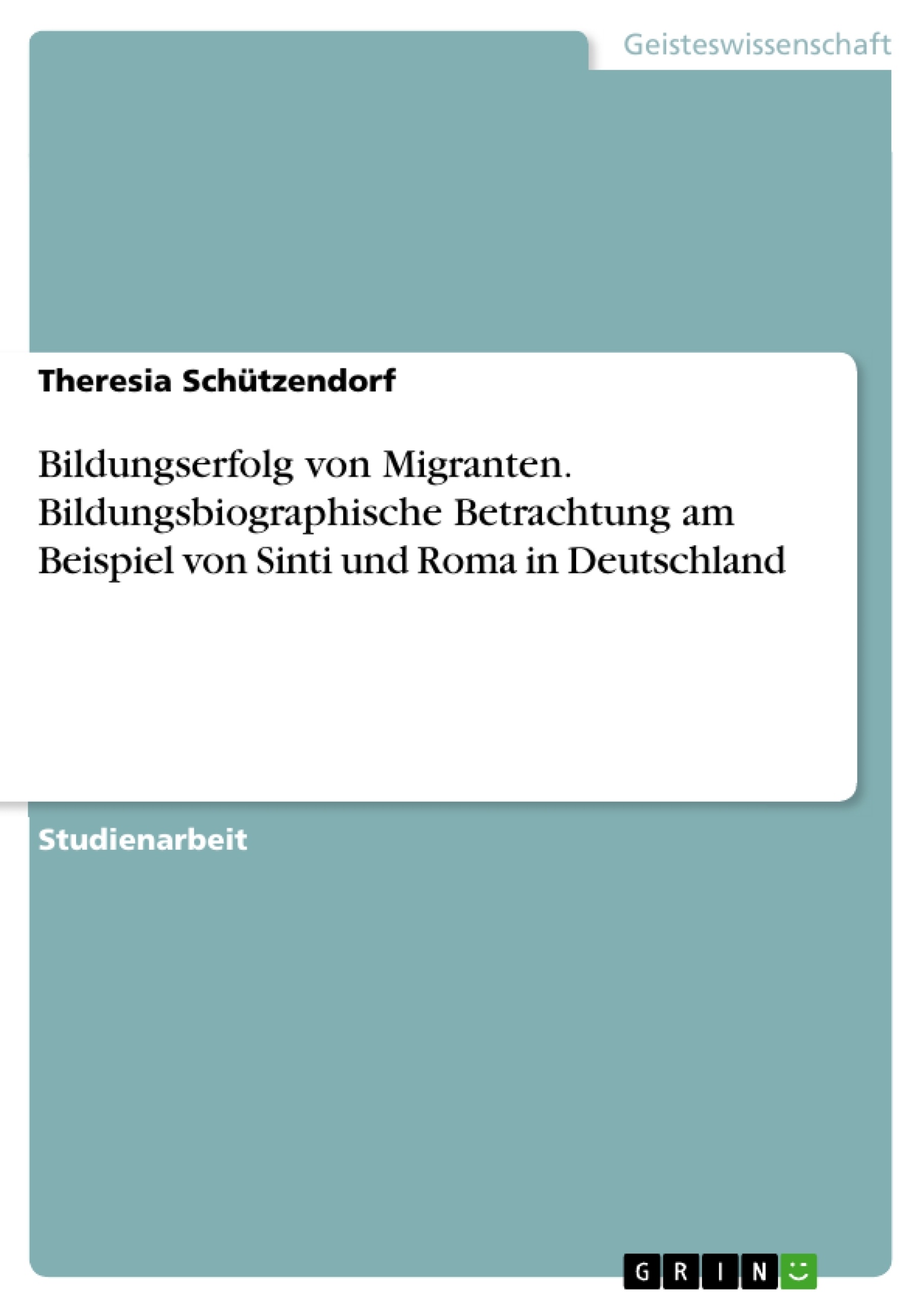Bildungsungleichheiten sind im deutschen Bildungssystem in ausgeprägter Weise vorhanden und stellen nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen Migrationsbewegungen ein wichtiges bildungspolitisches und gesellschaftlich relevantes Thema dar. Die soziale Herkunft der Kinder bestimmt in vielen Fällen ihren Bildungserfolg und stellt somit Weichen für ihr späteres Leben und das der ihnen nachfolgenden Generationen. Worin liegen diese Ungleichheiten begründet und warum betreffen sie in besonderer Weise Kinder mit Migrationshintergrund?
Die vorliegende Arbeit betrachtet die bildungsbezogene Lage von Migranten und Migrantinnen in Deutschland. Im Besonderen wird hierbei auf die Bildungssituation der in Deutschland lebenden Sinti und Roma Bezug genommen.
Um einem lösungsorientierten Ansatz zu folgen, wird der zentralen Fragestellung nachgegangen, welche Faktoren den Bildungsweg von Migranten und Migrantinnen positiv beeinflussen können. Das Ziel hierbei ist es, positive Unterstützungsmöglichkeiten im Bildungsverlauf von Migranten und Migrantinnen aufzuzeigen und somit Lösungsansätze für die Praxis zu veranschaulichen.
Zur Klärung dieser Fragestellung, werden zunächst wichtige, das Thema betreffende Begriffe und theoretische Hintergründe beleuchtet, welche zur Bearbeitung der Thematik wichtig sind. Im Folgenden werden drei erfolgreiche Bildungsbiographien von Sinti und Roma vorgestellt, aus denen im Anschluss die jeweiligen unterstützenden Faktoren herausgearbeitet werden. Zur theoretischen Untermauerung sozialer Ungleichheiten, die sich auf die Bildung auswirken können und um die Möglichkeiten zu veranschaulichen, welche eine Person trotz ihrer sozialen Herkunft nutzen kann, wird die Kapitaltheorie Bourdieus herangezogen. Die Inhalte der Beispielbiographien werden im Anschluss mit den Grundaussagen der Theorie verknüpft, um Erklärungsansätze für das Gelingen der jeweiligen Bildungsbiographien zu liefern.
Schlussendlich wird zusammengefasst, was erforderlich ist, um Bildungserfolge von Migranten und Migrantinnen zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen und Begriffsdefinitionen
- Bildungsbegriffe
- Definition Bildung
- Definition Bildungserfolg
- Bildungsungleichheit
- Migration und Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland
- Migration
- Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland
- Sinti und Roma
- Antiziganismus
- Die Bildungssituation von Sinti und Roma in Deutschland
- Bildungsbegriffe
- Erfolgreiche Bildungsverläufe von Sinti und Roma
- Fallbeispiele erfolgreicher Bildungsverläufe von Sinti und Roma
- Herausarbeiten der unterstützenden Faktoren aus den Beispielen
- Verknüpfung der Beispiele mit der Kapitaltheorie von Bourdieu
- Die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu
- Verknüpfung der Fallbeispiele mit der Kapitaltheorie von Bourdieu
- Was braucht es also für den Bildungserfolg von Migranten und Migrantinnen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der bildungsbezogenen Lage von Migranten und Migrantinnen in Deutschland, mit besonderem Fokus auf die Bildungssituation von Sinti und Roma. Das Ziel ist es, Faktoren zu identifizieren, die den Bildungsweg von Migranten und Migrantinnen positiv beeinflussen können und Lösungsansätze für die Praxis aufzuzeigen.
- Bildungsungleichheit im deutschen Bildungssystem
- Die Bildungssituation von Sinti und Roma in Deutschland
- Erfolgreiche Bildungsbiographien von Sinti und Roma
- Die Rolle von Kapital und sozialer Herkunft im Bildungserfolg
- Lösungsansätze für die Verbesserung der Bildungssituation von Migranten und Migrantinnen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bildungsungleichheiten im deutschen Bildungssystem ein und beleuchtet die besondere Relevanz dieses Themas im Kontext der aktuellen Migrationsbewegungen. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar: Welche Faktoren können den Bildungsweg von Migranten und Migrantinnen positiv beeinflussen?
- Theoretische Grundlagen und Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel erläutert wichtige Begriffe wie Bildung, Bildungserfolg und Bildungsungleichheit. Es gibt auch einen Überblick über die Situation von Migranten und Migrantinnen in Deutschland, insbesondere Sinti und Roma, und stellt das Phänomen des Antiziganismus dar.
- Erfolgreiche Bildungsverläufe von Sinti und Roma: Dieses Kapitel präsentiert Fallbeispiele von erfolgreichen Bildungsbiographien von Sinti und Roma. Es untersucht die Faktoren, die diese Erfolge ermöglichten, und beleuchtet die individuellen Herausforderungen und Chancen dieser Personen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Bildung, Bildungsungleichheit, Migration, Sinti und Roma, Antiziganismus, Kapitaltheorie von Bourdieu, und Erfolgsfaktoren im Bildungsverlauf von Migranten und Migrantinnen. Die Forschungsarbeit zielt darauf ab, die bestehenden Bildungsungleichheiten und die besonderen Herausforderungen von Sinti und Roma im Bildungssystem zu beleuchten und Lösungsansätze für eine gerechtere Bildungsgestaltung zu entwickeln.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Bildungsungleichheiten bei Sinti und Roma so ausgeprägt?
Ursachen liegen oft in der sozialen Herkunft, struktureller Benachteiligung im Schulsystem sowie historisch gewachsenem Antiziganismus und Vorurteilen.
Wie hilft Bourdieus Kapitaltheorie den Bildungserfolg zu erklären?
Bourdieu zeigt, dass der Erfolg nicht nur vom Fleiß abhängt, sondern vom kulturellen, sozialen und ökonomischen Kapital, das Kinder aus ihrem Elternhaus mitbringen.
Welche Faktoren beeinflussen den Bildungsweg von Migranten positiv?
Unterstützende Faktoren sind familiärer Rückhalt, Mentoren, gezielte Sprachförderung und die Anerkennung der eigenen kulturellen Identität im Bildungssystem.
Was versteht man unter Antiziganismus?
Antiziganismus bezeichnet eine spezifische Form des Rassismus gegenüber Sinti und Roma, die oft zu Ausgrenzung und geringeren Bildungschancen führt.
Gibt es Beispiele für erfolgreiche Bildungsbiographien bei Sinti und Roma?
Ja, die Forschung zeigt Fälle, in denen Individuen trotz widriger Umstände durch hohe Eigenmotivation und externe Unterstützung akademische Erfolge erzielen konnten.
- Quote paper
- Theresia Schützendorf (Author), 2020, Bildungserfolg von Migranten. Bildungsbiographische Betrachtung am Beispiel von Sinti und Roma in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1118917