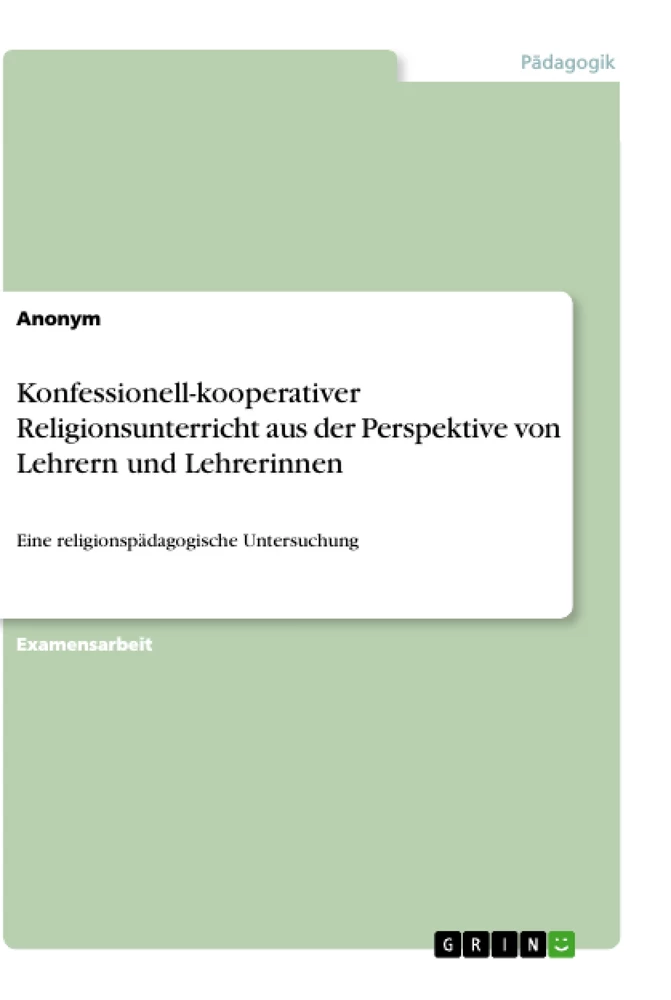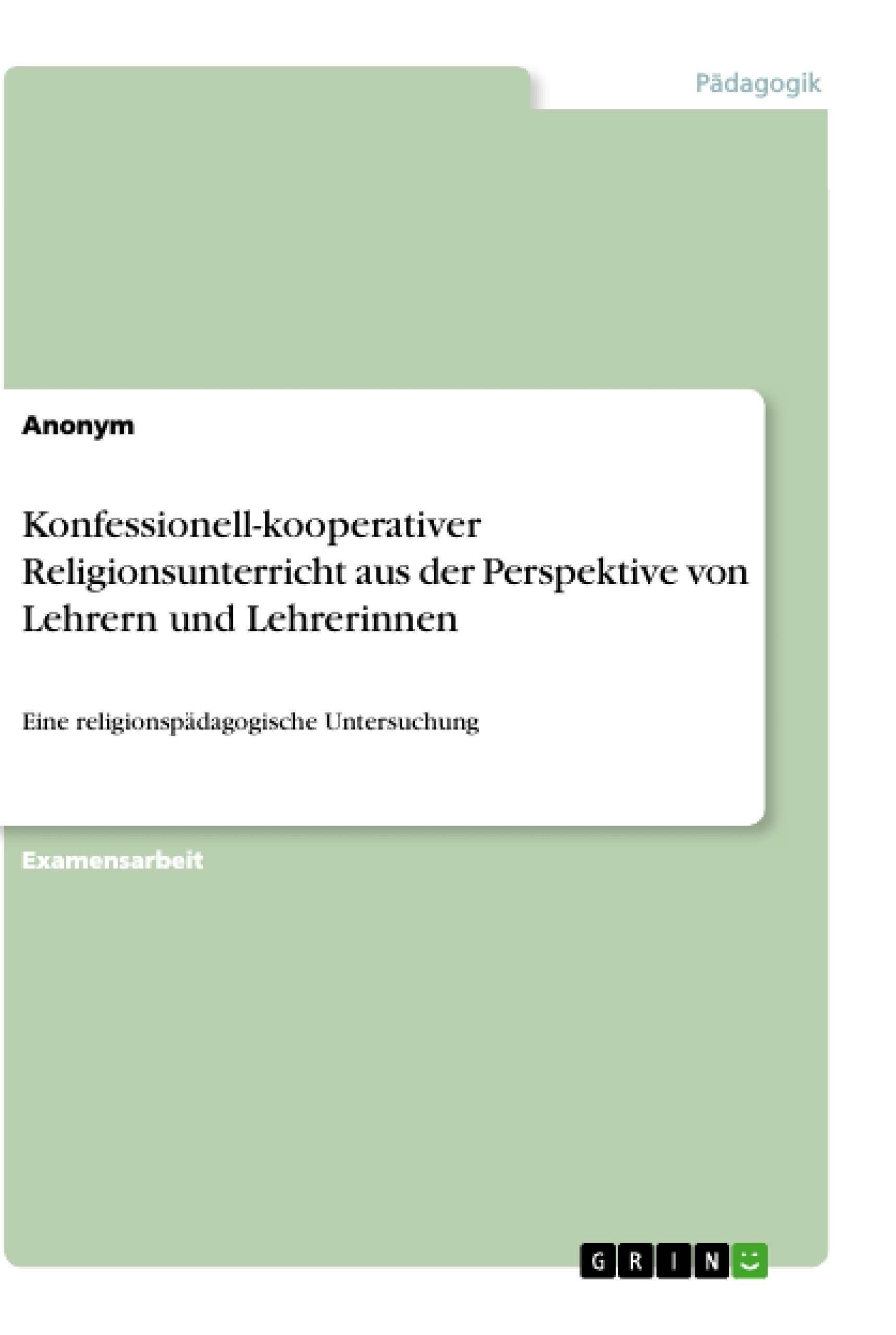In dieser Arbeit wird der konfessionell-kooperative Religionsunterricht aus der Perspektive von Religionslehrkräften anhand empirischer Befunde und einer kleinen empirischen Befragung - anhand eines eigens erstellten Fragebogens - analysiert.
Im Jahr 1994 legten die Autorinnen und Autoren der EKD-Denkschrift den Grundstein für den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in Deutschland. Sie begründeten dabei einen neuen Umgang mit Konfessionalität im Religionsunterricht. Um die evangelische und die katholische Konfession mit ihrer je eigenen reichen Tradition zu erhalten und trotzdem ein gemeinsames Lernen evangelischer und katholischer Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, schlugen sie in dieser Denkschrift vor, die Trias von der Konfessionszugehörigkeit der Lehrenden, die konfessionell geprägten Lehrpläne und die Konfessionalität der SuS, an mindestens einer Stelle aufzubrechen: SuS sollten wenigstens phasenweise gemeinsam lernen und der Religionsunterricht sollte sowohl getrennt als auch zeitweise gemeinsam durchgeführt werden.
Auch wenn es noch einige Jahre dauerte, bis Niedersachsen als erstes Bundesland 1998 offiziell das Modell des KKRU eingeführt hat, wird heute – 27 Jahre später – u.a. in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder auch in Hessen auf Antrag, konfessionell-kooperativer Religionsunterricht erteilt. Mittlerweile unterrichten, mit steigender Tendenz, über 1.500 Schulen in ganz Deutschland konfessionell-kooperativ.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Forschungsüberblick zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht
- 1. Das Tübinger Modell
- 1.1 Gemeinsamkeiten stärken — Unterschieden gerecht werden
- 1.1.1 Was denken die Religionslehrerinnen und Religionslehrer über die konfessionelle Kooperation?
- 1.1.2 Wie sehen die Religionslehrerinnen und Religionslehrer ihre Schülerinnen und Schüler in religiöser und konfessioneller Hinsicht?
- 1.1.3 Wie beurteilen die Religionslehrerinnen und Religionslehrer den Unterricht und die Unterrichtsvorbereitung?
- 1.1.4 Was denken die Religionslehrerinnen und Religionslehrer über die Zukunft des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts?
- 1.1.5 Resümee
- 1.2 Dialogischer Religionsunterricht
- 1.2.1 Das Fehlen konfessioneller Prägungen und die Möglichkeit konfessionell kooperativen Unterrichts
- 1.2.2 Die konfessionelle Prägung der Schülerinnen und Schüler
- 1.2.3 Chancen konfessioneller Kooperation
- 1.2.4 Achtsamkeit und konfessionelle Kooperation
- 1.2.5 Evangelisch und katholisch aus Sicht der Religionslehrerinnen und Religionslehrer
- 1.2.6 Effekte der konfessionellen Kooperation aus Sicht der Religionslehrerinnen und Religionslehrer
- 1.2.7 Themen, die sich konfessionell-kooperativ umsetzen lassen
- 1.2.8 Wie sehen Religionslehrerinnen und Religionslehrer den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht?
- 1.2.9 Resümee
- 1.1 Gemeinsamkeiten stärken — Unterschieden gerecht werden
- 2. Die Evaluation des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in Baden-Württemberg
- 2.1 Motive und Vorbehalte gegenüber konfessionellen-kooperativen Religionsunterricht
- 2.2 Teamarbeit als Bereicherung
- 2.3 Der Religionslehrerinnen- und Religionslehrerwechsel
- 2.4 Die Vorstellungen von einer idealen KKRU-Fortbildung
- 2.5 Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht stärkt den Religionsunterricht
- 2.6 Resümee
- 3. Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht in Niedersachsen
- 3.1 Die Vorbereitung auf den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht
- 3.2 Die Durchführung und Wahrnehmung der konfessionellen Kooperation
- 3.3 Die Zukunft des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts
- 3.4 Resümee
- 4. Weitere Studien verkürzt dargestellt
- 4.1 Religionslehrerinnen- und Religionslehrerstudie 2003 in Baden-Württemberg
- 4.2 Befragung von evangelischen Religionslehrkräften 2013 von der Evangelischen Kirche im Rheinland
- 4.3 Befragung von angehenden Religionslehrerinnen und Religionslehrern im Lehramtsstudium
- 4.3.1 Befragung von Studierenden der Theologie und Religionspädagogik
- 4.3.2 Konfessionell-kooperatives Seminar an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe
- 1. Das Tübinger Modell
- II. Wissenschaftlicher / Empirischer Teil
- 1. Einleitung
- 2. Der Fragebogen 2021
- 3. Das Interview
- 4. Die qualitative Analyse
- 5. Ergebnisse, Diskussion und Vergleich der Experteninterviews
- A. Formale Informationen
- B. Die Konfession der Religionslehrerinnen und Religionslehrer
- C. Die Konfession der Schülerinnen und Schüler
- D. Der konfessionell-kooperative Unterricht
- E. Der konfessionell-kooperative Unterricht aus Sicht der RuR
- F. Digitalisierung und Corona
- 6. Resümee
- III. Didaktische Herausforderungen
- 1. Erforderliche Kompetenzen für den KKRU
- 1.1 Religionspädagogische Reflexionsfähigkeit
- 1.2 Religionspädagogische Gestaltungskompetenz
- 1.3 Religionspädagogische Förderkompetenz
- 1.4 Religionspädagogische Dialog- und Diskurskompetenz
- 2. Veränderungen in der Religionslehrerinnen und -lehrerbildung
- 2.1 Das Studium (1. Phase)
- 2.2 Referendariat (2. Phase)
- 2.3 Fort- und Weiterbildung (3. Phase)
- 3. Resümee
- 1. Erforderliche Kompetenzen für den KKRU
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erforschung des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts (KKRU) aus der Perspektive der Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Sie analysiert die Ergebnisse verschiedener Studien zum KKRU und untersucht die Herausforderungen, die sich aus der Einführung des KKRU für die Religionslehrerinnen und -lehrerbildung ergeben.
- Analyse verschiedener Modelle des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts in Deutschland
- Untersuchung der Perspektiven von Religionslehrerinnen und Religionslehrern auf den KKRU
- Beurteilung der Auswirkungen des KKRU auf die Religionslehrerinnen- und -lehrerbildung
- Identifizierung von notwendigen Kompetenzen für den KKRU
- Bewertung der Rolle des KKRU in der religiösen Bildung in einer pluralistischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem umfassenden Forschungsüberblick zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht. Sie analysiert verschiedene Modelle des KKRU, wie das Tübinger Modell und den Dialogischen Religionsunterricht, und beleuchtet die Perspektiven von Religionslehrerinnen und Religionslehrern auf die Kooperation. Im zweiten Kapitel werden die Ergebnisse einer Evaluation des KKRU in Baden-Württemberg vorgestellt. Hierbei stehen die Motive und Vorbehalte gegenüber dem KKRU, die Teamarbeit als Bereicherung und die Vorstellungen von einer idealen Fortbildung im Fokus. Das dritte Kapitel widmet sich dem KKRU in Niedersachsen und untersucht die Vorbereitung, Durchführung und Wahrnehmung der konfessionellen Kooperation.
Schlüsselwörter
Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht, Religionslehrerinnen und Religionslehrer, KKRU, Religionspädagogik, Interreligiöser Dialog, Evangelische Kirche, Katholische Kirche, Studien, Evaluation, Didaktik, Kompetenzen, Pluralismus, Religionsunterricht, Bildung, Fort- und Weiterbildung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist konfessionell-kooperativer Religionsunterricht (KKRU)?
Beim KKRU lernen evangelische und katholische Schüler gemeinsam. Der Unterricht wird abwechselnd von evangelischen und katholischen Lehrkräften erteilt, wobei die eigene Konfession gewahrt bleibt, aber der Dialog gestärkt wird.
Warum wurde der KKRU eingeführt?
Grundlage war die EKD-Denkschrift von 1994. Ziel ist es, in einer pluralistischen Gesellschaft Gemeinsamkeiten der Konfessionen zu stärken und gleichzeitig den Unterschieden gerecht zu werden, statt getrennten Unterricht für kleine Gruppen anzubieten.
Wie beurteilen Lehrer die konfessionelle Kooperation?
Viele Lehrkräfte empfinden die Teamarbeit und den Austausch über die Konfessionsgrenzen hinweg als Bereicherung für ihre eigene Professionalität, sehen aber auch Herausforderungen in der organisatorischen Vorbereitung.
Welche Kompetenzen benötigen Lehrer für den KKRU?
Erforderlich sind religionspädagogische Reflexionsfähigkeit, Dialogkompetenz sowie die Fähigkeit, die eigene konfessionelle Identität zu vertreten und gleichzeitig offen für die andere Tradition zu sein.
In welchen Bundesländern ist der KKRU verbreitet?
Niedersachsen führte das Modell 1998 als erstes Land ein. Heute wird es auch in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen (auf Antrag) an über 1.500 Schulen praktiziert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht aus der Perspektive von Lehrern und Lehrerinnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119265