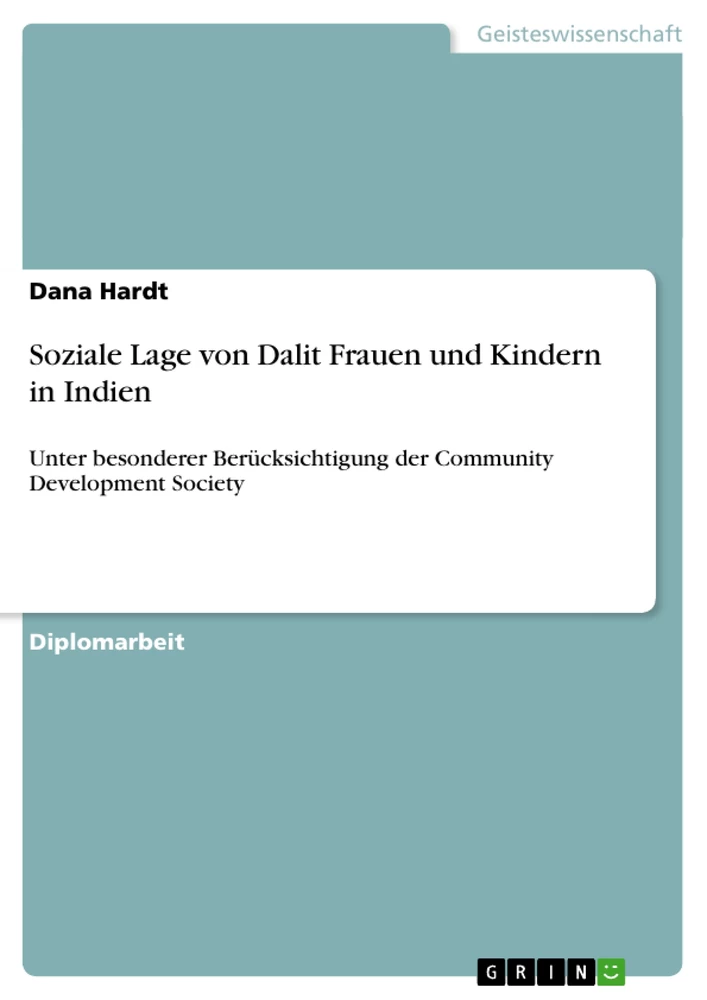Die Vorbereitungen meiner Reise nach Indien begannen bereits im Herbst 2006. Wir waren sieben Studierende der Fachhochschule Frankfurt mit Herrn Philipp Müller, Sozialarbeiter der Evangelischen Studentengemeinde in Frankfurt, der auch die Reiseleitung hatte und sich seit Jahren mit Indien eng verbunden fühlt. Er gab uns
einen ersten Einblick in die indische Wirklichkeit z. B. das Kastensystem, die verbreitete Kinderarbeit und die hygienischen Zustände. Ich hatte zuvor bereits Australien 5 Monate bereist, danach die USA und nun war ich sehr auf Indien gespannt. Während meine beiden ersten Reisen vor allem meiner sprachlichen
Entwicklung dienten, war das Indienpraktikum ganz anders angelegt: Es handelt sich vielmehr um ein Austauschprogramm mit Studierenden der Fachhochschule Frankfurt und Mitarbeitern der Community Development Society in Indien und beinhaltet den Besuch der National Campaign on Dalit Human Rights im Netzwerk für Menschenrechte der Dalits in Delhi und soll Einblicke in die Strukturen der Netzwerkarbeit vor Ort und deren Anbindung an internationale Organisationen gewähren. Indien stellte ich mir als ein hektisches, übervölkertes und schmutziges Land vor, das aber andererseits fröhlich, farbenfroh und geheimnisvoll wirkt. Was wir vor Ort antrafen, war für Europäer unvorstellbar. Hygiene gibt es nicht: Exkremente von Mensch und Tier umgeben die Straßen, Müll und Kadaver kommen hinzu und der Verkehr, der Lärm, der Smog, der Gestank, halbnackte Kinder, armselige Behausungen, Kühe überall Kühe kurzum die miserablen Lebensbedingungen dominierten zunächst meine Eindrücke.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung: meine Indienexkursion
- 2. Intention der Arbeit
- 3. Die indische Gesellschaft - Geschichte, Soziales, Wirtschaft und Politik
- 4. Hinduismus
- 5. Systeme sozialer Ungleichheit
- 5.1 Kastenwesen
- 5.2 Varna und Jati
- 6. Dalits (Unberührbare)
- 6.1 Begriff
- 6.2 Unberührbarkeit
- 6.3 Soziale Situation
- 6.3.1 Das Leben in Dörfern und in Städten
- 6.3.2 Charakteristika
- 6.4 Rechtliche und politische Lage der Frauen im Allgemeinen
- 6.5 Frauen und Kinder
- 6.5.1 Situation
- 6.5.2 Vision
- 7. Lösungsansätze
- 7.1 Indische Regierung
- 7.2 Dalit-Bewegung und NGOs
- 7.3 Beispiel CDS
- 7.3.1 Interview mit Manoj Macwan
- 7.3.2 Projekte
- 8. Kritische Würdigung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziale Lage von Dalit-Frauen und -Kindern in Indien unter besonderer Berücksichtigung der Community Development Society (CDS). Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Herausforderungen und Lösungsansätze zu zeichnen.
- Die soziale und wirtschaftliche Situation der Dalits in Indien
- Das Kastenwesen und seine Auswirkungen auf Dalit-Frauen und -Kinder
- Die Rolle der indischen Regierung und von NGOs bei der Verbesserung der Lebensbedingungen der Dalits
- Die Arbeit der CDS als Beispiel für erfolgreiche Entwicklungsprojekte
- Herausforderungen und Perspektiven für die Verbesserung der Situation von Dalit-Frauen und -Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: meine Indienexkursion: Die Einleitung beschreibt die Reise der Autorin nach Indien im Rahmen eines Austauschprogramms mit der CDS. Sie schildert ihre anfänglichen Eindrücke von Armut, mangelnder Hygiene und den allgegenwärtigen Auswirkungen des Kastensystems. Der Besuch der National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) in Neu Delhi liefert erste Einblicke in die Diskriminierung der Dalits und die Arbeit von Menschenrechtsaktivisten. Ein Besuch an der Kunsthochschule in Delhi und die Begegnung mit dem Dalit-Künstler Savi Sawarkar verdeutlicht die anhaltenden Benachteiligungen, aber auch die Möglichkeiten des Widerstands und des sozialen Aufstiegs. Die Reise führt weiter nach Gujarat, wo die Autorin die CDS kennenlernt.
3. Die indische Gesellschaft - Geschichte, Soziales, Wirtschaft und Politik: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext, muss hinzugefügt werden)
4. Hinduismus: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Originaltext, muss hinzugefügt werden)
5. Systeme sozialer Ungleichheit: Dieses Kapitel beschreibt das Kastenwesen in Indien, seine historischen Wurzeln und seine anhaltende Bedeutung für die soziale Stratifizierung. Es unterscheidet zwischen Varna und Jati und erläutert die Mechanismen der sozialen Ausgrenzung und Diskriminierung, die mit dem Kastenwesen verbunden sind. Die Ausführungen bilden die Grundlage für das Verständnis der sozialen Lage der Dalits in den folgenden Kapiteln.
6. Dalits (Unberührbare): Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Situation der Dalits. Es definiert den Begriff "Unberührbare" und beschreibt die historischen und gegenwärtigen Formen der Diskriminierung und Ausgrenzung, denen Dalits ausgesetzt sind. Es analysiert die soziale Situation der Dalits in ländlichen und städtischen Gebieten und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, denen Dalit-Frauen und -Kinder gegenüberstehen. Der Abschnitt über die rechtliche und politische Lage von Frauen im Allgemeinen bietet einen wichtigen Kontext für die Analyse der Situation von Dalit-Frauen.
7. Lösungsansätze: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Situation der Dalits. Es untersucht die Maßnahmen der indischen Regierung, die Rolle der Dalit-Bewegung und von Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Community Development Society (CDS), deren Arbeit anhand eines Interviews mit Manoj Macwan und der Beschreibung konkreter Projekte detailliert dargestellt wird. Das Kapitel zeigt die Vielfalt der Strategien auf, die zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Dalits eingesetzt werden.
Schlüsselwörter
Dalits, Unberührbare, Indien, Kastenwesen, soziale Ungleichheit, Frauen, Kinder, Community Development Society (CDS), Menschenrechte, Diskriminierung, Armut, Entwicklungsprojekte, NGOs, National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziale Lage von Dalit-Frauen und -Kindern in Indien
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die soziale Lage von Dalit-Frauen und -Kindern in Indien. Sie bietet einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen, denen Dalits gegenüberstehen, und beleuchtet verschiedene Lösungsansätze. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung mit Beschreibung der Autorin's Reise nach Indien, Kapitel zur indischen Gesellschaft, zum Hinduismus, zum Kastenwesen, zur Situation der Dalits (einschließlich ihrer sozialen, rechtlichen und politischen Lage, insbesondere von Frauen und Kindern), sowie zu verschiedenen Lösungsansätzen von der indischen Regierung, der Dalit-Bewegung, NGOs und speziell der Community Development Society (CDS).
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert das Kastenwesen in Indien, seine historischen Wurzeln und seine anhaltenden Auswirkungen auf die soziale Stratifizierung. Sie analysiert die soziale Situation der Dalits in ländlichen und städtischen Gebieten, die spezifischen Herausforderungen von Dalit-Frauen und -Kindern, die Rolle der indischen Regierung und von NGOs, sowie die Arbeit der CDS anhand konkreter Projekte und eines Interviews.
Welche Rolle spielt die Community Development Society (CDS)?
Die CDS dient als Beispiel für erfolgreiche Entwicklungsprojekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Dalits. Die Arbeit beschreibt die Arbeit der CDS detailliert anhand eines Interviews mit Manoj Macwan und der Darstellung konkreter Projekte.
Welche Lösungsansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Lösungsansätze, darunter die Maßnahmen der indischen Regierung, die Rolle der Dalit-Bewegung und von NGOs, und insbesondere die Arbeit der CDS. Es wird die Vielfalt der Strategien zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Dalits aufgezeigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einführung, die die Reise der Autorin nach Indien beschreibt. Weitere Kapitel befassen sich mit der indischen Gesellschaft, dem Hinduismus, dem Kastenwesen, der Situation der Dalits (inkl. Frauen und Kinder), und Lösungsansätzen. Ein abschließendes Kapitel bietet eine kritische Würdigung und einen Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Dalits, Unberührbare, Indien, Kastenwesen, soziale Ungleichheit, Frauen, Kinder, Community Development Society (CDS), Menschenrechte, Diskriminierung, Armut, Entwicklungsprojekte, NGOs, National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR).
Wo finde ich Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält Zusammenfassungen für die Kapitel 1, 5, 6 und 7. Zusammenfassungen für Kapitel 3 und 4 fehlen im Originaltext und müssen ergänzt werden.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit der sozialen Lage von Dalits in Indien. Sie eignet sich für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für dieses Thema interessieren.
Welche Art von Daten enthält die Arbeit?
Die Arbeit enthält OCR-Daten, die aus Publikationen eines Verlags stammen und für die akademische Nutzung bestimmt sind.
- Arbeit zitieren
- Dana Hardt (Autor:in), 2008, Soziale Lage von Dalit Frauen und Kindern in Indien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112339