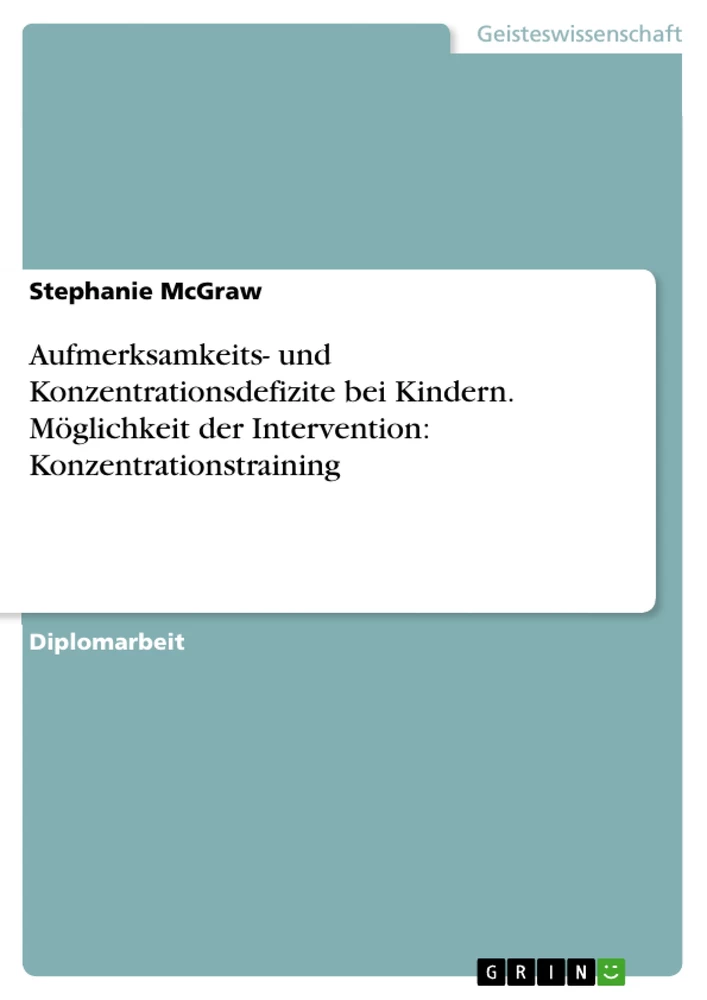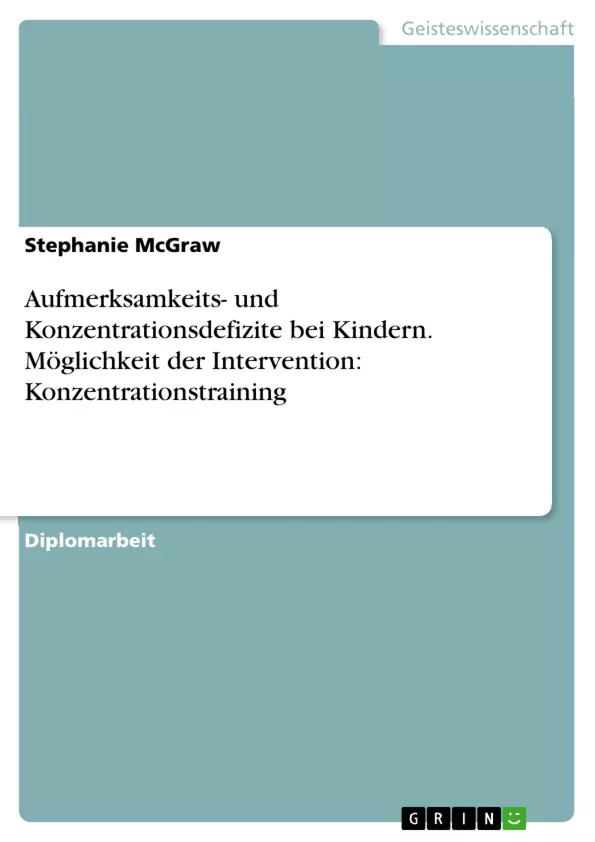Mängel in der Konzentration haben in der Schule häufig Leistungsschwächen zur Folge. Gerade in den letzten Jahrzehnten wurde dieses Thema immer wieder von Psychologen, Pädagogen und Medien thematisiert. Viele Statistiken zeigen, je nach Berücksichtigung des Schwergrades, Schärfe der Kriterien und befragtem Personenkreis, erschreckende Zahlen.
So schreiben Kurth und Büttner (1999) von 9,3% der Schüler, die Probleme in der Aufmerksamkeit und Konzentration aufweisen, in Hessen sind es sogar 13,6%. Befragt man Lehrer aus Rheinland-Pfalz (vgl. Kurth/Büttner 1999), geben diese eine Unkonzentriertheit von 17,5% an. Eltern, die Angaben über ihre Kinder im Grundschulalter machen, steigern diese Zahlen noch auf 23% (vgl. Kurth/Büttner 1999).
Alarmiert durch diese hohen Zahlen und immer mehr Lehrer, die sich über laute Schüler beschweren, die einfach nicht aufpassen können/wollen, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit zum einen mit Konzentrationsdefiziten von Kindern, zum anderen mit einem Konzentrationstrainingsprogramm als mögliche Intervention.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Ziele des Konzentrationstraining
- Theoretischer Teil
- Menschliche Entwicklung
- Geschichtliche Hintergründe
- Begriffsbestimmung: Entwicklung
- Körperliche Entwicklung
- Entwicklung des Selbst
- Emotionale Entwicklung
- Motiv und Motivation
- Leistungsmotiv
- Risiko - Wahl Modell (Anspruchsniveau)
- Kausalattribution für Erfolg und Misserfolg
- Erlernte Hilflosigkeit
- Aufmerksamkeit und Konzentration
- Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration
- Schwierigkeit der Begriffsbestimmung
- Aufmerksamkeit
- Intensität
- Selektivität
- Aufmerksamkeit im Entwicklungsverlauf
- Konzentration
- Das Akku-Modell der Konzentration
- Konzentriertes Arbeiten
- Konzentrationstests
- Konzentrationsprobleme
- Begriffliche Klärung
- Häufigkeit von Konzentrationsproblemen
- Erscheinungsbild
- Ursachen und Hintergründe
- Eigenschaften und Gütekriterien psychologischer Tests
- Begriffsbestimmung für Test
- Objektivität
- Reliabilität
- Validität
- Diagnostik
- Leistungsdiagnostik
- Einteilung der Leistungstests
- Verfahren der Verhaltensbeobachtung
- Konzentrationsmessende Verfahren
- Sortiertests
- Durchstreichetests
- Rechentests
- Ordnungs- und Zuordnungsverfahren (vgl. Wechsler, 1983)
- Gemeinsamkeiten
- Verschiedene Interventionsansätze für Konzentrationsschwäche
- Intervention in der Familie
- Pädagogische Intervention in der Schule
- Therapeutische Hilfen
- Elternberatung und - training
- Konzentrationstrainingsprogramme
- Empirischer Teil
- Allgemein
- Fragestellung
- Hypothesen
- Beschreibung des Designs
- Stichprobenbeschreibung
- Vorbereitungsphase der Untersuchung
- Stichprobe
- Übersichtstabelle der Teilnahme
- Messverfahren TPK (Kurth, Büttner, 1999)
- Konzentrationstrainingsprogramm für Kinder III. 3.und 4.Klasse (Ettrich, 2004)
- Ergebnisse
- Prä/Post - Vergleich TPK
- Gruppenergebnisse KTP
- Sitzungverlauf
- TPK
- KTP
- Fallbeispiel Schüler A aus der dritten Klasse
- Analyse der Ergebnisse hinsichtlich der Hypothesen
- Überprüfung Hypothese 1
- Überprüfung Hypothese 2
- Überprüfung Hypothese 3
- Überprüfung Hypothese 4
- Diskussion
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefiziten bei Kindern und untersucht die Wirksamkeit eines Konzentrationstrainings als mögliche Intervention. Ziel ist es, die Auswirkungen des Konzentrationstrainings auf die Konzentration und Aufmerksamkeit von Kindern im Grundschulalter zu analysieren. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung, die an der Internationalen Schule Augsburg durchgeführt wurde.
- Menschliche Entwicklung und ihre Auswirkungen auf Aufmerksamkeit und Konzentration
- Begriffsbestimmung und Analyse von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefiziten
- Diagnostik von Konzentrationsproblemen bei Kindern
- Verschiedene Interventionsansätze für Konzentrationsschwäche
- Evaluation der Wirksamkeit eines Konzentrationstrainings
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizite bei Kindern ein und stellt die Relevanz des Themas sowie die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Häufigkeit von Konzentrationsproblemen in der Schule und die Herausforderungen, die diese für Eltern, Lehrer und Kinder mit sich bringen.
Der theoretische Teil beschäftigt sich mit der menschlichen Entwicklung, wobei die verschiedenen Entwicklungsbereiche wie die körperliche, emotionale und kognitive Entwicklung beleuchtet werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Aufmerksamkeit und Konzentration, wobei die verschiedenen Aspekte der Aufmerksamkeit und die Bedeutung der Konzentration für den Lernerfolg im Vordergrund stehen.
Weiterhin werden Konzentrationsprobleme im Detail betrachtet, wobei die Ursachen und Hintergründe sowie die verschiedenen Erscheinungsformen von Konzentrationsschwächen analysiert werden.
Der empirische Teil der Arbeit beschreibt das Design der Untersuchung, die Stichprobenbeschreibung und die verwendeten Messverfahren. Es werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und analysiert, wobei die Wirksamkeit des Konzentrationstrainings im Fokus steht.
Die Diskussion der Ergebnisse beleuchtet die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis und die wissenschaftliche Diskussion.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizite, Konzentrationstraining, Kinder, Grundschule, Diagnostik, Intervention, empirische Forschung, Wirksamkeit, Entwicklung, Lernen, Schulische Leistung.
- Quote paper
- Stephanie McGraw (Author), 2007, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizite bei Kindern. Möglichkeit der Intervention: Konzentrationstraining, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112628