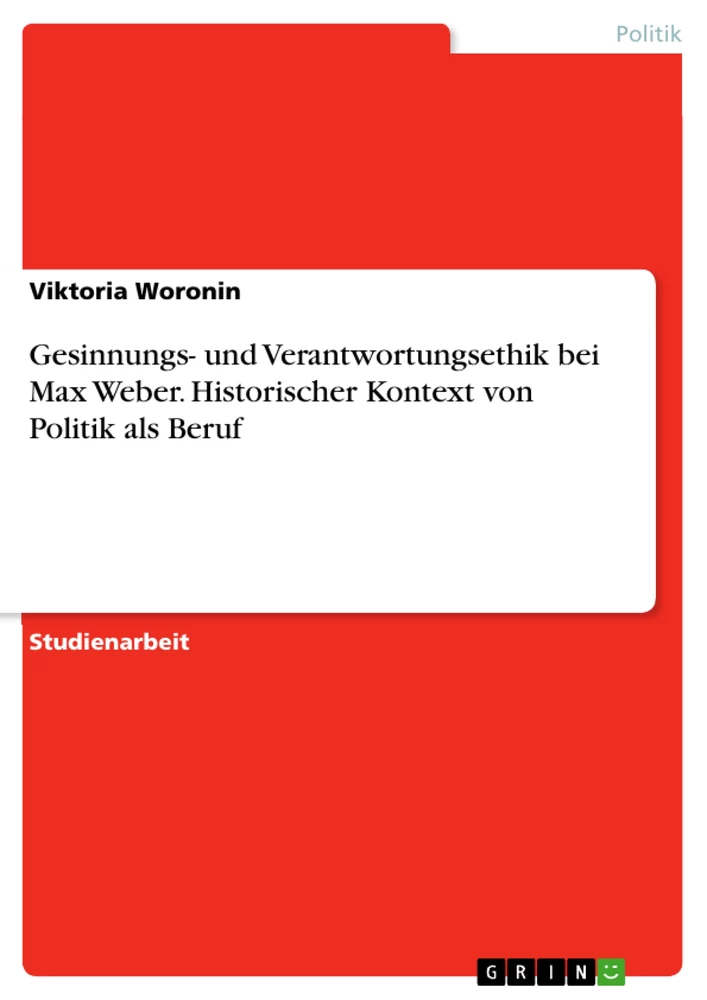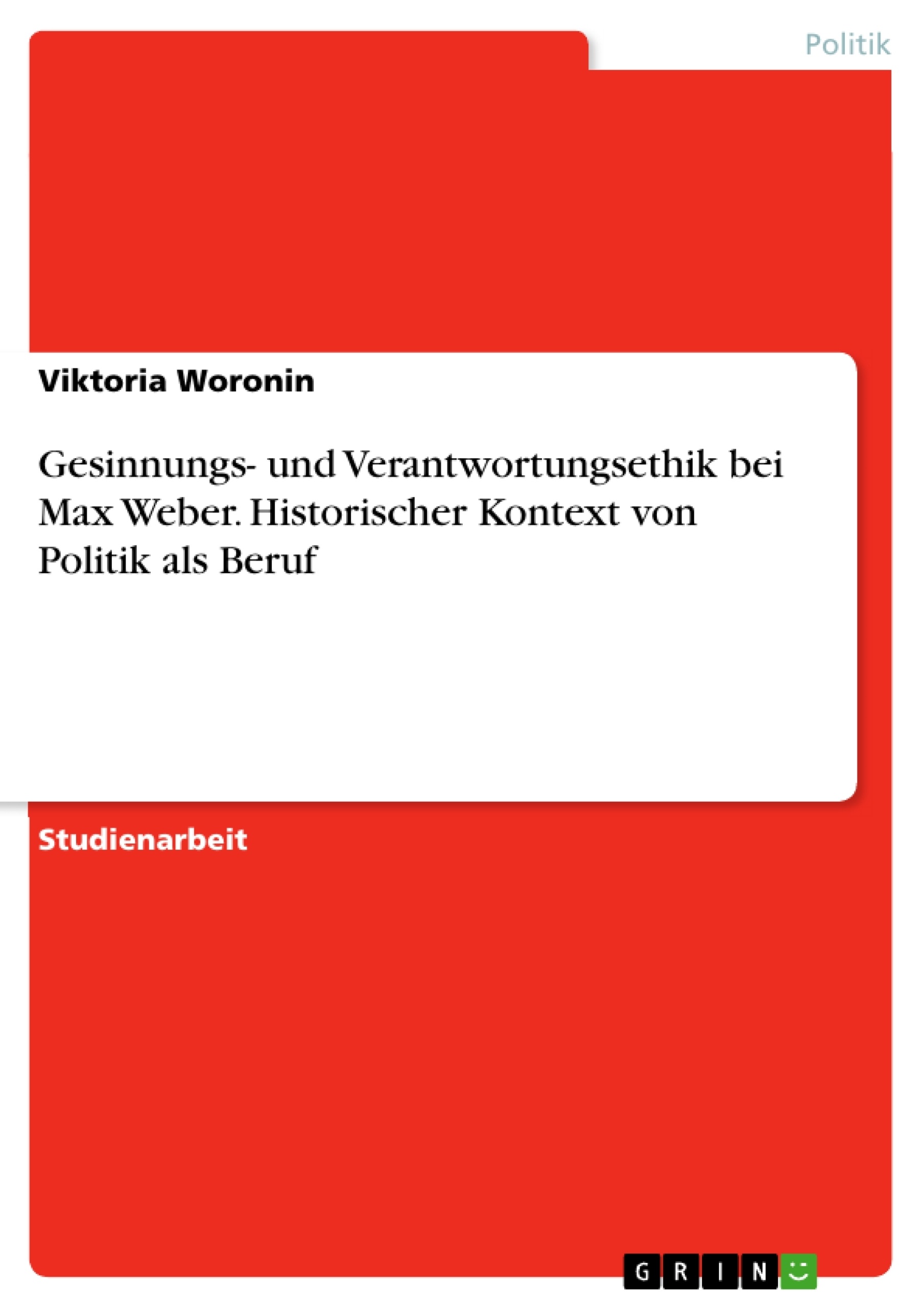Wie ist das Verhältnis zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik bei Max Weber? Zuerst wird geklärt, in welchem historischen Kontext Politik als Beruf entstanden ist, um Webers Thesen besser nachvollziehen zu können. Danach erfolgen Definitionen der Begriffe ‚Politik‘ und ‚Staat‘ sowie der Phrase der ‚Entzauberung der Welt‘, die für das Verständnis der Ethiken Webers grundlegend sind. Es folgen Definitionen der Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Anschließend werden sie miteinander verglichen. Für die Untersuchung, welche Ethik Weber insgesamt bevorzugt, lohnt sich auch die Auseinandersetzung damit, inwiefern er Kritik an der Gesinnungsethik und außerdem an der Erfolgsethik, die er von der Verantwortungsethik abgrenzt, übt. Danach soll resümiert werden, welche Ethik Weber bei einem Politiker präferiert. In diesem Zusammenhang soll auch kurz die soziale Herkunft Webers beleuchtet werden, da hier mögliche Gründe für seine Entscheidung ersichtlich werden. Schließlich wird dargestellt, welche Eigenschaften einen idealen Politiker Weber zufolge ausmachen. Im abschließenden Fazit wird geklärt, ob die Hypothesen verifiziert oder falsifiziert werden können und es werden die wichtigsten Punkte der Einstellung Webers zu den Ethiken genannt.
In der Arbeit sollen zwei Hypothesen verifiziert beziehungsweise falsifiziert werden. Die erste Hypothese lautet: Gesinnungs- und Verantwortungsethik sind keine absolut gegensätzlichen Pole. Die zweite lautet: Weber übt vor allem Kritik an der Gesinnungsethik und zieht ihr die Verantwortungsethik vor. Diese Hypothese ist insofern von Interesse, als sie zur Beantwortung der Frage beiträgt, wie für Weber der ideale Politiker zu sein hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Kontext von Politik als Beruf
- 3. Begriffsdefinitionen
- 3.1 Gesinnungsethik
- 3.2 Verantwortungsethik
- 3.3 Vergleich der beiden Ethiken
- 4. Max Webers Kritik
- 4.1 Kritik an der Gesinnungsethik
- 4.2 Kritik an der Erfolgsethik
- 4.3 Ergebnis und Diskussion
- 5. Zusammenfassung, Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Gesinnungs- und Verantwortungsethik bei Max Weber anhand seiner Schrift "Politik als Beruf". Es werden zwei Hypothesen geprüft: Erstens, dass beide Ethiken keine absolut gegensätzlichen Pole darstellen; zweitens, dass Weber vor allem die Verantwortungsethik der Gesinnungsethik vorzieht. Die Arbeit beleuchtet Webers Kritik an beiden Ethiken und analysiert, welche Eigenschaften er für einen idealen Politiker sieht.
- Max Webers Verständnis von Politik und Staat
- Gesinnungsethik und Verantwortungsethik bei Weber
- Webers Kritik an der Gesinnungsethik und der Erfolgsethik
- Der ideale Politiker nach Weber
- Der historische Kontext von Webers "Politik als Beruf"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Gesinnungs- und Verantwortungsethik bei Max Weber. Sie formuliert zwei Hypothesen: erstens, dass die Ethiken keine gegensätzlichen Pole sind, und zweitens, dass Weber die Verantwortungsethik bevorzugt. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit – die Literaturauswertung – wird ebenfalls dargelegt. Die Einleitung legt den Fokus auf Webers Schrift "Politik als Beruf" als zentrales Analyseinstrument und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Historischer Kontext von Politik als Beruf: Dieses Kapitel bettet Webers "Politik als Beruf" in den historischen Kontext der unmittelbaren Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs und der Entstehung der Weimarer Republik ein. Es beschreibt die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der Novemberrevolution von 1918 und die bürgerkriegsähnlichen Zustände, in denen Weber seine Rede hielt. Das Kapitel betont Webers politische Engagement und die Umstände, die zu seinem Vortrag führten, inklusive der Ablehnung des ersten Kandidaten und der impliziten Abgrenzung von Kurt Eisner, den Weber als Inbegriff eines Gesinnungsethikers sah. Der Kontext wird als entscheidend für das Verständnis von Webers Argumentation dargestellt.
3. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel liefert die notwendigen Begriffsklärungen für das Verständnis der folgenden Analyse. Es definiert Webers Konzepte von "Politik" als Machtstreben und "Staat" als Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit. Das Kapitel erläutert die "Entzauberung der Welt" als wichtigen Kontext für Webers ethische Überlegungen, indem es auf die Ablösung der Politik als eigenständige Wertsphäre von Religion, Wissenschaft und Ethik eingeht und damit die Grundlage für Webers Unterscheidung zwischen den beiden Ethiken legt.
3.1 Gesinnungsethik: Dieser Abschnitt definiert die Gesinnungsethik nach Weber, die sich durch die Orientierung an einem moralischen Ideal auszeichnet und die Ablehnung sittlich gefährlicher Mittel zur Erreichung von Zielen impliziert. Es werden zwei Arten von Gesinnungsethikern unterschieden: diejenigen, die strikt an ihren Idealen festhalten und die Folgen ihres Handelns nicht berücksichtigen und diejenigen, die bereit sind, verwerfliche Mittel zu gebrauchen. Das Kapitel hebt den Absolutheitsanspruch der Ideale hervor und nennt Beispiele wie Wehrdienstverweigerer und Revolutionäre.
Häufig gestellte Fragen zu "Politik als Beruf" - Max Weber
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über Max Webers Schrift "Politik als Beruf". Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und wichtige Schlüsselbegriffe. Der Text analysiert Webers Verhältnis von Gesinnungs- und Verantwortungsethik und prüft zwei Hypothesen: Erstens, dass beide Ethiken keine absolut gegensätzlichen Pole sind; zweitens, dass Weber die Verantwortungsethik der Gesinnungsethik vorzieht.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind Max Webers Verständnis von Politik und Staat, Gesinnungs- und Verantwortungsethik bei Weber, Webers Kritik an beiden Ethiken, der ideale Politiker nach Weber und der historische Kontext von Webers "Politik als Beruf". Der Text beleuchtet den historischen Kontext der Weimarer Republik und die Novemberrevolution von 1918, um Webers Argumentation besser zu verstehen.
Wie definiert der Text Gesinnungs- und Verantwortungsethik?
Der Text definiert die Gesinnungsethik nach Weber als die Orientierung an einem moralischen Ideal, unabhängig von den Folgen. Die Verantwortungsethik hingegen berücksichtigt die Folgen des Handelns und wägt diese gegen das moralische Ideal ab. Der Text unterscheidet verschiedene Arten von Gesinnungsethikern und betont den Absolutheitsanspruch der Ideale bei der Gesinnungsethik.
Welche Kritik übt Weber an beiden Ethiken?
Der Text beschreibt Webers Kritik an der Gesinnungsethik, die er als unrealistisch und oft kontraproduktiv betrachtet, da sie die Folgen des Handelns außer Acht lässt. Seine Kritik an der "Erfolgsethik" (die im Text als Aspekt der Verantwortungsethik verstanden wird) zielt darauf ab, dass eine reine Fokussierung auf den Erfolg zu unethischem Handeln führen kann. Der Text analysiert, wie Weber diese beiden ethischen Positionen gegeneinander abwägt.
Was ist Webers Vorstellung vom idealen Politiker?
Der Text untersucht, welche Eigenschaften Weber für einen idealen Politiker sieht, basierend auf seiner Abwägung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Dabei wird deutlich, dass Weber eine gewisse Balance zwischen beiden Ethiken befürwortet, wobei die Verantwortungsethik im politischen Handeln eine zentrale Rolle spielt.
Welchen historischen Kontext beleuchtet der Text?
Der Text beleuchtet den historischen Kontext der unmittelbaren Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs und der Entstehung der Weimarer Republik. Er beschreibt die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der Novemberrevolution von 1918 und die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die Webers Vortrag beeinflussten. Der Kontext wird als entscheidend für das Verständnis von Webers Argumentation dargestellt.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Historischer Kontext von Politik als Beruf, Begriffsdefinitionen (mit Unterkapiteln zu Gesinnungsethik und Verantwortungsethik), Max Webers Kritik und Zusammenfassung, Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel wird im Text kurz zusammengefasst.
Welche Hypothese(n) werden geprüft?
Der Text prüft zwei Hypothesen: Erstens, dass Gesinnungs- und Verantwortungsethik keine absolut gegensätzlichen Pole darstellen; und zweitens, dass Weber die Verantwortungsethik der Gesinnungsethik vorzieht.
- Citation du texte
- Viktoria Woronin (Auteur), 2016, Gesinnungs- und Verantwortungsethik bei Max Weber. Historischer Kontext von Politik als Beruf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1126904