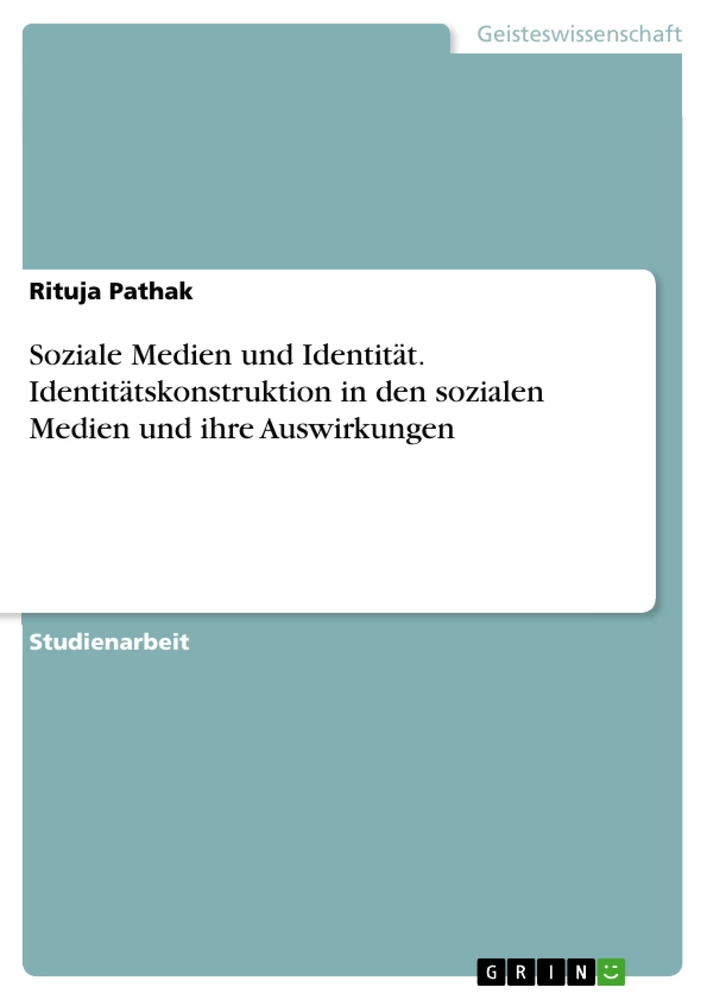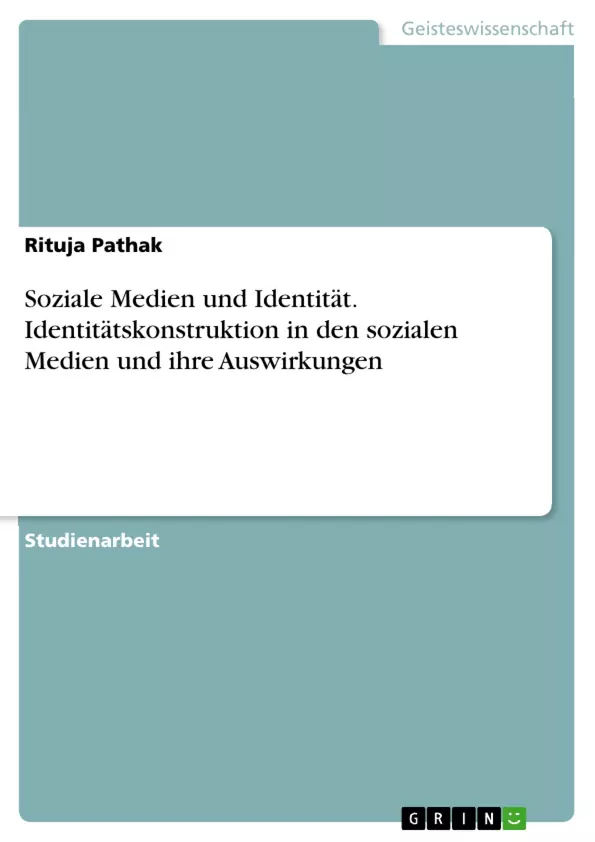In dieser Arbeit wird untersucht, warum die Menschen das Bedürfnis verspüren, eine Online-Identität zu konstruieren und auf welche Art und Weise sie eine Selbstpräsentation vorführen, und ob sie dabei eine völlige Agens haben. Außerdem geht diese Arbeit auch auf die Frage ein, was für Auswirkungen die digitale Identität auf die Offline-Identität und das Leben der Menschen haben oder ob sie überhaupt einen Einfluss auf die Offline-Identität des Menschen übt.
Die vorliegende Arbeit wird in drei Teilen gegliedert: Einleitung, Hauptteil und Schluss. Zuallererst wird eine Einleitung zu dem Thema gegeben, wobei die Zielsetzung, Herangehensweise auch vorgestellt werden. Der Hauptteil wird dann in drei Unterteilen aufgegliedert. Im ersten Unterteil mit dem Titel "Persönliche und Soziale Identität" werden zwei sozio-psychologischen Theorien der Identität, eine von Tajfel und Turner und eine von Jean-Claude Kaufmann, herangezogen, um einen Überblick darüber zu geben, was unter Identität zu verstehen ist, wie sie sich bildet und welche Funktion sie erfüllt. Der zweite Unterteil heißt "Identitätskonstruktion in den sozialen Medien", wobei sich mit den ersten zwei Forschungsfragen auseinandergesetzt wird. Im dritten Unterteil mit dem Titel "Auswirkung der Online-Identität auf die Offline-Identität" wird die dritte Forschungsfrage beantwortet. Bei der Beantwortung aller Forschungsfragen wird ein Bezug auf verschiedene Forschungsergebnisse/Forscher und Medientheoretiker genommen. Die Arbeit endet dann mit dem dritten Teil der Arbeit d.h. dem Schluss.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Zielsetzung
- 1.2. Herangehensweise
- 2. Hauptteil
- 2.1. Persönliche und soziale Identität
- 2.2. Identitätskonstruktion in den sozialen Medien
- 2.3. Auswirkung der Online-Identität auf die Offline-Identität
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie soziale Medien die Konstruktion und Gestaltung von Identität beeinflussen. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen zu beleuchten, die sich aus der Interaktion zwischen online und offline Identität ergeben. Dabei wird untersucht, wie Menschen in sozialen Medien ihre Identität darstellen und wie sich diese online Identität auf ihr reales Leben auswirkt.
- Die Konstruktion von persönlicher und sozialer Identität
- Die Rolle sozialer Medien bei der Gestaltung von Online-Identitäten
- Die Auswirkungen von online-Identitäten auf offline-Identitäten
- Der Einfluss von sozialen Medien auf das Selbstbild und das Selbstverständnis von Menschen
- Das Phänomen des "Personal Branding" in sozialen Medien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Diese Einleitung führt in die Thematik der sozialen Medien und Identität ein. Sie stellt die Zielsetzung der Arbeit vor und beschreibt die Herangehensweise, die in den folgenden Kapiteln verfolgt wird.
2. Hauptteil
2.1. Persönliche und soziale Identität
Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der persönlichen und sozialen Identität. Es werden zwei sozio-psychologische Theorien vorgestellt, die ein Verständnis für die Entstehung und Funktion von Identität im Allgemeinen liefern.
2.2. Identitätskonstruktion in den sozialen Medien
In diesem Kapitel werden die Möglichkeiten und Herausforderungen der Identitätskonstruktion in sozialen Medien erörtert. Es wird untersucht, wie Menschen in sozialen Medien ihre Identität präsentieren und welche Strategien sie dabei verfolgen.
2.3. Auswirkung der Online-Identität auf die Offline-Identität
Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, inwieweit die online Identität die offline Identität und das reale Leben von Menschen beeinflusst. Es werden verschiedene Forschungsergebnisse und Medientheoretiker herangezogen, um diese komplexe Beziehung zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Soziale Medien, Identität, Online-Identität, Offline-Identität, Identitätskonstruktion, Selbstbild, Selbstpräsentation, Social Identity Theory, Personal Branding, Mediennutzung, Digitalisierung, Interaktion, Feedback, Einfluss, digitale Lebenswelt.
- Quote paper
- Rituja Pathak (Author), 2021, Soziale Medien und Identität. Identitätskonstruktion in den sozialen Medien und ihre Auswirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127664