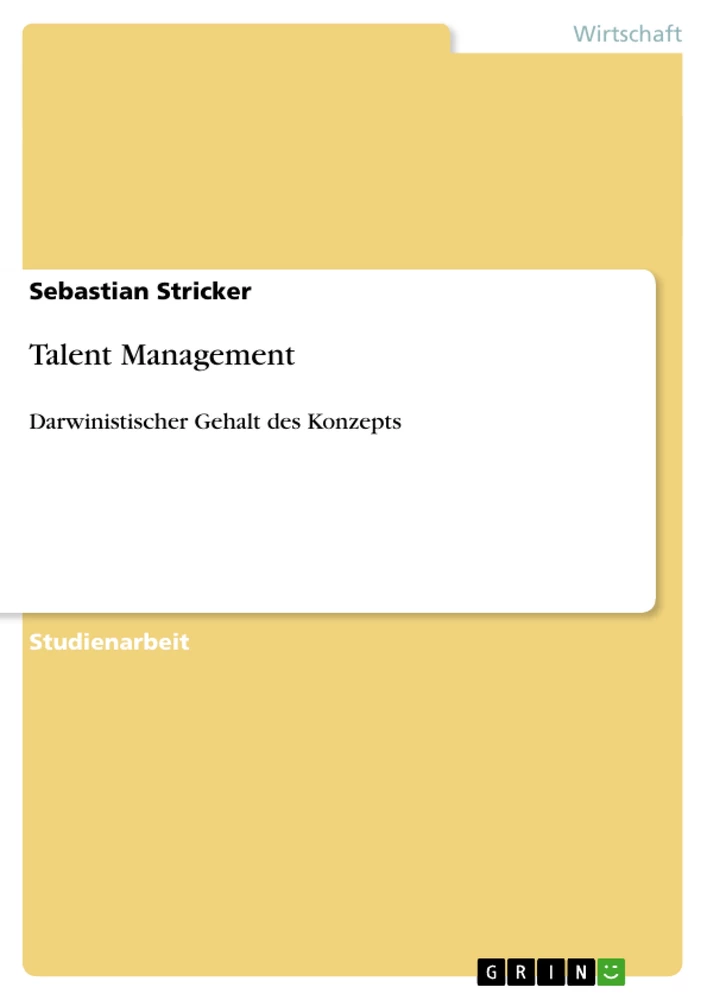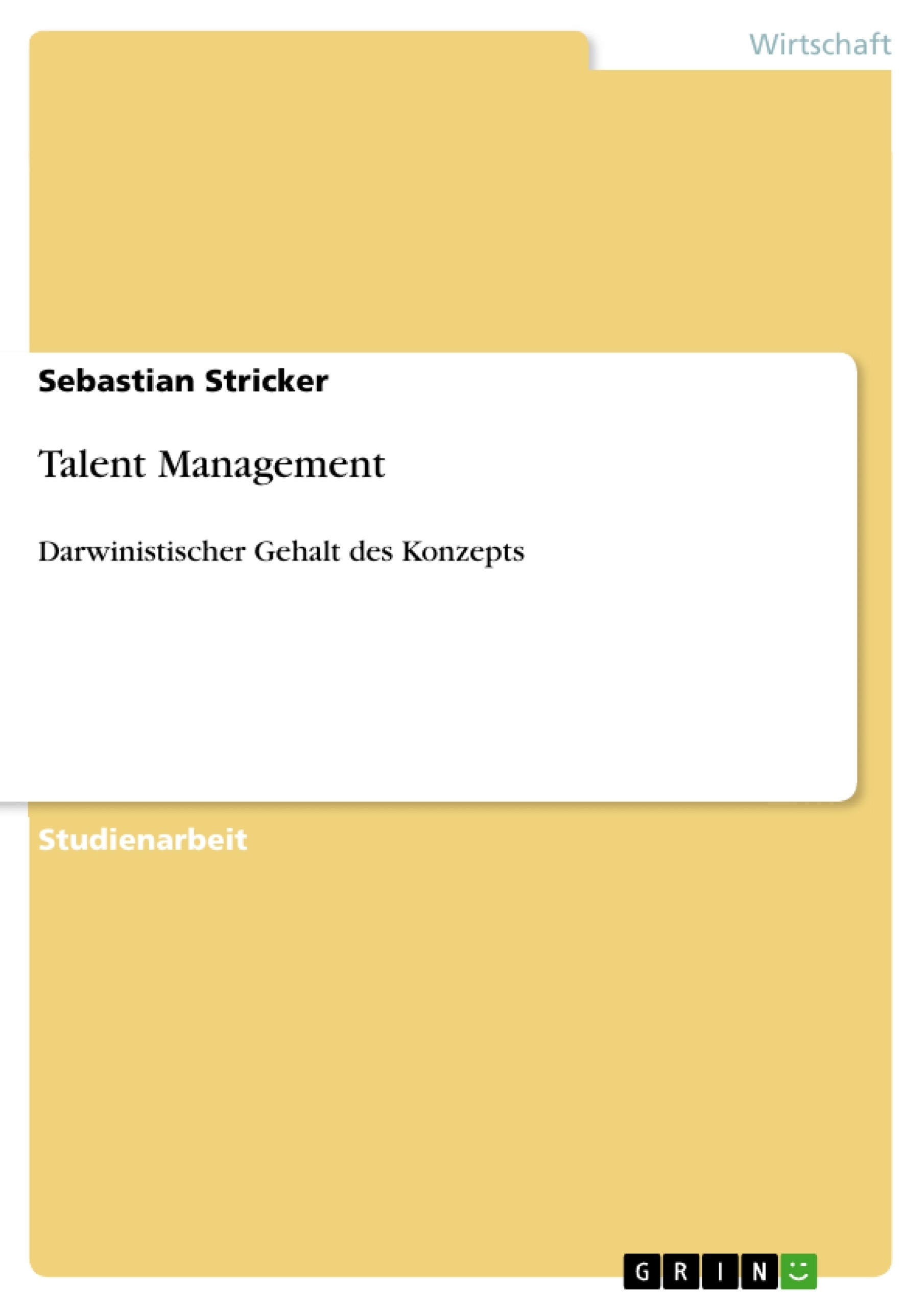Quo vadis Personalarbeit? Diese Frage stellen sich Verantwortliche von Unternehmen immer häufiger und aktuell wird diese zunehmend mit dem Schlagwort des sogenannten „Talent Managements“ beantwortet.
In Deutschland, wie in anderen fortgeschrittenen Gesellschaften zeigt sich seit Jahrzehnten eine Verlagerung der Wirtschaftsaktivität vom sekundären in den tertiären Bereich, was zur Folge hat, dass immer weniger Menschen in Bereichen der einfachen Handarbeit tätig sind, sondern hochwertigere Kopf- und Wissensarbeit bewältigen müssen. Tätigkeiten mit einem geringeren Qualifikationsbedarf werden in Schwellen- und Entwicklungsländer ausgelagert
oder, wo möglich, durch Automation ersetzt. Schätzungen gehen davon aus, dass mittlerweile 50 % der Wertschöpfung eines Produkts auf intellektuelle Inputs zurückzuführen sind (z.B. F&E, Design und begleitende Services).
Laut einer Studie unter 5000 weltweit operierenden Firmen setzt sich deren Gesamtwert mittlerweile zu 62 % aus „Intangible Assets“ (Goodwill, Geistiges Eigentum und Humankapital) zusammen. Beschränkt man sich auf einzelne Sektoren, wie z.B. die Werbe- oder Pharmaziebranche, so verwundert es nicht, dass hier nahezu 100 % bzw. 89 % des Wertes durch immaterielle Güter erreicht wird. Bei einer Gesamtbetrachtung zeigt sich allerdings, dass die kumulierten Wertsteigerungen der hier untersuchten Firmen von 9,4 Billionen US $ zwischen 2001 und 2006, nur zu 36 % auf materielle Vermögenswerte zurückzuführen sind und das quer durch alle Branchen. Somit liegt hier eine allgemeingültige
Tendenz mit globalem Ausmaß vor, die durch die Verschmelzung der Märkte, Digitalisierung und virtuelle Vernetzung überall besondere Gültigkeit erlangt, wo Unternehmen sich zunehmend nicht mehr durch ihre Produkte und Dienstleistungen, sondern verstärkt durch ihre Mitarbeiter und die Unternehmenskultur differenzieren.
Die Märkte unterliegen einem ständigen Wandel. Doch sowohl Tempo als auch Intensität nehmen zu und führen oftmals zu überraschenden Ergebnissen, bei denen traditionelle Regeln nicht mehr zu gelten scheinen. Unternehmen entlassen massenhaft Mitarbeiter und attestieren zugleich einen Personalmangel in ausgewählten Bereichen. Personalvermittler und Headhunter haben Hochkonjunktur, da Unternehmen für die gerade gesuchten Fachkräfte hohe Summen zahlen und zugleich oftmals genau so hohe, um sich von unliebsamen zu trennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ausgangslage und Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Seminararbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Talent Management
- 2.2 Darwinismus
- 3. Untersuchungsrahmen
- 3.1 Mentales Modell
- 3.2 Methodik
- 4. Untersuchung
- 4.1 Identifikation
- 4.2 Gewinnung
- 4.3 Bindung (Entwicklung)
- 5. Ergebnis
- 5.1 Zusammenfassung
- 5.2 Limitationen
- 5.3 Implikationen für die Forschung
- 5.4 Implikationen für die Praxis
- 5.5 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den darwinistischen Gehalt des Konzepts des Talent Managements. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen evolutionären Prinzipien und den Strategien des Talent Managements aufzuzeigen und deren praktische Relevanz für Unternehmen zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Anwendung der Grundidee der Evolution im Kontext des Talent Managements, nicht auf eine umfassende Darstellung des Darwinismus selbst.
- Die Bedeutung von Talent Management im Kontext des wirtschaftlichen Wandels.
- Die Übertragbarkeit darwinistischer Prinzipien auf die Personalwirtschaft.
- Die Identifizierung, Gewinnung und Bindung von Talenten im Lichte des Darwinismus.
- Implikationen für die Unternehmenspraxis und zukünftige Forschung.
- Entwicklung eines mentalen Modells für das Talent Management im darwinistischen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die zunehmende Bedeutung von Talent Management im Kontext des wirtschaftlichen Wandels und der Auslagerung von Tätigkeiten mit geringer Qualifikation. Sie hebt die steigende Wertschöpfung durch immaterielle Güter hervor und führt den Darwinismus als relevantes Erklärungsmodell für Wettbewerbsprozesse in der Wirtschaft ein. Der Abschnitt stellt die zentrale Forschungsfrage nach den darwinistischen Tendenzen im Talent Management und deren Implikationen für Unternehmen.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe "Talent" und "Talent Management" und grenzt diese voneinander ab. Es werden die relevanten Aspekte des Darwinismus vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit auf das Talent Management angewendet werden. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung beider Konzepte und der Schaffung einer theoretischen Grundlage für die empirische Untersuchung.
3. Untersuchungsrahmen: In diesem Abschnitt wird das methodische Vorgehen der Arbeit detailliert beschrieben, einschließlich der Entwicklung eines mentalen Modells, welches die Untersuchung der darwinistischen Aspekte im Talent Management strukturiert. Die Methodik wird erläutert, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
4. Untersuchung: Dieses Kapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse der Untersuchung, die sich auf die Identifizierung, Gewinnung und Bindung von Talenten konzentrieren. Es werden die darwinistischen Tendenzen in diesen drei Bereichen analysiert und anhand konkreter Beispiele illustriert. Die Ergebnisse liefern die Grundlage für die Schlussfolgerungen im folgenden Kapitel.
Schlüsselwörter
Talent Management, Darwinismus, Evolution, Personalwirtschaft, Wettbewerb, Wertschöpfung, immaterielle Güter, Identifikation, Gewinnung, Bindung, Unternehmenskultur, mentales Modell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Darwinistische Tendenzen im Talent Management
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den darwinistischen Gehalt des Konzepts des Talent Managements. Sie beleuchtet die Zusammenhänge zwischen evolutionären Prinzipien und den Strategien des Talent Managements und deren praktische Relevanz für Unternehmen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung von Talent Management im Kontext des wirtschaftlichen Wandels, die Übertragbarkeit darwinistischer Prinzipien auf die Personalwirtschaft, die Identifizierung, Gewinnung und Bindung von Talenten im Lichte des Darwinismus, Implikationen für die Unternehmenspraxis und zukünftige Forschung sowie die Entwicklung eines mentalen Modells für das Talent Management im darwinistischen Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Untersuchungsrahmen, Untersuchung und Ergebnis. Die Einleitung stellt die Problemstellung und Zielsetzung vor. Die Theoretischen Grundlagen definieren zentrale Begriffe und präsentieren relevante Aspekte des Darwinismus. Der Untersuchungsrahmen beschreibt die Methodik und das mentale Modell. Das Kapitel "Untersuchung" präsentiert die empirischen Ergebnisse zur Identifizierung, Gewinnung und Bindung von Talenten. Das Ergebniskapitel fasst die Ergebnisse zusammen, benennt Limitationen und gibt Implikationen für Forschung und Praxis an.
Was sind die zentralen Forschungsfragen der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche darwinistischen Tendenzen lassen sich im Talent Management identifizieren und welche Implikationen ergeben sich daraus für Unternehmen?
Welche Methodik wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die verwendete Methodik, inklusive der Entwicklung eines mentalen Modells zur strukturierten Untersuchung der darwinistischen Aspekte im Talent Management. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse wird gewährleistet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Talent Management, Darwinismus, Evolution, Personalwirtschaft, Wettbewerb, Wertschöpfung, immaterielle Güter, Identifikation, Gewinnung, Bindung, Unternehmenskultur, mentales Modell.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Das Kapitel "Untersuchung" präsentiert die empirischen Ergebnisse, die sich auf die Identifizierung, Gewinnung und Bindung von Talenten konzentrieren. Die darwinistischen Tendenzen in diesen Bereichen werden analysiert und anhand konkreter Beispiele illustriert. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Schlussfolgerungen im letzten Kapitel.
Welche Limitationen werden in der Arbeit angesprochen?
Das Ergebniskapitel benennt die Limitationen der Studie, um die Aussagekraft der Ergebnisse einzuschränken und mögliche Schwächen aufzuzeigen.
Welche Implikationen ergeben sich für die Praxis und die Forschung?
Die Arbeit zieht Implikationen für die Unternehmenspraxis und zukünftige Forschung aus den gewonnenen Ergebnissen. Diese Implikationen bieten Ansatzpunkte für weiterführende Untersuchungen und die praktische Anwendung der Erkenntnisse.
- Quote paper
- Sebastian Stricker (Author), 2008, Talent Management, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112974