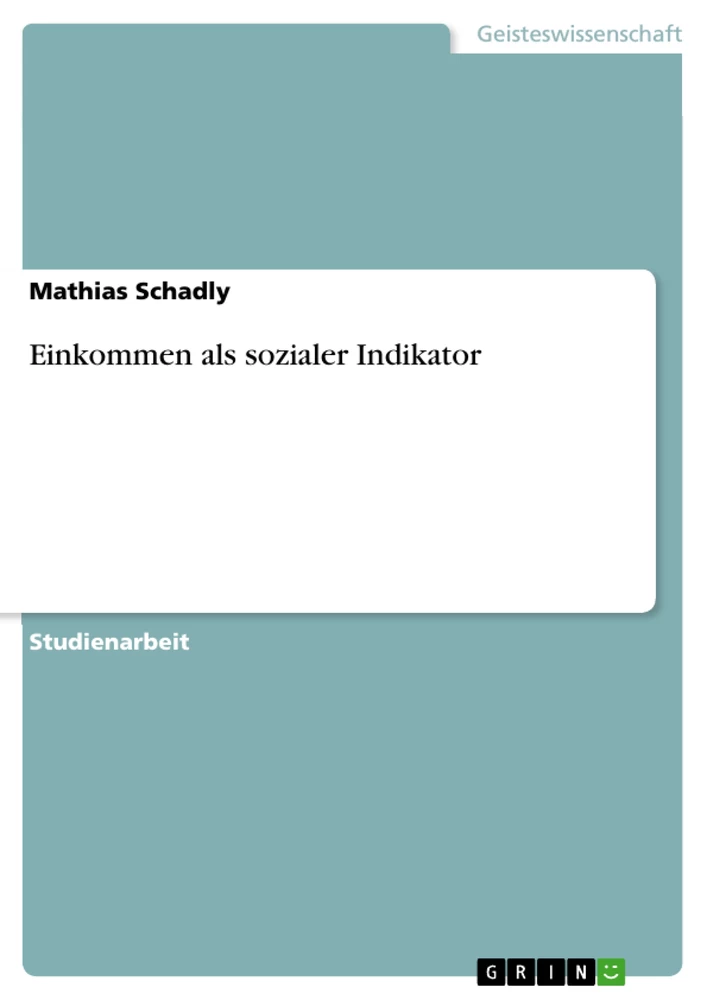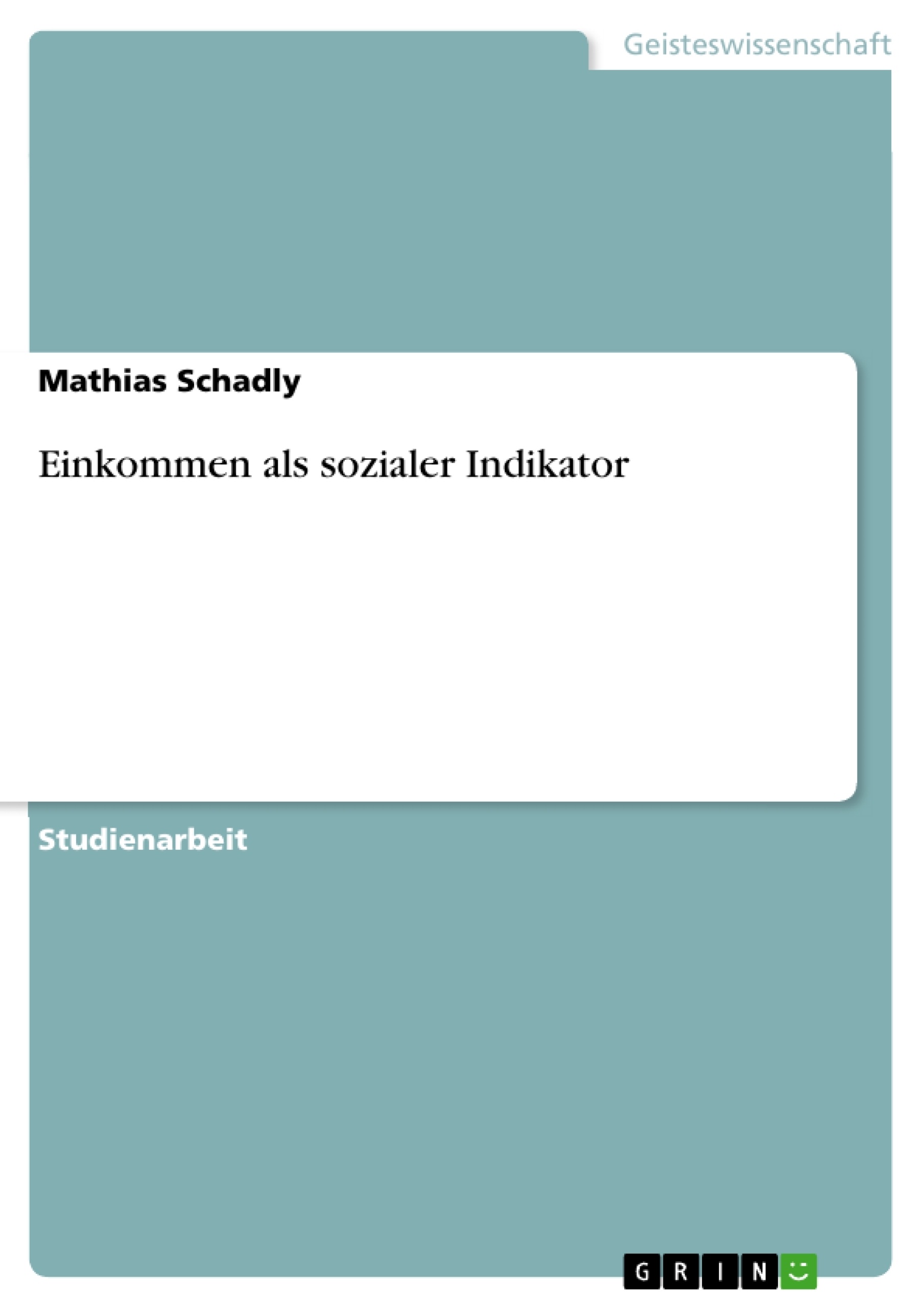Einkommen ist in Deutschland so wie in anderen Ländern Europas ungleich verteilt. Dabei stellt sich auch die Frage, ob und inwieweit mit der ungleichen Einkommensverteilung auch typischerweise weitere soziale Ungleichheiten einhergehen und ob diese dann auch gleichermaßen einheitlich bewertet werden. Den Fokus möchte ich bei dieser Arbeit dabei auf den Zusammenhang mit Sozialstaatlichkeit richten. Je nach konzeptionellem Verständnis variiert dabei die Zufriedenheit der jeweiligen Bevölkerung mit den sozialen Leistungen ihres Staates, der im Wesentlichen über die Mittel zum Ausgleich der Einkommensungleichheit verfügt. Dass dabei unweigerlich der Schwerpunkt bei den unteren Einkommensschichten liegt, ergibt sich aus der Sache . Aktuelle Diskussionen um Unterschicht und Präkariat zeigen auf, dass zu diesem Thema, je nach historischem oder politischem Standpunkt, verschiedene Bewertungen der Situation in der Bevölkerung bestehen.
Diese Arbeit soll daher klären, was Einkommen ausmacht, wie man die Einkommenshöhe ermitteln kann, welche Aussagen das Einkommen über die Gesellschaft ermöglicht und wie sich verschiedene politische Konzepte dazu verhalten.
Einen Schwerpunkt werde ich bei der Bundesrepublik setzen, diese aber immer im Bezug zum europäischen Ausland betrachten und internationale Forschungsergebnisse herunter brechen.
Das diese Darstellung nur ein abrissartiger Einstieg in die Thematik ist, ist mir durchaus bewusst. In der weiteren Darstellung soll Einkommen gleichgesetzt sein mit den Einkünften von privaten Haushalten. Dieses setzt sich aus dem Einkommen der Haushaltsmitglieder zusammen. Man unterscheidet verschiedene Einkommensarten, wie zum Beispiel Einkommen aus abhängiger Beschäftigung, selbständiger Tätigkeit oder vom Staat geleistete Transfereinkommen.
Für eine gesamtwirtschaftliche Untersuchung ist das Nettoeinkommen von großer Bedeutung, da dieses für potentiellen Konsum zur Verfügung steht und damit den Wirtschaftskreislauf in Gang hält.
In unserem Verständnis ist Einkommen eng mit dem Erwerbsstatus verbunden. Der Zugang auf den Arbeitsmarkt bestimmt in den westlichen Gesellschaften wesentlich die Einkommenshöhe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Einkommen
- 1.1 Begriff
- 1.2 Einflussfaktoren auf Einkommen
- 1.3 Einkommen gibt Aufschluss über:
- 2. Möglichkeiten der Einkommensmessung (Amtliche Statistik)
- 2.1 Das Sozio-Ökonomische Panel (SOEP)
- 2.2 Der Mikrozensus
- 2.3 Die Einkommens- und Verbrauchstichprobe (EVS)
- 2.4 Referenz Europa – Eurobarometer und EU-SILC
- 3. Verteilung auf Schichten
- 3.1 Modelle als abstrakte Darstellung der Gesellschaft
- 3.2 ausgewählte Konzepte
- 3.2.1 Marienthal
- 3.2.2 Haus-Modell
- 4. Einkommensmessung und Sozialstaat in Deutschland - Eine logische Konsequenz???
- 4.1 Wir kennen das statistische Armutsrisiko - Was tun?
- 4.2 Sozialstaatsmodelle und Implikationen
- 4.3 Stellgrößen des Sozialstaates zum Ausgleich der Einkommensungleichheit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einkommensverteilung in Deutschland und Europa, ihre Auswirkungen auf soziale Ungleichheit und den Zusammenhang mit dem Sozialstaat. Der Fokus liegt auf der Klärung der Bedeutung von Einkommen als sozialer Indikator, der Ermittlung von Einkommenshöhen und der Analyse verschiedener politischer Konzepte im Umgang mit Einkommensungleichheit.
- Einkommen als sozialer Indikator und seine Messung
- Einflussfaktoren auf die Einkommensverteilung
- Einkommensungleichheit und soziale Ungleichheit
- Der deutsche Sozialstaat und seine Rolle im Ausgleich von Einkommensungleichheit
- Internationaler Vergleich der Einkommensverteilung und Sozialstaatsmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der ungleichen Einkommensverteilung in Deutschland und Europa ein und benennt den Fokus der Arbeit auf den Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Sozialstaatlichkeit. Sie hebt die unterschiedlichen Bewertungen der Situation in der Bevölkerung hervor und skizziert die Ziele der Arbeit: Klärung der Bedeutung von Einkommen, Methoden zur Ermittlung der Einkommenshöhe, Aussagen über die Gesellschaft und die Haltung verschiedener politischer Konzepte.
1. Einkommen: Dieses Kapitel definiert den Begriff Einkommen im Kontext privater Haushalte und unterscheidet verschiedene Einkommensarten (Einkommen aus abhängiger und selbständiger Beschäftigung sowie Transfereinkommen). Es betont die Bedeutung des Nettoeinkommens für den Konsum und den Wirtschaftskreislauf und unterstreicht die enge Verbindung zwischen Einkommen und Erwerbsstatus in westlichen Gesellschaften.
2. Möglichkeiten der Einkommensmessung (Amtliche Statistik): Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Methoden zur Messung von Einkommen anhand amtlicher Statistiken wie dem Sozio-Ökonomischen Panel (SOEP), dem Mikrozensus, der Einkommens- und Verbrauchstichprobe (EVS) und europäischen Datenquellen wie Eurobarometer und EU-SILC. Es beleuchtet die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Methoden und ihre Eignung für die Untersuchung von Einkommensverteilungen.
3. Verteilung auf Schichten: Dieses Kapitel behandelt Modelle zur abstrakten Darstellung der Gesellschaft und ausgewählte Konzepte wie Marienthal und das Haus-Modell, die zur Analyse der Einkommensverteilung und ihrer sozialen Auswirkungen dienen. Es diskutiert die verschiedenen Ansätze und deren Bedeutung für das Verständnis sozialer Strukturen und Ungleichheiten.
4. Einkommensmessung und Sozialstaat in Deutschland - Eine logische Konsequenz???: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Einkommensmessung, Armutsrisiko und dem deutschen Sozialstaat. Es diskutiert verschiedene Sozialstaatsmodelle und ihre Auswirkungen auf die Einkommensungleichheit, sowie Instrumente des Sozialstaates zum Ausgleich dieser Ungleichheit.
Schlüsselwörter
Einkommen, Einkommensverteilung, soziale Ungleichheit, Sozialstaat, Einkommensmessung, Armut, Sozialstaatsmodelle, Deutschland, Europa, amtliche Statistik, SOEP, Mikrozensus, EVS, Eurobarometer, EU-SILC.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einkommensverteilung in Deutschland und Europa
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Einkommensverteilung in Deutschland und Europa, ihre Auswirkungen auf soziale Ungleichheit und den Zusammenhang mit dem Sozialstaat. Der Fokus liegt auf der Klärung der Bedeutung von Einkommen als sozialer Indikator, der Ermittlung von Einkommenshöhen und der Analyse verschiedener politischer Konzepte im Umgang mit Einkommensungleichheit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Einkommen als sozialer Indikator und seine Messung, Einflussfaktoren auf die Einkommensverteilung, Einkommensungleichheit und soziale Ungleichheit, der deutsche Sozialstaat und seine Rolle im Ausgleich von Einkommensungleichheit sowie ein internationaler Vergleich der Einkommensverteilung und Sozialstaatsmodelle.
Wie wird Einkommen definiert und gemessen?
Das Kapitel "Einkommen" definiert den Begriff Einkommen im Kontext privater Haushalte und unterscheidet verschiedene Einkommensarten. Das Kapitel "Möglichkeiten der Einkommensmessung (Amtliche Statistik)" beschreibt verschiedene Methoden zur Messung von Einkommen anhand amtlicher Statistiken wie dem SOEP, dem Mikrozensus, der EVS und europäischen Datenquellen wie Eurobarometer und EU-SILC. Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methoden werden beleuchtet.
Welche Modelle zur Darstellung der Einkommensverteilung werden verwendet?
Das Kapitel "Verteilung auf Schichten" behandelt Modelle zur abstrakten Darstellung der Gesellschaft und ausgewählte Konzepte wie Marienthal und das Haus-Modell, die zur Analyse der Einkommensverteilung und ihrer sozialen Auswirkungen dienen. Verschiedene Ansätze und deren Bedeutung für das Verständnis sozialer Strukturen und Ungleichheiten werden diskutiert.
Wie steht der Sozialstaat im Verhältnis zur Einkommensungleichheit?
Das Kapitel "Einkommensmessung und Sozialstaat in Deutschland - Eine logische Konsequenz???" untersucht den Zusammenhang zwischen Einkommensmessung, Armutsrisiko und dem deutschen Sozialstaat. Es diskutiert verschiedene Sozialstaatsmodelle und ihre Auswirkungen auf die Einkommensungleichheit sowie Instrumente des Sozialstaates zum Ausgleich dieser Ungleichheit.
Welche Datenquellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf amtliche Statistiken wie das Sozio-Ökonomische Panel (SOEP), den Mikrozensus, die Einkommens- und Verbrauchstichprobe (EVS), Eurobarometer und EU-SILC. Diese Quellen liefern Daten zur Einkommensmessung und -verteilung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Einkommen, Einkommensverteilung, soziale Ungleichheit, Sozialstaat, Einkommensmessung, Armut, Sozialstaatsmodelle, Deutschland, Europa, amtliche Statistik, SOEP, Mikrozensus, EVS, Eurobarometer, EU-SILC.
- Citation du texte
- Mathias Schadly (Auteur), 2007, Einkommen als sozialer Indikator, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113052