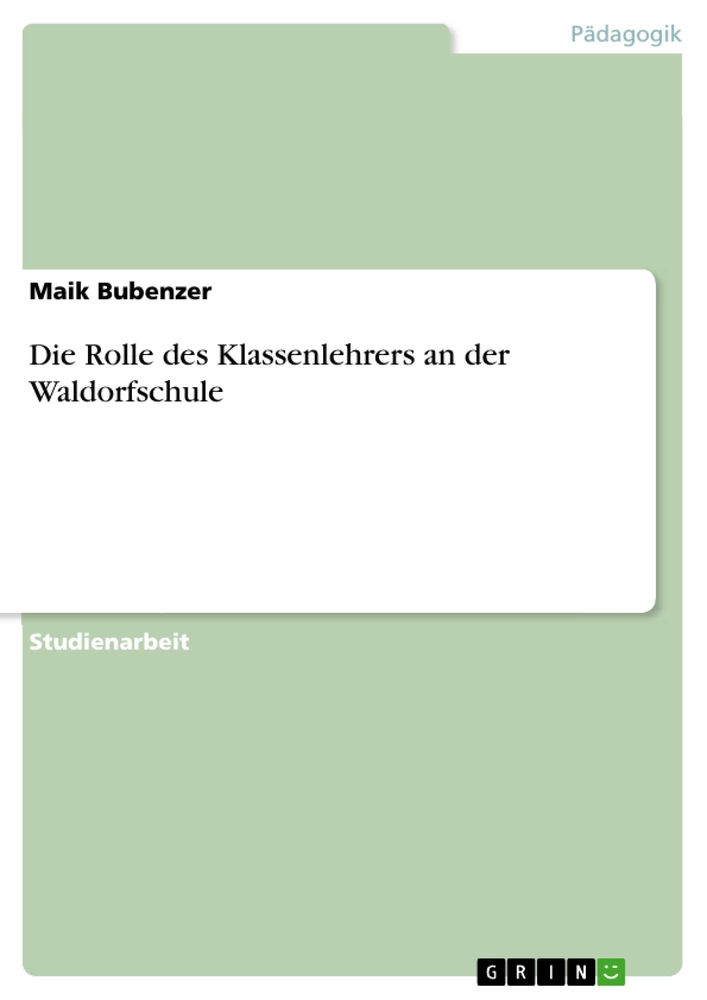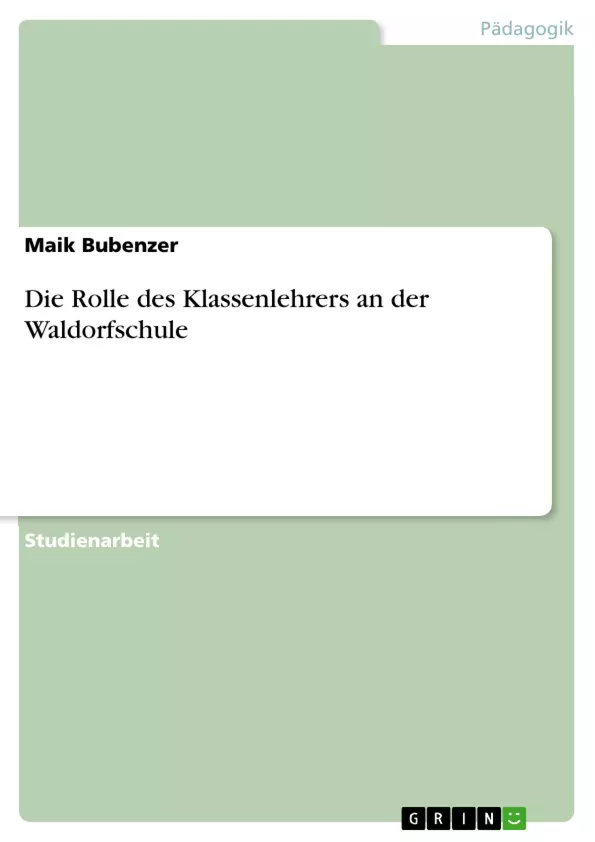In einer Zeit der hohen Arbeitslosigkeit in Deutschland wird die Frage nach Bildung und Schule immer lauter. „Bildung ist der Schlüssel zu Wohlstand und sozialer Anerkennung“, stellte kürzlich Bundespräsident Horst Köhler bei seiner Eröffnungsrede des Weltkongresses der Bildungsinternationalen in Berlin fest. Im Bericht „Bildung in Deutschland“ werden vier Parameter des Bildungsbegriffs genannt. Die „Leistungsfähigkeit, die individuelle Entfaltung, die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und der soziale Zusammenhang eines Landes“ sind die wesentlichen Ziele der Bildung. Wie soll eine Schule am Anfang des 21. Jahrhunderts aussehen? Ist das viergliedrige Schulsystem noch sinnvoll? Es gibt zahlreiche Reformansätze in verschiedenen Bundesländern.
Ein Entwurf der nordrhein-westfälischen SPD sieht folgendes u.a. vor: „Die Gemeinschaftsschule nimmt die Kinder nach der Grundschule auf und ist bis zur Klasse 10 für deren Bildungserfolg verantwortlich. […] In den Klassen 5 und 6 findet für alle Kinder ein gemeinsamer Unterricht statt. Ab Klasse 7 kann nach gemeinsamer Entscheidung der Schule, der Schulträger und der Eltern beispielsweise ein vollständig integrierter Unterricht angeboten werden oder eine Differenzierung in Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialklassen erfolgen.“
Demgegenüber steht z.B. die Schüler Union NRW, die unter dem Motto „Nicht jedem das Gleiche, sondern jedem das Seine!“ sich mit der Aktionsseite www.rettet-unsere-schulen.de für den Erhalt und die Festigung des mehrgliedrigen Schulsystems ausspricht. Die CDU NRW startete kürzlich ihre größte Kampagne seit der Bundestagswahl 2005 mit dem Titel „Die SPD-Einheitsschule führt ins Chaos – Keine Experimente mit unseren Kindern“. Privatschulen erfreuen sich hingegen immer größerer Beliebtheit. Seit 1992 hat sich die Zahl der Privatschulen verdoppelt. 873.000 Schüler werden dort unerrichtet, das entspricht 5,7 Prozent der Gesamtschülerzahl. Ein Reformmodell, welches seit fast 90 Jahren bestand hat, ist die Waldorfschule. Die erste Schule dieser Art wurde nach Vorträgen von Rudolf Steiner vor Arbeitern der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart im Jahre 1919 gegründet. Mit der Gründung einer Schule in Erfurt im Jahr 2006 wurde „die 200er-Grenze überschritten und auch im Jahr 2007 setzte sich der Trend mit der Gründung von fünf neuen Schulen fort“. In Deutschland wurden zu Beginn des letzten Schuljahres 2006/2007 „rund 808.700 Kinder eingeschult“, davon 0,8 Prozent in Freien Waldorfschulen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorbemerkungen
- 2. Struktur und Pädagogik der Waldorfschule
- 2.1. Das Beispiel der Freien Waldorfschule Oberberg
- 2.1.1. Organisation der Schule
- 2.1.2. Pädagogische Leitlinien
- 2.2. Was macht die Waldorfschule aus?
- 2.1. Das Beispiel der Freien Waldorfschule Oberberg
- 3. Die besondere Funktion des Klassenlehrers
- 3.1. Der Klassenlehrer an der Waldorfschule
- 3.2. Epochenunterricht
- 3.3. Zusammenarbeit im Kollegium und mit den Eltern
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Klassenlehrers an der Waldorfschule. Sie beleuchtet die Struktur und Pädagogik der Waldorfschule im Allgemeinen und am Beispiel der Freien Waldorfschule Oberberg im Besonderen. Ziel ist es, das ausgeprägte Klassenlehrerprinzip als einen zentralen Aspekt der waldorfpädagogischen Praxis zu verstehen.
- Struktur und Organisation der Waldorfschule
- Pädagogische Leitlinien der Waldorfschule
- Die Funktion des Klassenlehrers im Waldorfsystem
- Der Epochenunterricht und seine Bedeutung
- Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrern, Kollegium und Eltern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorbemerkungen: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und thematisiert die aktuelle Bildungsdiskussion in Deutschland, insbesondere die Debatte um das mehrgliedrige Schulsystem und den Aufstieg von Privatschulen. Sie führt die Waldorfschule als ein etabliertes Reformmodell ein und kündigt die Fokussierung auf das Klassenlehrerprinzip an. Die Einleitung verortet die Arbeit im aktuellen bildungspolitischen Diskurs, indem sie auf die Bedeutung von Bildung im Hinblick auf Wohlstand und soziale Anerkennung eingeht und verschiedene Reformansätze gegenüberstellt, darunter die Pläne der SPD NRW für eine Gemeinschaftsschule und den Widerstand der CDU NRW und der Schülerunion.
2. Struktur und Pädagogik der Waldorfschule: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur und die pädagogischen Prinzipien der Waldorfschule. Es verwendet die Freie Waldorfschule Oberberg als Fallbeispiel, um die Organisation der Schule (inkl. der Rollen von Förderverein und Trägerverein) und die zentralen pädagogischen Leitlinien nach Rudolf Steiner zu erläutern. Der Fokus liegt auf der Darstellung der grundlegenden Strukturen und der Darstellung der zentralen Prinzipien der Waldorfpädagogik, die für das Verständnis der Rolle des Klassenlehrers essentiell sind. Der Abschnitt beleuchtet die Organisationsstruktur der Schule anhand eines Organigramms und beschreibt die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Gremien.
3. Die besondere Funktion des Klassenlehrers: Dieses Kapitel analysiert die herausragende Rolle des Klassenlehrers an der Waldorfschule. Es untersucht die spezifischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Klassenlehrers, die sich aus dem waldorfpädagogischen Ansatz ergeben. Dabei werden der Epochenunterricht und die Zusammenarbeit im Kollegium sowie mit den Eltern als zentrale Aspekte der Arbeit des Klassenlehrers herausgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der umfassenden Betreuung der Schüler durch den Klassenlehrer über einen längeren Zeitraum und die damit verbundene intensive Beziehung.
Schlüsselwörter
Waldorfschule, Klassenlehrerprinzip, Reformpädagogik, Rudolf Steiner, Epochenunterricht, Pädagogik, Schulorganisation, Zusammenarbeit, Elternarbeit, Bildungsreform.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Rolle des Klassenlehrers an der Waldorfschule"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Klassenlehrers an der Waldorfschule. Sie beleuchtet die Struktur und Pädagogik der Waldorfschule im Allgemeinen und am Beispiel der Freien Waldorfschule Oberberg im Besonderen. Ziel ist es, das ausgeprägte Klassenlehrerprinzip als zentralen Aspekt der waldorfpädagogischen Praxis zu verstehen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Struktur und Organisation der Waldorfschule, pädagogische Leitlinien der Waldorfschule, die Funktion des Klassenlehrers im Waldorfsystem, den Epochenunterricht und seine Bedeutung, sowie die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrern, Kollegium und Eltern. Sie bezieht sich auf den aktuellen bildungspolitischen Diskurs in Deutschland, insbesondere die Debatte um das mehrgliedrige Schulsystem und den Aufstieg von Privatschulen.
Welche Schule dient als Fallbeispiel?
Die Freie Waldorfschule Oberberg dient als Fallbeispiel, um die Organisation der Schule und die zentralen pädagogischen Leitlinien nach Rudolf Steiner zu erläutern.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst Vorbemerkungen, ein Kapitel zur Struktur und Pädagogik der Waldorfschule (inkl. Organisation und pädagogischen Leitlinien der Freien Waldorfschule Oberberg), ein Kapitel zur besonderen Funktion des Klassenlehrers (inkl. Epochenunterricht und Zusammenarbeit), und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Was ist der Fokus des Kapitels "Struktur und Pädagogik der Waldorfschule"?
Dieses Kapitel beschreibt die Struktur und die pädagogischen Prinzipien der Waldorfschule. Es erläutert die Organisation der Schule (inkl. der Rollen von Förderverein und Trägerverein) und die zentralen pädagogischen Leitlinien nach Rudolf Steiner. Der Fokus liegt auf der Darstellung der grundlegenden Strukturen und der Darstellung der zentralen Prinzipien der Waldorfpädagogik, die für das Verständnis der Rolle des Klassenlehrers essentiell sind. Es beleuchtet die Organisationsstruktur anhand eines (implizit erwähnten) Organigramms und beschreibt die Verantwortlichkeiten der verschiedenen Gremien.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels "Die besondere Funktion des Klassenlehrers"?
Dieses Kapitel analysiert die herausragende Rolle des Klassenlehrers an der Waldorfschule. Es untersucht die spezifischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Klassenlehrers, die sich aus dem waldorfpädagogischen Ansatz ergeben. Der Epochenunterricht und die Zusammenarbeit im Kollegium sowie mit den Eltern werden als zentrale Aspekte der Arbeit des Klassenlehrers herausgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der umfassenden Betreuung der Schüler durch den Klassenlehrer über einen längeren Zeitraum und die damit verbundene intensive Beziehung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Waldorfschule, Klassenlehrerprinzip, Reformpädagogik, Rudolf Steiner, Epochenunterricht, Pädagogik, Schulorganisation, Zusammenarbeit, Elternarbeit, Bildungsreform.
Welche Bedeutung hat die Einleitung (Vorbemerkungen)?
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und thematisiert die aktuelle Bildungsdiskussion in Deutschland, insbesondere die Debatte um das mehrgliedrige Schulsystem und den Aufstieg von Privatschulen. Sie führt die Waldorfschule als ein etabliertes Reformmodell ein und kündigt die Fokussierung auf das Klassenlehrerprinzip an. Sie verortet die Arbeit im aktuellen bildungspolitischen Diskurs, indem sie auf die Bedeutung von Bildung im Hinblick auf Wohlstand und soziale Anerkennung eingeht und verschiedene Reformansätze gegenüberstellt (z.B. Pläne der SPD NRW für eine Gemeinschaftsschule und den Widerstand der CDU NRW und der Schülerunion).
- Quote paper
- Maik Bubenzer (Author), 2007, Die Rolle des Klassenlehrers an der Waldorfschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113188