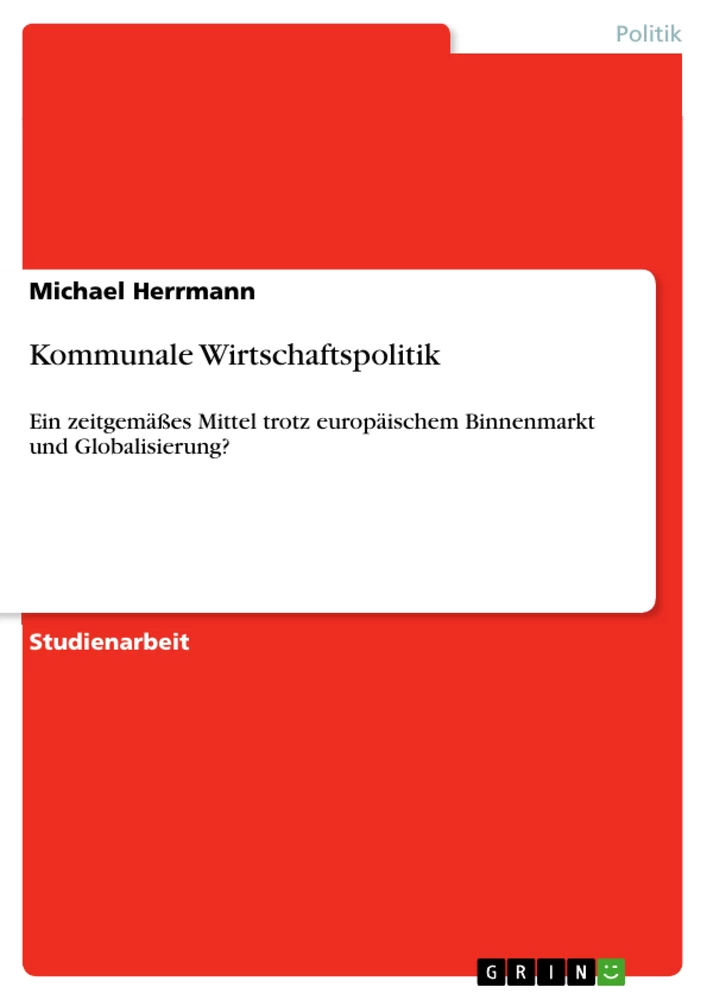Intention dieser Arbeit ist es, einen Überblick über die kommunale Wirtschaftspolitik zu verschaffen.
Hierzu werden zunächst deren Ziele betrachtet, um die Frage zu klären, wozu kommunale Wirtschaftspolitik überhaupt betrieben wird.
Da europäische Regelungen von immer größerer Bedeutung für die Kommunen sind, werden daraufhin die Rahmenbedingungen des neuen deutschen Regierungssystems erläutert, um zu klären, in welchem Umfeld sie heute überhaupt statt findet.
Anschließend wird die Frage des Wie geklärt. Hierzu werden die wichtigsten Mittel, die den Kommunen bei der Wirtschaftspolitik zur Verfügung stehen, analysiert. Klassische Instrumente sind dabei die Liegenschaftspolitik, Bauleitplanung, Steuer- und Tarifpolitik, Finanzhilfen sowie Informations- und Beratungsleistungen.
Neben den klassischen Instrumenten werden allerdings vor allem neue Ansätze erläutert und analysiert. Dies geschieht anhand von vier interessanten Beispielen (Stärkung endogener Potenziale, Technologie- und Gründerzentren, Interkommunale Kooperation, Wettbewerb als neues Steuerungsmodell). Vor allem die erhofften Vorteile und mögliche Probleme solcher Modelle stehen dabei im Vordergrund, um einen differenzierten Eindruck zu erlangen. Nachdem die Ziele, Rahmenbedingungen und möglichen Instrumente untersucht worden sind, soll noch eine weitere, nicht unbedeutende, Frage bezüglich der kommunalen Wirtschaftspolitik geklärt werden: Wie kann man deren Erfolge überhaupt messen? Hierbei wird auch die Frage beantwortet, ob erfolgreiche kommunale Wirtschaftspolitik überhaupt noch einen Einfluss auf die Entwicklung der Privatwirtschaft ausüben kann.
Abschließend soll versucht werden, ein Fazit über die aktuelle Situation der kommunalen Wirtschaftspolitik zu geben, indem Entwicklungen, Probleme und Herausforderungen noch einmal zusammengefasst werden, um die Frage zu klären, ob die kommunale Wirtschaftspolitik in der heutigen Zeit, also im Kontext
des europäischen Binnenmarkts und globalisierter Märkte noch ein zeitgemäßes Mittel ist?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziele der kommunalen Wirtschaftspolitik
- Kommunale Wirtschaftspolitik im Rahmen des ,,neuen deutschen Regierungssystems"
- „Klassische“ Instrumente der kommunalen Wirtschaftsförderung
- Immobilienpolitik
- Bauleitplanung
- Liegenschaftspolitik
- Steuer und Tarifpolitik
- Finanzhilfen
- Information, Beratung und Betreuung
- Immobilienpolitik
- „Neue Ansätze“ der kommunalen Wirtschaftspolitik
- Förderung des endogenen Potenzials
- Technologie- und Gründerzentren
- Interkommunale Kooperationen
- Wettbewerb als neues Steuerungsmodell
- Vorteile
- Nachteile
- Bewertungsproblematik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der kommunalen Wirtschaftspolitik und untersucht deren Ziele, Rahmenbedingungen und Instrumente im Kontext des europäischen Binnenmarkts und der Globalisierung. Ziel ist es, die Relevanz und Wirksamkeit der kommunalen Wirtschaftspolitik in der heutigen Zeit zu beleuchten.
- Ziele der kommunalen Wirtschaftspolitik
- Rahmenbedingungen der kommunalen Wirtschaftspolitik im neuen deutschen Regierungssystem
- Klassische und neue Instrumente der kommunalen Wirtschaftsförderung
- Bewertungsproblematik der kommunalen Wirtschaftspolitik
- Relevanz der kommunalen Wirtschaftspolitik im Kontext des europäischen Binnenmarkts und der Globalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Intention der Arbeit dar und gibt einen Überblick über die behandelten Themen. Im zweiten Kapitel werden die Ziele der kommunalen Wirtschaftspolitik beleuchtet, wobei die Verbesserung der lokalen Wirtschaftsstruktur, die Reduzierung der Arbeitslosigkeit und die Erhaltung bzw. Erhöhung der kommunalen Finanzkraft als zentrale Ziele herausgestellt werden. Kapitel 3 analysiert die Rahmenbedingungen der kommunalen Wirtschaftspolitik im Kontext des „neuen deutschen Regierungssystems“. Hierbei wird die Bedeutung europäischer Regelungen und die Auswirkungen der Globalisierung auf die kommunale Wirtschaftspolitik beleuchtet. Kapitel 4 befasst sich mit den klassischen Instrumenten der kommunalen Wirtschaftsförderung, wie Immobilienpolitik, Steuer- und Tarifpolitik, Finanzhilfen sowie Informations- und Beratungsleistungen. Kapitel 5 stellt neue Ansätze der kommunalen Wirtschaftspolitik vor, darunter die Förderung des endogenen Potenzials, Technologie- und Gründerzentren, interkommunale Kooperationen und Wettbewerb als neues Steuerungsmodell. Dabei werden die erhofften Vorteile und möglichen Probleme dieser Modelle analysiert. Kapitel 6 widmet sich der Bewertungsproblematik der kommunalen Wirtschaftspolitik und untersucht, wie deren Erfolge gemessen werden können. Abschließend soll im Fazit ein Überblick über die aktuelle Situation der kommunalen Wirtschaftspolitik gegeben werden, indem Entwicklungen, Probleme und Herausforderungen zusammengefasst werden, um die Frage zu klären, ob die kommunale Wirtschaftspolitik in der heutigen Zeit noch ein zeitgemäßes Mittel ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die kommunale Wirtschaftspolitik, die Ziele der kommunalen Wirtschaftspolitik, die Rahmenbedingungen der kommunalen Wirtschaftspolitik, die Instrumente der kommunalen Wirtschaftsförderung, die Bewertungsproblematik der kommunalen Wirtschaftspolitik, der europäische Binnenmarkt, die Globalisierung, die „de-minimis-Regel“, die Förderung des endogenen Potenzials, Technologie- und Gründerzentren, interkommunale Kooperationen, Wettbewerb als neues Steuerungsmodell, die Verbesserung der lokalen Wirtschaftsstruktur, die Reduzierung der Arbeitslosigkeit, die Erhaltung bzw. Erhöhung der kommunalen Finanzkraft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptziele der kommunalen Wirtschaftspolitik?
Zentrale Ziele sind die Verbesserung der lokalen Wirtschaftsstruktur, die Reduzierung der Arbeitslosigkeit und die Stärkung der kommunalen Finanzkraft.
Welche klassischen Instrumente nutzen Kommunen zur Wirtschaftsförderung?
Dazu gehören die Liegenschaftspolitik (Bereitstellung von Gewerbeflächen), Bauleitplanung, Steuer- und Tarifpolitik sowie Beratungsleistungen.
Was versteht man unter der Förderung "endogener Potenziale"?
Es geht darum, die bereits vor Ort vorhandenen Ressourcen, Talente und Unternehmen zu stärken, anstatt nur auf die Neuansiedlung externer Firmen zu setzen.
Welche Rolle spielt die EU für die kommunale Wirtschaftspolitik?
Europäische Regelungen, wie das Beihilferecht (z.B. De-minimis-Regel), setzen den Rahmen dafür, welche finanziellen Hilfen Kommunen an Unternehmen leisten dürfen.
Warum ist die Erfolgsmessung in der kommunalen Wirtschaftspolitik schwierig?
Es ist oft unklar, ob eine wirtschaftliche Entwicklung direkt auf kommunale Maßnahmen zurückzuführen ist oder durch globale Markttrends verursacht wurde.
- Quote paper
- Michael Herrmann (Author), 2008, Kommunale Wirtschaftspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113288