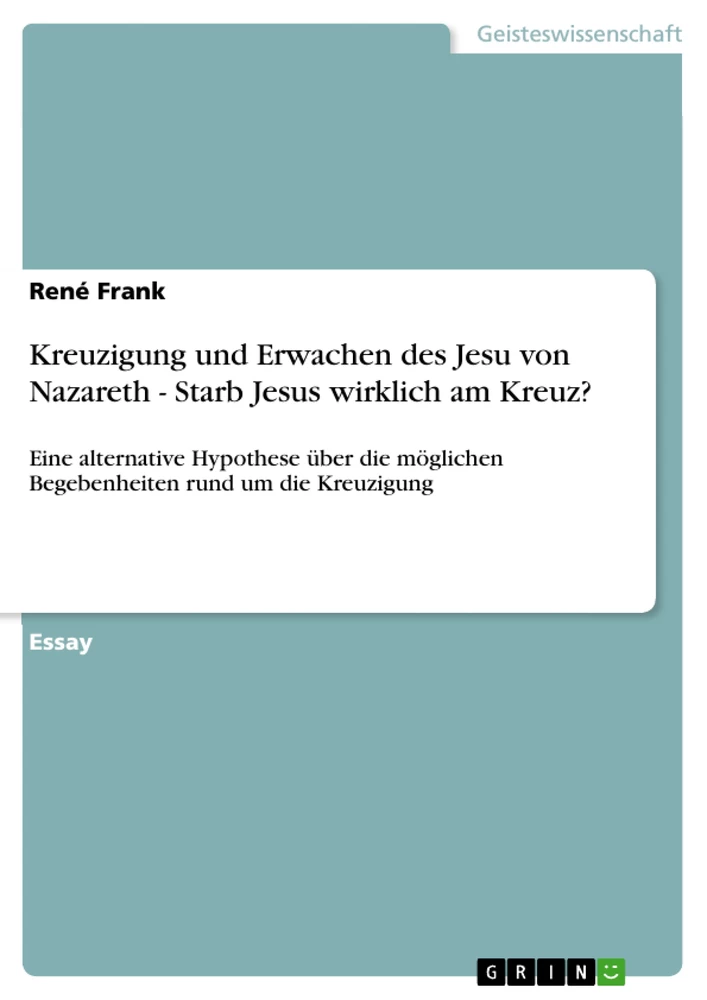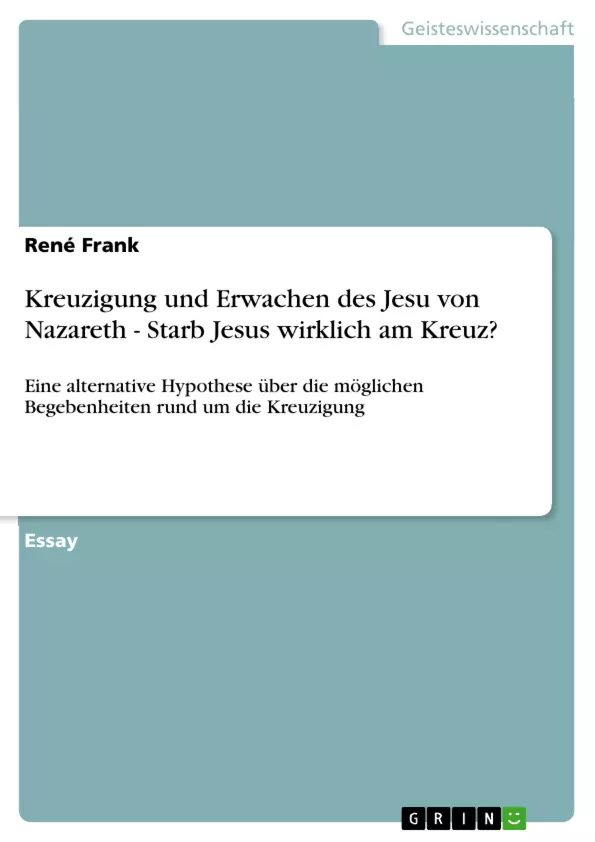„Kreuzigung und Erwachen des Jesu von Nazareth“? – Moment mal, da ist doch etwas falsch. Muss es nicht „Kreuzigung und Auferstehung des Jesu von Nazareth“ heißen?
Diese letztere Wortkombination sollte den meisten Lesern aus dem Religionsunterricht, der Konfirmandenstunde oder dem Kommunionunterricht vertraut sein. Auch rund um das jährliche Osterfest wird von „Kreuzigung und Auferstehung Jesu“ gesprochen.
Aber gerade diese „Auferstehung“ eines Menschen ist für uns heutzutage, in unserer von Wissenschaft und dem Hang zur logischen Erklärung geprägten Welt, ein seltsames Phänomen, das nicht in unser Weltbild zu passen scheint.
Gäbe es nicht eine rationale Erklärung für die Ereignisse rund um Tod und Auferstehung?
Welche Rolle spielen dabei die Untersuchungsergebnisse des Turiner Grabtuches?
Und was könnten die Evangelien uns noch erzählen, wenn man die Texte ohne theologische Färbung einfach sachlich liest?
Die Publikation "Kreuzigung und Erwachen des Jesu von Nazareth" soll diese Fragen einmal von einer ganz anderen - eher unchristlichen - Seite beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort zur Buchausgabe
- 1. Frage nach dem historischen Jesus
- 2. Fakten zur Kreuzigung nach den Evangelien und deren Erläuterung
- 3. Das Turiner Grabtuch
- 4. Vorgetäuschter Tod?
- 5. Die so genannte „Auferstehung“ Jesu
- 6. Erscheinungen nach dem Erwachen
- 7. Was bedeutet diese Erkenntnis der Ereignisse für uns heute?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch untersucht die Ereignisse rund um die Kreuzigung Jesu und bietet eine alternative Hypothese zur traditionellen Auffassung der Auferstehung. Es analysiert die historischen Quellen und stellt die Frage nach der Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte in Frage. Das Ziel ist es, eine differenzierte Perspektive auf die Ereignisse zu präsentieren und den Lesern eine eigene Beurteilung zu ermöglichen.
- Die historische Existenz Jesu und die spärlichen außerbiblischen Quellen.
- Die Darstellung der Kreuzigung in den Evangelien und deren Widersprüche.
- Die Analyse des Turiner Grabtuchs als mögliches Beweismittel.
- Die Hypothese eines vorgetäuschten Todes und die Interpretation der "Auferstehung".
- Die Bedeutung der Ereignisse für das heutige Verständnis des christlichen Glaubens.
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort zur Buchausgabe: Der Autor erläutert die kontroverse Natur seiner These über die Kreuzigung und Auferstehung Jesu und betont, dass er mit seiner Arbeit keinen Angriff auf den christlichen Glauben beabsichtigt, sondern eine alternative Interpretation der Ereignisse anbietet. Er erwähnt frühere negative Reaktionen auf seine These und die Motivation für die Veröffentlichung in Buchform. Der Fokus liegt auf dem Wunsch nach einer offenen Diskussion und der Ermöglichung einer unabhängigen Bewertung der präsentierten Argumente.
1. Frage nach dem historischen Jesus: Dieses Kapitel untersucht die historische Existenz Jesu anhand der vorhandenen Quellen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Quellenlage ausserhalb der frühchristlichen Zeugnisse sehr dürftig ist und dass bedeutende Persönlichkeiten der damaligen Zeit, wie Philo Judaeus, Jesus nicht erwähnen. Der Autor analysiert die wenigen Hinweise bei Sueton und Tacitus, betont aber deren zeitlichen Abstand zu den Ereignissen und die damit verbundene Unsicherheit. Schliesslich werden die Erwähnungen bei Flavius Josephus kritisch beleuchtet, mit der Einordnung des umstrittenen zweiten Textes. Das Kapitel schliesst mit einer Diskussion der apokryphen Evangelien und ihrer Bedeutung für das Verständnis der historischen Jesus-Figur. Der Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit der Quellenlage und der Frage nach der Zuverlässigkeit der Informationen.
Schlüsselwörter
Jesus von Nazareth, Kreuzigung, Auferstehung, historische Quellen, Evangelien, Turiner Grabtuch, alternative Hypothese, christlicher Glaube, historische Jesusforschung, Apokryphen.
Häufig gestellte Fragen zu: [Buchtitel fehlt im bereitgestellten Text]
Was ist der Gegenstand dieses Buches?
Das Buch untersucht die Ereignisse um die Kreuzigung Jesu und präsentiert eine alternative Hypothese zur traditionellen Auffassung der Auferstehung. Es analysiert historische Quellen und hinterfragt die Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte, um eine differenzierte Perspektive zu bieten und eine unabhängige Beurteilung beim Leser zu ermöglichen.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt die historische Existenz Jesu und die spärlichen außerbiblischen Quellen, die Darstellung der Kreuzigung in den Evangelien und deren Widersprüche, die Analyse des Turiner Grabtuchs, die Hypothese eines vorgetäuschten Todes und die Interpretation der "Auferstehung", sowie die Bedeutung der Ereignisse für das heutige Verständnis des christlichen Glaubens.
Welche Kapitel umfasst das Buch?
Das Buch beinhaltet ein Vorwort, ein Kapitel zur Frage nach dem historischen Jesus, ein Kapitel zu Fakten zur Kreuzigung nach den Evangelien und deren Erläuterung, ein Kapitel zum Turiner Grabtuch, ein Kapitel zur Hypothese eines vorgetäuschten Todes, ein Kapitel zur so genannten „Auferstehung“ Jesu, ein Kapitel zu Erscheinungen nach dem Erwachen und ein abschließendes Kapitel zur Bedeutung dieser Erkenntnisse für die Gegenwart.
Wie wird die historische Existenz Jesu im Buch behandelt?
Das Buch untersucht die historische Existenz Jesu anhand der vorhandenen Quellen, die außerhalb der frühchristlichen Zeugnisse als sehr dürftig beschrieben werden. Es analysiert kritisch die wenigen Hinweise bei Sueton und Tacitus, die Erwähnungen bei Flavius Josephus (inklusive des umstrittenen zweiten Textes) und die apokryphen Evangelien. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit der Quellenlage und der Zuverlässigkeit der Informationen.
Welche Rolle spielt das Turiner Grabtuch in der Argumentation?
Das Turiner Grabtuch wird als mögliches Beweismittel analysiert. Obwohl der Text keine Details zur Art der Analyse gibt, wird es als Teil der alternativen Hypothese zur Auferstehung thematisiert.
Welche Hypothese wird im Buch vertreten?
Das Buch vertritt die alternative Hypothese eines vorgetäuschten Todes Jesu, die als Erklärung für die Berichte über die „Auferstehung“ angeboten wird.
Wie positioniert sich der Autor zum christlichen Glauben?
Der Autor betont im Vorwort, dass seine Arbeit keinen Angriff auf den christlichen Glauben darstellt, sondern eine alternative Interpretation der Ereignisse anbietet und eine offene Diskussion anregt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter sind: Jesus von Nazareth, Kreuzigung, Auferstehung, historische Quellen, Evangelien, Turiner Grabtuch, alternative Hypothese, christlicher Glaube, historische Jesusforschung, Apokryphen.
- Quote paper
- René Frank (Author), 2003, Kreuzigung und Erwachen des Jesu von Nazareth - Starb Jesus wirklich am Kreuz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113508