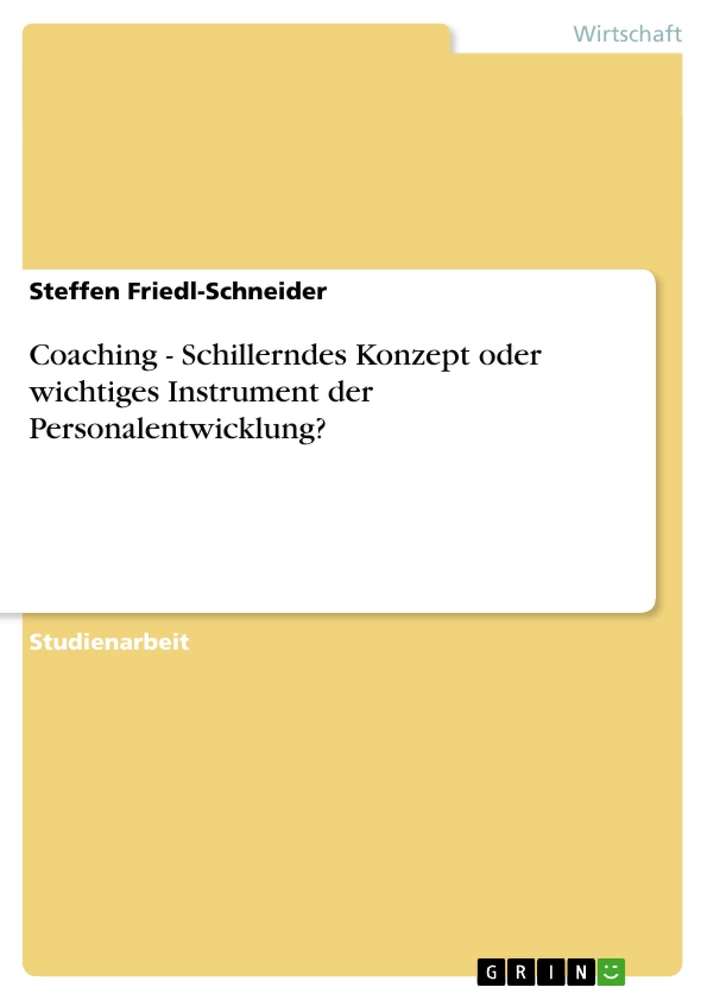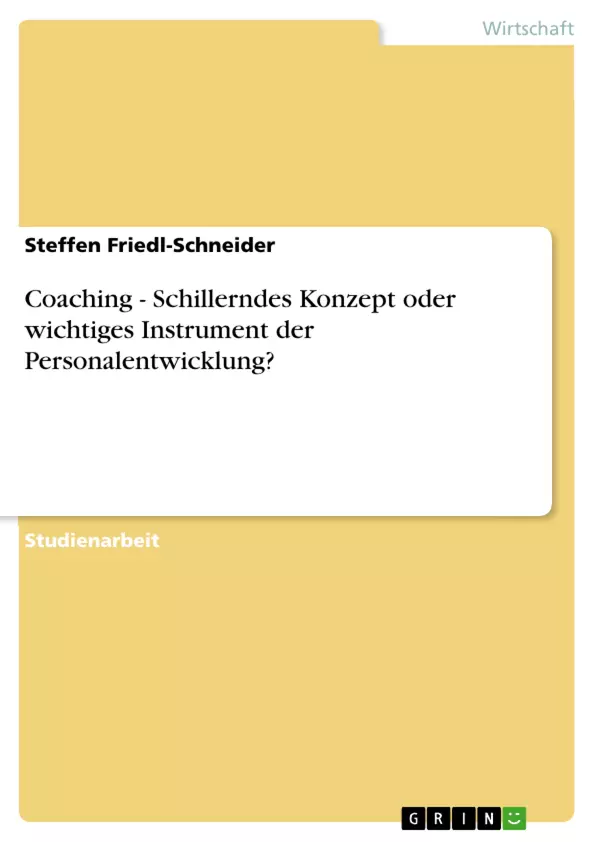Coaching ist eine Form der Beratung für Personen mit Managementaufgaben (Führungskräfte,
Freiberufler). Der Coach ist neutraler Feedbackgeber und hilft durch
eine Kombination aus individueller, unterstützender Problembewältigung und persönlicher
Beratung und Begleitung. Dabei nimmt der Coach nimmt dem Klienten
jedoch keine Arbeit ab, sondern berät ihn nur: Grundlage dafür ist eine freiwillig
gewünschte und tragfähige Beratungsbeziehung in deren Mittelpunkt die Klärung
und Bewältigung der Anforderungen an die Berufstätigkeit des Klienten stehen. Insofern
umfasst Coaching vorwiegend berufliche Sachverhalte, kann aber auch in private
Aspekte hineinreichen.
Coaching soll helfen, akut gewordene und zu werden drohende berufliche Probleme
zu lösen, die nicht oder nur schwer alleine gelöst werden können. Dabei ist der Coach
immer ein diskreter Berater und unterliegt keinen Interessen Dritter. Er arbeitet
nicht als Therapeut, sondern gibt lediglich effektives Feedback, welches von Kollegen,
Mitarbeitern oder Freunden kaum zu erwarten ist und von Vorgesetzten häufig
nicht geleistet werden kann. So lassen sich "Blinde Flecken" (z.B. im Umgang mit
Mitarbeitern), Führungsprobleme und Betriebsblindheit reduzieren.
Hauptziel des Coachings ist die Hilfe zur Selbsthilfe und die Förderung von Verantwortung,
Bewusstsein und Selbstreflexion. Der Coach hilft dabei, Möglichkeiten zu
eruieren und zu nutzen. Vorhandene Fähigkeiten und Kenntnisse des Klienten werden
aufgegriffen und weiter entwickelt. Somit geht es beim Coaching immer darum,
Wahrnehmung, Erleben und Verhalten des Gecoachten zu verbessern bzw. zu erweitern.
Im Endeffekt macht sich der Coach als Feedbackgeber damit überflüssig.
Vorliegendes Assignment soll zunächst allgemeine Aspekte und Definitionen des
Coaching beleuchten, um hier eine unmissverständliche theoretische Grundlage zu
schaffen. Auf deren Basis werden im weiteren Verlauf praktische Erfahrungen sowohl
seitens der Unternehmen als auch der Mitarbeiter in Coaching-Prozessen dargestellt.
Als Fazit geht es darum, qualitative Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches
Coaching zu benennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik und Ziel des Assignments
- Definition des Coaching-Begriffs
- Überblick über Hintergründe, Entwicklung, Verbreitung und Zielgruppen des Coaching
- Gründe und Anlässe für ein Coaching
- Unternehmerische Rahmenbedingungen für erfolgreiches Coaching
- Praktische Erfahrungen
- Praktische Erfahrungen aus Sicht des Unternehmens
- Praktische Erfahrungen aus Sicht der Mitarbeiter
- Fazit: Qualitätskriterien im Coaching
- Literaturverzeichnis und Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Assignment befasst sich mit dem Coaching als Instrument der Personalentwicklung. Es analysiert die Definition, Hintergründe, Entwicklung und Verbreitung des Coachings sowie die Gründe und Anlässe für dessen Einsatz. Darüber hinaus werden praktische Erfahrungen aus Sicht von Unternehmen und Mitarbeitern beleuchtet, um die Rahmenbedingungen für erfolgreiches Coaching zu erforschen. Das Assignment zielt darauf ab, die Bedeutung des Coachings als Instrument der Personalentwicklung zu verdeutlichen und Qualitätskriterien für ein erfolgreiches Coaching zu identifizieren.
- Definition und Abgrenzung des Coaching-Begriffs
- Entwicklung und Verbreitung des Coachings
- Gründe und Anlässe für ein Coaching
- Praktische Erfahrungen mit Coaching-Prozessen
- Qualitätskriterien für erfolgreiches Coaching
Zusammenfassung der Kapitel
Das Assignment beginnt mit einer Einführung in die Thematik und definiert den Coaching-Begriff. Es wird erläutert, dass Coaching eine Form der Beratung für Personen mit Managementaufgaben ist, die durch individuelle, unterstützende Problembewältigung und persönliche Beratung und Begleitung gekennzeichnet ist. Der Coach ist ein neutraler Feedbackgeber, der dem Klienten keine Arbeit abnimmt, sondern ihn bei der Klärung und Bewältigung beruflicher Anforderungen unterstützt.
Im Anschluss wird ein Überblick über die Hintergründe, Entwicklung, Verbreitung und Zielgruppen des Coachings gegeben. Es wird deutlich, dass Coaching als Modell für Betreuungs- und Beratungsprozesse nicht nur im Sport, sondern auch in anderen Bereichen wie der Wirtschaft und der Personalentwicklung Anwendung findet. Die Wurzeln des Coachings liegen in der Prozessberatung, der Supervision und der Psychotherapie.
Das Assignment beleuchtet auch die Gründe und Anlässe für ein Coaching. Es wird festgestellt, dass Coaching insbesondere bei der Lösung akuter und zu werden drohender beruflicher Probleme hilfreich ist, die nicht oder nur schwer alleine gelöst werden können. Der Coach unterstützt den Klienten bei der Entwicklung von Lösungsansätzen und fördert die Selbstreflexion und -wahrnehmung.
Im weiteren Verlauf des Assignments werden praktische Erfahrungen aus Sicht des Unternehmens und der Mitarbeiter in Coaching-Prozessen dargestellt. Es werden die Herausforderungen und Chancen des Coachings aus beiden Perspektiven beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Coaching, Personalentwicklung, Management, Beratung, Feedback, Selbstreflexion, Problembewältigung, Zielsetzung, Mitarbeiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Unternehmenserfolg, Qualitätskriterien, Praxisbeispiele.
Häufig gestellte Fragen
Was genau ist Coaching?
Coaching ist eine neutrale Beratung für Führungskräfte und Freiberufler, die Hilfe zur Selbsthilfe bietet und die Selbstreflexion sowie Verantwortung fördert.
Ist ein Coach ein Therapeut?
Nein, ein Coach arbeitet nicht als Therapeut. Er gibt effektives Feedback zu beruflichen Sachverhalten und hilft bei der Bewältigung von Führungsproblemen.
Was sind "Blinde Flecken" im Coaching?
Das sind Verhaltensweisen (z.B. im Umgang mit Mitarbeitern), die der Klient selbst nicht wahrnimmt, die aber durch neutrales Feedback des Coaches aufgedeckt werden können.
Welche Qualitätskriterien gibt es für erfolgreiches Coaching?
Dazu gehören Freiwilligkeit, Diskretion, eine tragfähige Beratungsbeziehung und die Neutralität des Coaches gegenüber Dritten.
Wann ist ein Coaching-Prozess beendet?
Idealerweise macht sich der Coach durch die Förderung der Selbsthilfekompetenz des Klienten am Ende selbst überflüssig.
- Quote paper
- Steffen Friedl-Schneider (Author), 2007, Coaching - Schillerndes Konzept oder wichtiges Instrument der Personalentwicklung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113653