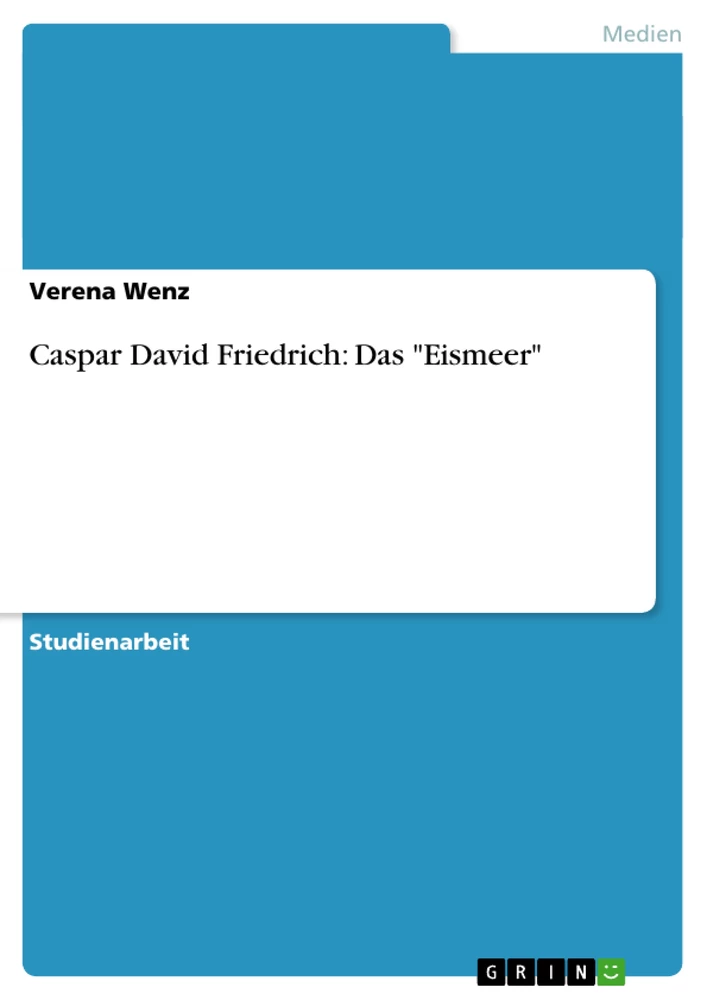"Aus der großen Zahl schöner Arbeiten, die bei ihm stehen, hat mir noch ein Nordmeerbild starken Eindruck gemacht, ein Eisberg hat da ein Schiff verschlungen, von dem nur mehr Reste zu sehen sind. Es ist eine große und schreckliche Tragödie, kein Mensch hat überlebt", schreibt der französische
Künstler David d'Angers 1834 nach einem Besuch im Atelier Caspar David Friedrichs in sein Tagebuch.
Dass der bedeutendste Vertreter der deutschen romantischen Landschaftsmalerei
ganz im Gegensatz zu vielen Künstlern seiner Zeit an der mediterranen Üppigkeit der Natur Italiens weniger Gefallen fand als an den rauen Landschaften seiner Heimat Norddeutschland, ist bekannt, doch scheint Caspar David Friedrich diese Vorliebe für nördliche Kälte und Schroffheit 1823/24 mit einem seiner Hauptwerke auf die Spitze getrieben zu haben: Das heute in der Hamburger
Kunsthalle hängende "Eismeer"2 (Abb. 1) ist eine Darstellung eines dramatischen Schiffbruchs inmitten einer kargen und unwirtlichen, von zersplitterten Eisschollen bestimmten Polarlandschaft – ein Werk, das schon allein auf Grund seines ungewöhnlichen Motivs eine Sonderstellung im Schaffen des Künstlers einnimmt. Wie ein Fremdkörper wirkt die bizarre Aufhäufung scharfkantiger
Eisschollen inmitten der meist stimmungsvollen, verträumten Landschaften Friedrichs, verströmt Kälte, zugleich ungeheure Dramatik.
Nicht nur zeitgenössische Betrachter wie David d'Angers fühlten sich von dem arktischen Katastrophenszenario zutiefst berührt, auch auf Kunsthistoriker hat das eigenwillige Bild seit jeher eine ganz besondere Faszination ausgeübt. Schon oft war das "Eismeer" Thema wissenschaftlicher Publikationen,
und besonders die Frage nach einer möglichen Intention des Werkes beschäftigt die Caspar David Friedrich-Forschung bis heute immer wieder aufs Neue. Sehr unterschiedliche Wege wurden von Kunsthistorikern bereits gewählt, um sich dem Bild zu nähern – sowohl politische, philosophische als auch religiöse Gesichtspunkte gaben den Ausschlag für zahlreiche, teilweise sogar widersprüchliche Deutungsansätze.
Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, das "Eismeer" mit der ihm eigenen Interpretationsproblematik vorzustellen, um schließlich drei grundverschiedene
Betrachtungsweisen einander gegenüberzustellen...
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- I. Bildbetrachtung
- II. Das Motiv: Anregungen zum Thema Arktis und Polarmeer.
- III. Die künstlerische Tradition: Das "Eismeer" im Vergleich zu früheren Polarbildern Friedrichs und anderer Künstler
- 1. Kräftemessen mit der Natur: Die englische und niederländische Marinemalerei ...
- 2. Natur wird bildbestimmend: Friedrichs verschollene "Gescheiterte Hoffnung" ...
- IV. Ansätze zur Interpretation
- 1. Das "Eismeer" als Sinnbild der politischen Verhältnisse in Deutschland
- 2. Das "Eismeer" und die Theorie des Erhabenen
- a.) Das Erhabene bei Kant und Schiller
- b.) Die Anwendung der Theorie des Erhabenen auf das "Eismeer".
- 3. Gott in der Natur - das "Eismeer" als "Erdlebenbild" und religiöses Gleichnis .....
- SCHLUSSBETRACHTUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Caspar David Friedrichs Gemälde "Eismeer" und analysiert dessen Bedeutung im Kontext der romantischen Landschaftsmalerei. Ziel ist es, verschiedene Interpretationen des Bildes vorzustellen und zu vergleichen, um ein tieferes Verständnis für die künstlerische Intention und die vielschichtigen Bedeutungsdimensionen des Werkes zu gewinnen.
- Die politische und gesellschaftliche Bedeutung des "Eismeers" im Kontext der deutschen Geschichte
- Die Anwendung der Theorie des Erhabenen auf das "Eismeer" und die Rolle der Natur in Friedrichs Kunst
- Die religiöse Dimension des Bildes und die Darstellung von Gott in der Natur
- Die künstlerische Tradition des "Eismeers" im Vergleich zu anderen Polarbildern
- Die Bedeutung des Motivs des Schiffbruchs in der romantischen Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt das "Eismeer" als ein Schlüsselwerk der deutschen Romantik vor. Die Bildbetrachtung analysiert die Komposition, die Farbgebung und die Symbolik des Gemäldes. Dabei wird die Darstellung der arktischen Landschaft, des Schiffswracks und der Eisschollen im Detail beleuchtet.
Das Kapitel "Das Motiv: Anregungen zum Thema Arktis und Polarmeer" untersucht die möglichen Quellen für Friedrichs Motivwahl. Es wird auf die Bedeutung der Polarforschung im 19. Jahrhundert eingegangen und die Expedition von William Edward Parry als möglicher Einflussfaktor für Friedrichs Werk diskutiert.
Das Kapitel "Die künstlerische Tradition: Das "Eismeer" im Vergleich zu früheren Polarbildern Friedrichs und anderer Künstler" setzt das "Eismeer" in den Kontext der künstlerischen Tradition der Landschaftsmalerei. Es werden Vergleiche mit anderen Polarbildern Friedrichs und mit Werken anderer Künstler gezogen, um die Besonderheiten des "Eismeers" hervorzuheben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Caspar David Friedrich, "Eismeer", Romantik, Landschaftsmalerei, Polarforschung, Schiffbruch, Erhabenes, Natur, Religion, Kunstgeschichte, Interpretation, Symbolismus, Bildanalyse.
- Quote paper
- Magistra Artium Verena Wenz (Author), 2002, Caspar David Friedrich: Das "Eismeer", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113799