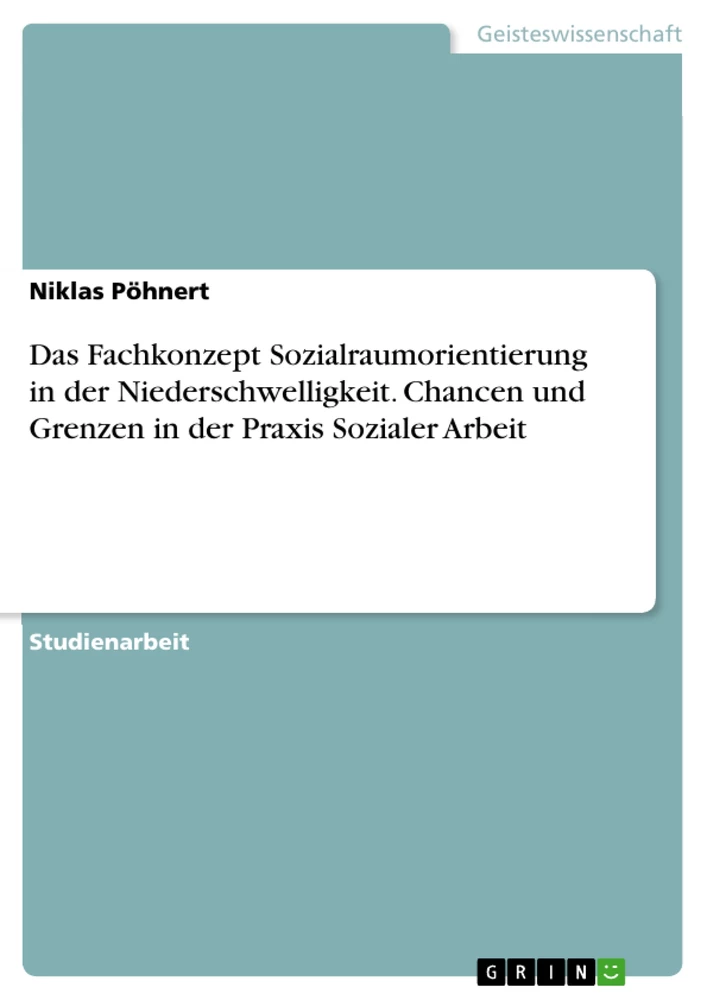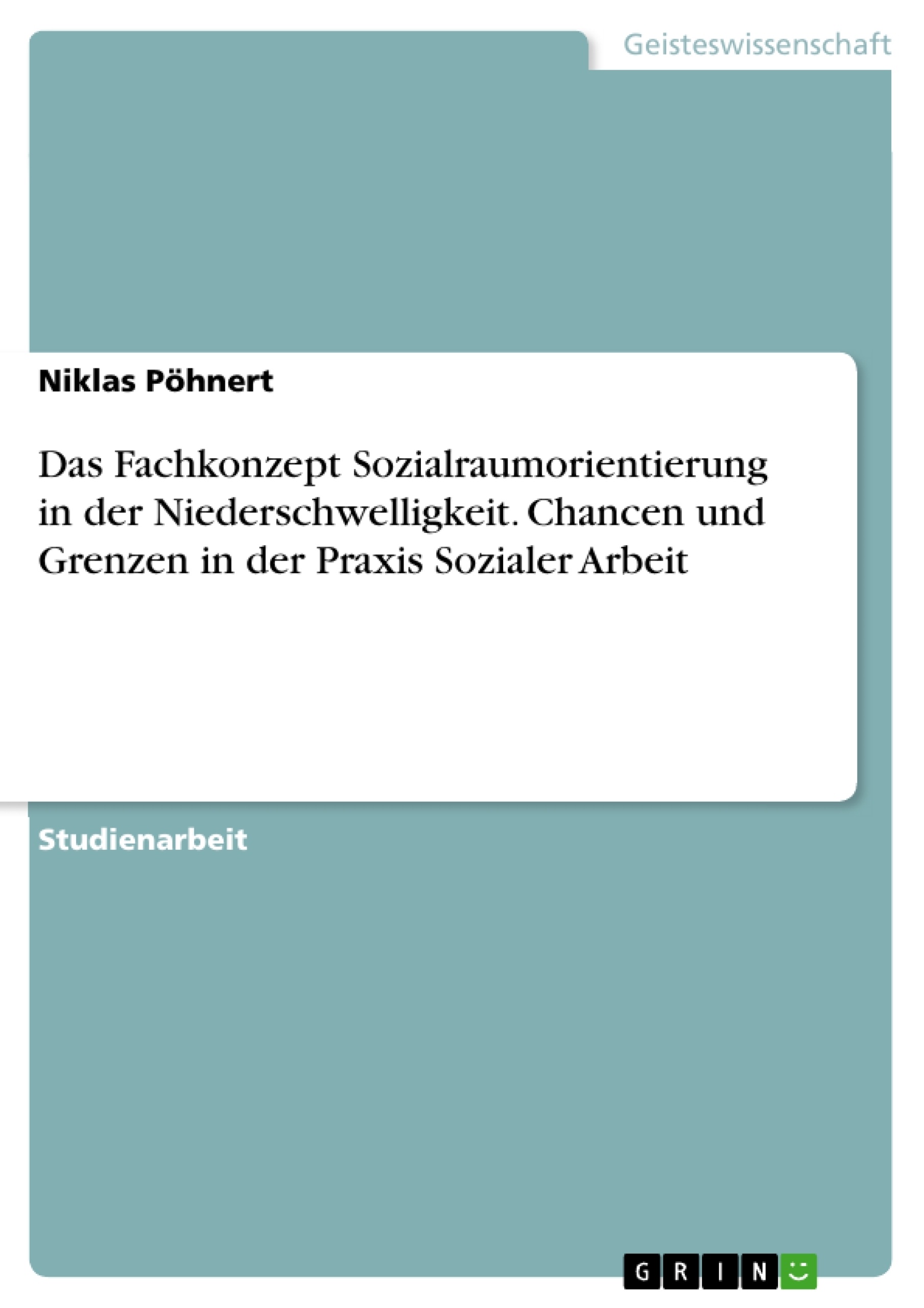Christian Reutlinger, Professor für Sozialraumforschung und Sozialraumarbeit an der Ostschweizer Fachhochschule, attestiert 2017 dem Sozialraum nicht niederschwellig zu sein. Dies klingt im ersten Moment paradox: Jeder Mensch erlebt und konstruiert durch seine Handlungen und Sinnzuschreibungen seinen eigenen, höchst individuellen Sozialraum, weshalb es ebenso viele Sozialräume wie Individuen gibt. Wie kann Sozialraum dann nicht niederschwellig sein?
Reutlinger führt weiter aus, dass durch Praktiken der sozialräumlichen Reproduktion Schwellen aufbauende beziehungsweise verstärkende Bedingungen sowie Macht-/Herrschaftsverhältnisse nachgebildet werden. Deswegen plädiert er für ein Niederschwelligkeitsverständnis als sozialräumlicher Prozess. Den Gedanken fortführend verlangt dieses angeführte Prozessverständnis nach andauernden Kontaktmöglichkeiten zu Fachkräften . Hie-raus resultiert das Thema dieser Arbeit: das Fachkonzept Sozialraumorientierung in der Praxis niederschwelliger Sozialer Arbeit, wobei sich der Fragestellung gewidmet wird, inwiefern sich das Fachkonzept Sozialraumorientierung in der Praxis niederschwelliger Sozialer Arbeit als umsetzbar erweist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stand der Forschung
- Das Fachkonzept Sozialraumorientierung
- Handlungsprinzipien des Fachkonzepts Sozialraumorientierung
- Ebenen des Fachkonzepts Sozialraumorientierung
- Niederschwellige Soziale Arbeit
- Das Fachkonzept Sozialraumorientierung in der niederschwelligen Sozialen Arbeit
- zeitliche Dimension
- räumliche Dimension
- inhaltliche Dimension
- soziale Dimension
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Umsetzbarkeit des Fachkonzepts Sozialraumorientierung (SRO) in der Praxis niederschwelliger Sozialer Arbeit. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen dieser Verbindung und analysiert, inwieweit die Prinzipien des SRO in einem niederschwelligen Kontext Anwendung finden können.
- Definition und Anwendung des Fachkonzepts Sozialraumorientierung
- Das Konzept der Niederschwelligkeit in der Sozialen Arbeit
- Die Verbindung von SRO und niederschwelliger Sozialer Arbeit: Herausforderungen und Chancen
- Analyse der räumlichen, zeitlichen, inhaltlichen und sozialen Dimensionen der Umsetzung
- Bewertung der praktischen Umsetzbarkeit des SRO in niederschwelligen Settings
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Umsetzbarkeit des Fachkonzepts Sozialraumorientierung in der niederschwelligen Sozialen Arbeit. Sie problematisiert den scheinbaren Widerspruch zwischen dem individuellen Sozialraumverständnis und der sozialräumlichen Reproduktion von Schwellen und Machtverhältnissen. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit andauernder Kontaktmöglichkeiten zu Fachkräften im Kontext eines prozessual verstandenen Niederschwelligkeitsverständnisses.
Stand der Forschung: Dieses Kapitel beleuchtet die bestehenden Unsicherheiten und Uneinigkeiten in der Definition von Sozialraumorientierung und Niederschwelligkeit in der Sozialen Arbeit. Es zeigt auf, dass der Begriff Sozialraum selbst heterogen interpretiert wird und der Diskurs um Sozialraumorientierung von kontroversen Debatten geprägt ist. Die fehlende einheitliche Definition erschwert die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit beiden Begriffen und deren Anwendung in der Praxis.
Das Fachkonzept Sozialraumorientierung: Dieses Kapitel erläutert das Fachkonzept Sozialraumorientierung (SRO) und beschreibt den Sozialraum anhand eines zweistufigen Raumverständnisses: dem politisch-administrativen und dem individuell-sinnzuschreibenden. Es werden die Wurzeln des SRO in der humanistischen Psychologie, der kritischen Erziehung und der Gemeinwesenarbeit aufgezeigt. Besonders hervorgehoben wird die Zielsetzung des SRO, Lebenswelten zu gestalten und Arrangements zu schaffen, die Menschen auch in prekären Situationen unterstützen, anstatt Menschen direkt verändern zu wollen.
Handlungsprinzipien des Fachkonzepts Sozialraumorientierung: Der Abschnitt beschreibt die fünf Kernprinzipien des SRO: die Berücksichtigung des Willens der Klientel, den Vorrang aktivierender vor betreuenden Tätigkeiten, den sozialräumlichen Blick auf Ressourcen, die zielgruppen- und bereichsübergreifende Gestaltung von Hilfen und die Vermeidung von Zielgruppenkategorien. Diese Prinzipien werden im Detail erläutert und ihre Bedeutung für die praktische Umsetzung des SRO hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Sozialraumorientierung, niederschwellige Soziale Arbeit, niedrigschwellige Soziale Arbeit, Handlungsprinzipien, Sozialraum, Ressourcenorientierung, Aktivierung, Selbsthilfe, Ressourcen, Partizipation, Praxis, Umsetzung, Herausforderungen, Chancen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Umsetzbarkeit des Fachkonzepts Sozialraumorientierung in der niederschwelligen Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Umsetzbarkeit des Fachkonzepts Sozialraumorientierung (SRO) in der Praxis niederschwelliger Sozialer Arbeit. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen dieser Verbindung und prüft, inwieweit die Prinzipien des SRO in einem niederschwelligen Kontext Anwendung finden können.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Anwendung des SRO, das Konzept der Niederschwelligkeit, die Verbindung von SRO und niederschwelliger Sozialer Arbeit (Herausforderungen und Chancen), die Analyse der räumlichen, zeitlichen, inhaltlichen und sozialen Dimensionen der Umsetzung sowie eine Bewertung der praktischen Umsetzbarkeit des SRO in niederschwelligen Settings.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist gegliedert in eine Einleitung, einen Überblick über den Stand der Forschung, eine Erläuterung des Fachkonzepts Sozialraumorientierung (inkl. Handlungsprinzipien und Ebenen), einen Abschnitt zur niederschwelligen Sozialen Arbeit, einen Abschnitt zur Verbindung von SRO und niederschwelliger Sozialer Arbeit (mit detaillierter Betrachtung der zeitlichen, räumlichen, inhaltlichen und sozialen Dimensionen) und ein Fazit.
Was versteht die Arbeit unter Sozialraumorientierung?
Die Arbeit beschreibt den Sozialraum anhand eines zweistufigen Raumverständnisses: politisch-administrativ und individuell-sinnzuschreibend. Sie zeigt die Wurzeln des SRO in der humanistischen Psychologie, der kritischen Erziehung und der Gemeinwesenarbeit auf. Besonders hervorgehoben wird die Zielsetzung des SRO, Lebenswelten zu gestalten und Arrangements zu schaffen, die Menschen auch in prekären Situationen unterstützen.
Welche Handlungsprinzipien des SRO werden genannt?
Die Arbeit nennt fünf Kernprinzipien des SRO: Berücksichtigung des Willens der Klientel, Vorrang aktivierender vor betreuenden Tätigkeiten, sozialräumlicher Blick auf Ressourcen, zielgruppen- und bereichsübergreifende Gestaltung von Hilfen und Vermeidung von Zielgruppenkategorien.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit der Umsetzung des SRO in niederschwelligen Settings diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet die bestehenden Unsicherheiten und Uneinigkeiten in der Definition von Sozialraumorientierung und Niederschwelligkeit. Der scheinbare Widerspruch zwischen dem individuellen Sozialraumverständnis und der sozialräumlichen Reproduktion von Schwellen und Machtverhältnissen wird problematisiert. Die fehlende einheitliche Definition erschwert die wissenschaftliche Auseinandersetzung und die praktische Anwendung.
Welche Chancen bietet die Verbindung von SRO und niederschwelliger Sozialer Arbeit?
Die Arbeit hebt die Chancen hervor, die sich durch die Verbindung von SRO und niederschwelliger Sozialer Arbeit ergeben, insbesondere die Möglichkeit, Menschen in prekären Situationen durch die Gestaltung von Lebenswelten und unterstützenden Arrangements zu helfen. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit andauernder Kontaktmöglichkeiten zu Fachkräften im Kontext eines prozessual verstandenen Niederschwelligkeitsverständnisses.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Sozialraumorientierung, niederschwellige Soziale Arbeit, niedrigschwellige Soziale Arbeit, Handlungsprinzipien, Sozialraum, Ressourcenorientierung, Aktivierung, Selbsthilfe, Ressourcen, Partizipation, Praxis, Umsetzung, Herausforderungen, Chancen.
- Citar trabajo
- Niklas Pöhnert (Autor), 2021, Das Fachkonzept Sozialraumorientierung in der Niederschwelligkeit. Chancen und Grenzen in der Praxis Sozialer Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1139174