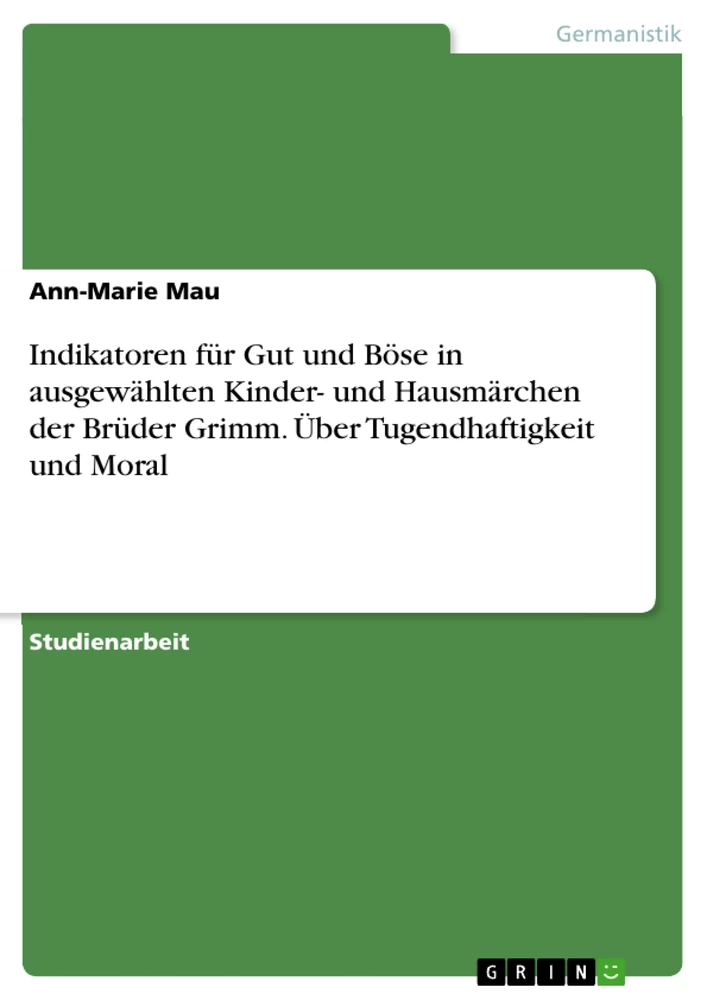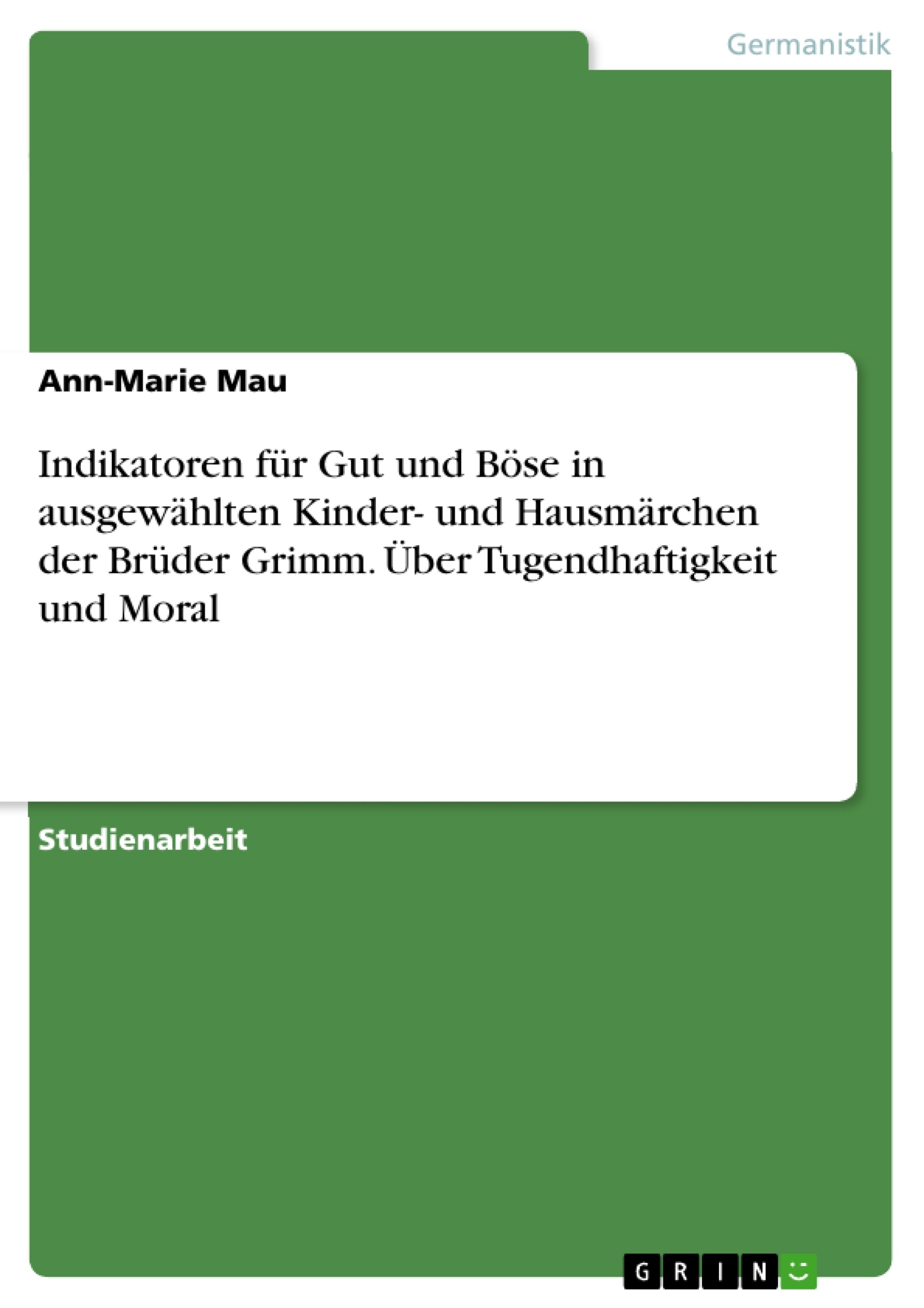In dieser Arbeit wird die Frage untersucht, welche Indikatoren dafür sorgen, dass ein Rezipient eine Märchenfigur mit dem Attribut gut oder böse belegen kann. Insbesondere soll hierbei beleuchtet werden, welche Rolle die Tugendhaftigkeit einer Figur dabei einnimmt und welche weiteren Motive eine solche Zuordnung begründen. Die essenzielle Frage ist, was sich durch die Schaffung dieser beiden Oppositionen und die Zuordnung zu diesen für die Moral des Märchens ergibt und weshalb damit in den meisten Fällen zwangsläufig das Gute über das Böse siegen muss.
Ob in Literatur, Film oder Fernsehen, kein anderes Thema ist derartig beliebt und häufig behandelt worden wie das Wechselspiel von Gut und Böse. Diese Faszination begründet sich nicht zuletzt aus den seit Jahrhunderten tradierten Sagen, Dichtungen und Volksmärchen. So verhält es sich auch bei den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Wenn im "Rotkäppchen" schlussendlich der böse Wolf stirbt, die Aschenputtel den Prinzen heiratet oder Hänsel und Gretel die Hexe verbrennen, steht fest, dass es sich um ein Märchen der Brüder Grimm handelt, in dem das Gute am Ende über das Böse die Oberhand gewinnt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Gut und Böse
- Tugenden und Laster
- Motive und Figuren
- Gegensätzliche Motive
- Die Rolle der Stiefmutter
- Gut und Böse auf Textebene
- Aschenputtel
- Frau Holle
- Schneewittchen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, wie in ausgewählten Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm die Figuren als „gut“ oder „böse“ charakterisiert werden. Dabei wird untersucht, welche Rolle die Tugendhaftigkeit einer Figur spielt und welche Motive für die Zuordnung zu „Gut“ oder „Böse“ verantwortlich sind. Die Analyse soll zeigen, welche ethische Botschaft durch die Opposition von Gut und Böse in den Märchen vermittelt wird und warum in den meisten Fällen das Gute über das Böse siegt.
- Definitionen von „Gut und Böse“ und „Tugenden und Laster“ im Kontext der Märchen
- Analyse typischer Motive wie Schönheit und Hässlichkeit, Neid, Faulheit und Fleiß
- Untersuchung der Sprache, Handlung, Charakteristik und Konstellation der Figuren in ausgewählten Märchen
- Abgeleitet aus den Definitionen und Motiven: Faktoren, die das Werteverständnis von Gut und Böse in Märchen beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Gut und Böse“ in Märchen ein und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Kapitel 2 widmet sich den Definitionen von „Gut und Böse“ und „Tugenden und Laster“, wobei der etymologische Ursprung und die Entwicklung dieser Begriffe beleuchtet werden. In Kapitel 3 werden typische Motive wie Schönheit und Hässlichkeit, Neid, Faulheit und Fleiß vorgestellt, die im späteren Verlauf der Analyse Anwendung finden. Kapitel 4 beinhaltet die Analyse von ausgewählten Märchen, in denen die Sprache, die Handlung, die Charakteristik und die Konstellation der Figuren untersucht werden, um die Indikatoren für Gut und Böse herauszuarbeiten.
Schlüsselwörter
Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Gut und Böse, Tugendhaftigkeit, Moral, Motive, Figuren, Sprachliche Analyse, Handlungsanalyse, Charakterisierung, Konstellation.
- Arbeit zitieren
- Ann-Marie Mau (Autor:in), 2018, Indikatoren für Gut und Böse in ausgewählten Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Über Tugendhaftigkeit und Moral, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1139380