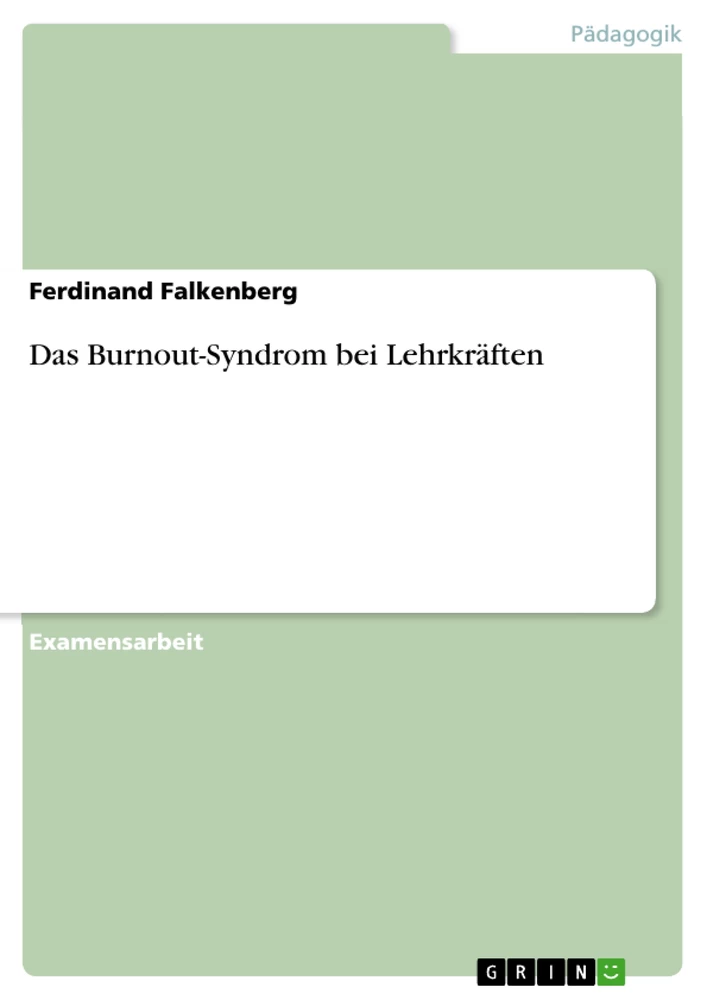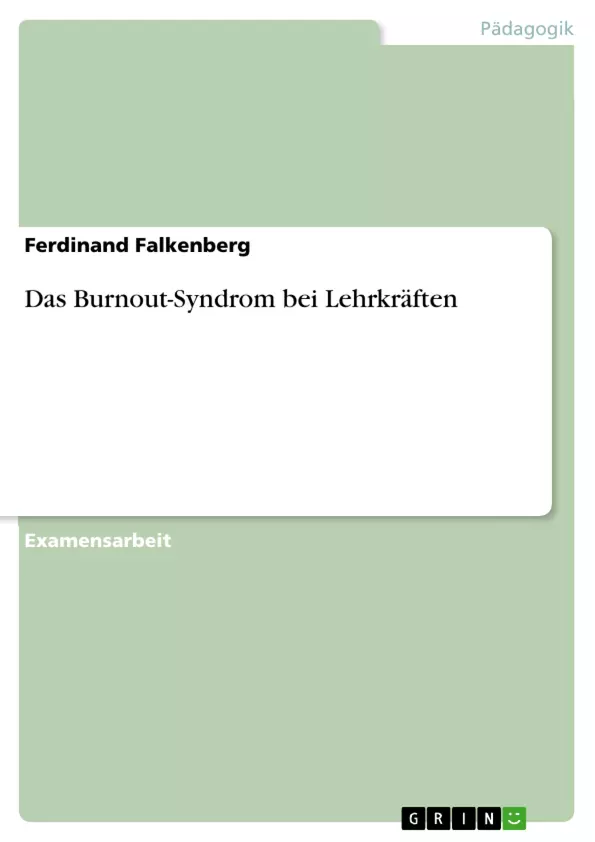Auch in seriösen Zeitungen sind immer häufiger Aufmacher wie „Lehrer als Risikogruppe“ oder „Die Ausgebrannten“ zu lesen. Diese Problematik ist höchst aktuell, wie zahlreiche wissenschaftliche, populär wissenschaftliche oder sonstigen Veröffentlichungen zeigen. Die teilweise plakativen Überschriften kommen nicht von ungefähr - Lehrkräfte sehen sich in ihrem Beruf immer größeren Belastungen ausgesetzt. Verschiedene Studien zeigen, dass der Lehrberuf wesentlich belastender ist als große Teile der durch Vorurteile über die „faulen Säcke“ (Altbundeskanzler G. Schröder) geprägten Öffentlichkeit erkennen wollen. Folge der Belastungen kann das Burnout-Syndrom sein.
Das Burnout-Syndrom kann durch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale hervorgerufen werden, daher wird in dieser Arbeit zuerst die Persönlichkeit der Lehrkräfte analysiert. Vor der genauen Betrachtung des Burnout-Syndroms werden die Belastungen des Lehrberufs, die ebenfalls Burnout-Syndrom auslösend sein können, dargestellt. Abschließend folgen eine Vorstellung von Entspannungsmöglichkeiten für die betroffenen bzw. gefährdeten Lehrkräfte, da es „schlicht an Erholungsmöglichkeiten“ für Lehrkräfte mangelt.
Die Ergebnisse dieser Arbeit sind:
(1) Trotz zahlreicher charakteristischer Persönlichkeitsmerkmale gibt es nicht die typische Lehrerpersönlichkeit.
(2) Im Lehrberuf treten zahlreiche den Lehrer belastende Situationen auf.
(3) Lehrkräfte können von dem Burnout-Syndrom betroffen sein, wenn bei ihnen eine Kombination aus speziellen Persönlichkeitsmerkmalen und bestimmten Berufsbedingungen auftritt.
(4) Entspannungsverfahren bieten sich als präventive und rehabilitative Maßnahme gegen das Burnout-Syndrom an.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Lehrerpersönlichkeit
- Grundtendenz Distanz
- Grundtendenz Nähe
- Grundtendenz System/Ordnung
- Grundtendenz Freiheit/Spontaneität
- Persönlichkeitsmerkmale von Lehrern
- Motive der Berufswahl
- Exkurs: Narzissmus bei Lehrern
- Zusammenfassung
- Belastungen des Lehrers
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Das Beanspruchungsmodell von Rudow
- Das AVEM von Schaarschmidt
- Die 11 Dimensionen und die Sekundärfaktoren
- Die verschiedenen Muster des AVEM
- Belastungsfaktoren: Übersicht
- Belastungsfaktor Arbeitsaufgaben und schulorganisatorische Bedingungen
- Arbeitsaufgaben
- Arbeitszeit
- Unterrichtsfach
- Klassengröße
- Klassenzusammensetzung
- Schulgröße
- Schultyp
- Ausbildung
- Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen
- Unterrichtspausen
- Belastungen durch verschiedene Teiltätigkeiten
- Lehrmittel
- Gesundheitliche Belastung der Lehrer
- Belastung durch Stehen
- Belastung durch Sitzen
- Klima
- Arbeitshygienische Bedingungen
- Stimmbelastung
- Soziale Arbeitsbedingungen
- Umgang mit den Schülern
- Belastung durch die Schüler
- Gewalt und Drogen in der Schule
- Umgang mit Kollegen, Schulleitern, Schulaufsicht und Verwaltung
- Umgang mit Kollegen
- Umgang mit der Schulleitung
- Umgang mit der Schulaufsicht
- Umgang mit der Schulverwaltung
- Umgang mit den Eltern
- Umgang mit den Schülern
- Gesellschaftlich-kulturelle Bedingungen
- Ideologische Normen
- Kulturelles Berufsbild und Berufsimage
- Berufsstatus
- Jugendkultur
- Exkurse
- Belastung und Alter
- Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Belastung
- Die Belastung der Sportlehrer
- Zusammenfassung
- Das Burnout-Syndrom
- Einleitung
- Geschichte des Burnout-Syndroms
- Burnout-Syndrom - Definitionen
- Abgrenzung zu verwandten Konstrukten
- Stress
- Depression
- Arbeitsunzufriedenheit
- Überdruss
- Angst
- Die Symptome des Burnout-Syndroms
- Erklärungsmodelle zum Burnout-Syndrom
- Übersicht
- Persönlichkeitszentrierte Ansätze
- Burnout-Modell nach Meier (1983)
- Modell nach Burisch (1994)
- Modell nach Freudenberger (1974)
- Modell von Edelwich und Brodsky (1984)
- Merkmale der Persönlichkeit, die das Ausbrennen fördern
- Zusammenfassung zu „Persönlichkeitszentrierte Erklärungsansätze“
- Sozial-, arbeits- und organisationspsychologische Ansätze
- Modell nach Maslach und Jackson (1984)
- Das „Soziale Kompetenz-Modell“ des Burnouts von Harrison (1983)
- Das „Stressmodell“ des Burnout von Eisenstat und Felner (1983)
- Phasenmodell des Burnouts nach Golembiewski und Munzenrieder (1981)
- Modell Pines, Aronson und Kafry (1980)
- Das „Kybernetische Modell“ des Burnout von Heifetz und Bersani (1983)
- Integratives Modell von Cherniss (1980)
- Situationale Bedingungen, die fördernd auf das Burnout-Syndrom wirken
- Zusammenfassung: Sozial-, arbeits- und organisationspsychologische Ansätze
- Der Verlauf des Burnout-Syndroms
- Zusammenfassung aller Erklärungsmodelle
- Messinstrumente des Burnout-Syndroms
- Das MBI (1981)
- Der Fragebogen nach Knauder (1996)
- Die SBS-HP (1981)
- Die Überdruss-Skala (1983)
- Mess-Instrument AVEM
- Entspannung als präventive und intervenierende Maßnahme gegen Burnout
- Einleitung
- Organisationsbezogene Hilfsmöglichkeiten
- Reduzierung der Arbeitsbelastung
- Gestaltung der Arbeitsumgebung
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Anregung
- Verbesserung des Lehrer-Images
- Individuelle Hilfsmöglichkeiten bei dem Burnout-Syndrom
- Enttabuisierung
- Identifizierung von Stressquellen
- Grenzen setzen
- Realistische Ziele
- Soziale Unterstützung
- Zeitmanagement
- Selbstakzeptierung
- Psychotherapie
- Entspannungsmöglichkeiten
- Entspannung als Maßnahme gegen das Burnout-Syndrom
- Einleitung
- Autogenes Training
- Entstehung
- Voraussetzungen
- Organisation
- Durchführung
- Wirkungen
- Progressive Muskelentspannung
- Entstehung
- Voraussetzungen
- Organisation
- Durchführung
- Wirkungen
- Hatha-Yoga
- Allgemein
- Organisation
- Vorrausetzungen für die Yoga-Übungen
- Durchführung
- Wirkung
- Zusammenfassung Entspannungsmethoden
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Burnout-Syndrom bei Lehrkräften. Ziel ist es, die Belastungsfaktoren, die zum Burnout führen können, zu identifizieren und präventive sowie intervenierende Maßnahmen aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Erklärungsmodelle für das Burnout-Syndrom und präsentiert verschiedene Entspannungstechniken als mögliche Gegenmaßnahmen.
- Belastungsfaktoren im Lehrerberuf
- Definition und Abgrenzung des Burnout-Syndroms
- Erklärungsmodelle für das Burnout-Syndrom
- Präventive Maßnahmen gegen Burnout
- Entspannungstechniken zur Burnout-Prävention und -Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
Lehrerpersönlichkeit: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Persönlichkeitsmerkmale von Lehrkräften und deren Einfluss auf den Beruf. Es werden Grundtendenzen wie Distanz, Nähe, System/Ordnung und Freiheit/Spontaneität untersucht, sowie Motive der Berufswahl und der Einfluss von Narzissmus beleuchtet. Die Zusammenfassung fasst die individuellen Persönlichkeitsfaktoren zusammen, die den Umgang mit beruflichen Herausforderungen beeinflussen können.
Belastungen des Lehrers: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der Belastungsfaktoren im Lehrerberuf. Es werden verschiedene Modelle der Beanspruchung vorgestellt (Rudow, AVEM), gefolgt von einer detaillierten Analyse von Belastungsfaktoren, die in verschiedene Kategorien eingeteilt sind: Arbeitsaufgaben, Arbeitszeit, soziale Bedingungen, und gesellschaftlich-kulturelle Faktoren. Die Kapitelteile zu den einzelnen Belastungsfaktoren geben einen detaillierten Einblick in deren Ausprägung und Wirkung. Der Fokus liegt dabei auf der Synthese dieser Faktoren und deren Interaktion im Kontext des Lehrerberufs.
Das Burnout-Syndrom: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Burnout-Syndrom. Es beginnt mit einer geschichtlichen Einordnung, Definitionen und einer Abgrenzung zu ähnlichen Konstrukten wie Stress, Depression und Arbeitsunzufriedenheit. Anschließend werden die Symptome des Syndroms beschrieben und verschiedene Erklärungsmodelle, sowohl persönlichkeitszentrierte als auch sozial-, arbeits- und organisationspsychologische Ansätze, umfassend dargestellt und miteinander verglichen. Der Abschnitt zu den Messinstrumenten des Burnout-Syndroms rundet das Kapitel ab. Die Bedeutung der verschiedenen Perspektiven und Modelle auf das Verständnis von Burnout wird ausführlich erläutert.
Entspannung als präventive und intervenierende Maßnahme gegen Burnout: Dieses Kapitel widmet sich präventiven und intervenierenden Maßnahmen gegen Burnout. Es beschreibt sowohl organisationsbezogene Hilfsmöglichkeiten (Reduzierung der Arbeitsbelastung, Gestaltung der Arbeitsumgebung etc.) als auch individuelle Strategien (Grenzen setzen, soziale Unterstützung, Zeitmanagement etc.). Der Schwerpunkt liegt auf verschiedenen Entspannungstechniken wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung und Hatha-Yoga, wobei Entstehung, Voraussetzungen, Durchführung und Wirkung jeder Methode detailliert dargestellt werden. Das Kapitel betont die Bedeutung von ganzheitlichen Ansätzen zur Burnout-Prävention.
Schlüsselwörter
Burnout-Syndrom, Lehrkräfte, Belastungsfaktoren, Arbeitsbedingungen, Stress, Prävention, Intervention, Entspannungstechniken, Persönlichkeitsmerkmale, Erklärungsmodelle, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Hatha-Yoga.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Burnout-Syndrom bei Lehrkräften"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Analyse des Burnout-Syndroms bei Lehrkräften. Es untersucht die Belastungsfaktoren im Lehrerberuf, verschiedene Erklärungsmodelle für Burnout und präsentiert präventive sowie intervenierende Maßnahmen, insbesondere Entspannungstechniken.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themenschwerpunkte: Lehrerpersönlichkeit und deren Einfluss auf den Beruf, Belastungsfaktoren im Lehrerberuf (Arbeitsaufgaben, soziale Bedingungen, gesellschaftlich-kulturelle Faktoren), Definition und Abgrenzung des Burnout-Syndroms, verschiedene Erklärungsmodelle für Burnout (persönlichkeitszentrierte und sozial-arbeits- und organisationspsychologische Ansätze), Messinstrumente für Burnout, und präventive sowie intervenierende Maßnahmen, insbesondere Entspannungstechniken wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung und Hatha-Yoga.
Welche Belastungsfaktoren im Lehrerberuf werden untersucht?
Das Dokument analysiert eine breite Palette von Belastungsfaktoren, darunter Arbeitsaufgaben (z.B. Arbeitsmenge, Unterrichtsvorbereitung), Arbeitszeit, Klassengröße und -zusammensetzung, Schulgröße und -typ, soziale Bedingungen (Umgang mit Schülern, Kollegen, Eltern, Schulleitung), und gesellschaftlich-kulturelle Faktoren (z.B. Berufsimage, Jugendkultur).
Welche Erklärungsmodelle für das Burnout-Syndrom werden vorgestellt?
Das Dokument stellt verschiedene Erklärungsmodelle vor, darunter persönlichkeitszentrierte Ansätze (z.B. Modelle von Meier, Burisch, Freudenberger, Edelwich und Brodsky) und sozial-, arbeits- und organisationspsychologische Ansätze (z.B. Modelle von Maslach und Jackson, Harrison, Eisenstat und Felner, Golembiewski und Munzenrieder, Pines, Aronson und Kafry, Heifetz und Bersani, Cherniss). Die Modelle werden verglichen und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen diskutiert.
Welche Entspannungstechniken werden als präventive und intervenierende Maßnahmen empfohlen?
Das Dokument empfiehlt verschiedene Entspannungstechniken, darunter autogenes Training, progressive Muskelentspannung und Hatha-Yoga. Für jede Technik werden Entstehung, Voraussetzungen, Durchführung und Wirkung detailliert beschrieben.
Welche Messinstrumente für Burnout werden erwähnt?
Das Dokument erwähnt verschiedene Messinstrumente für Burnout, darunter das MBI (Maslach Burnout Inventory), den Fragebogen nach Knauder, die SBS-HP, die Überdruss-Skala und das AVEM (Arbeitsbezogenes Erlebens- und Verhaltensmuster).
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, das Dokument enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte jedes Kapitels: Lehrerpersönlichkeit, Belastungen des Lehrers, das Burnout-Syndrom und Entspannung als präventive und intervenierende Maßnahme gegen Burnout. Diese Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über die Kernaussagen jedes Kapitels.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Die Zielsetzung des Dokuments ist die Untersuchung des Burnout-Syndroms bei Lehrkräften, die Identifizierung der Belastungsfaktoren, die zum Burnout führen können, und die Aufzeigen präventiver und intervenierender Maßnahmen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Präsentation verschiedener Entspannungstechniken als mögliche Gegenmaßnahmen.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Burnout bei Lehrkräften auseinandersetzen, darunter Lehrer, Schulpsychologen, Pädagogen, und Wissenschaftler im Bereich der Bildungspsychologie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Burnout-Syndrom, Lehrkräfte, Belastungsfaktoren, Arbeitsbedingungen, Stress, Prävention, Intervention, Entspannungstechniken, Persönlichkeitsmerkmale, Erklärungsmodelle, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Hatha-Yoga.
- Quote paper
- Ferdinand Falkenberg (Author), 2007, Das Burnout-Syndrom bei Lehrkräften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114042