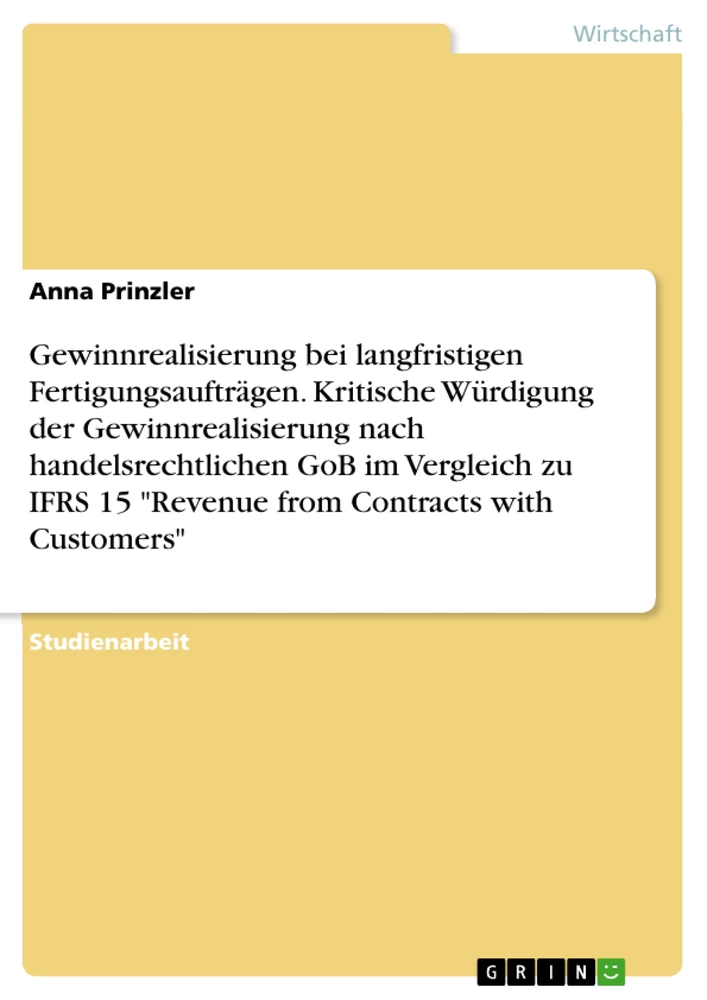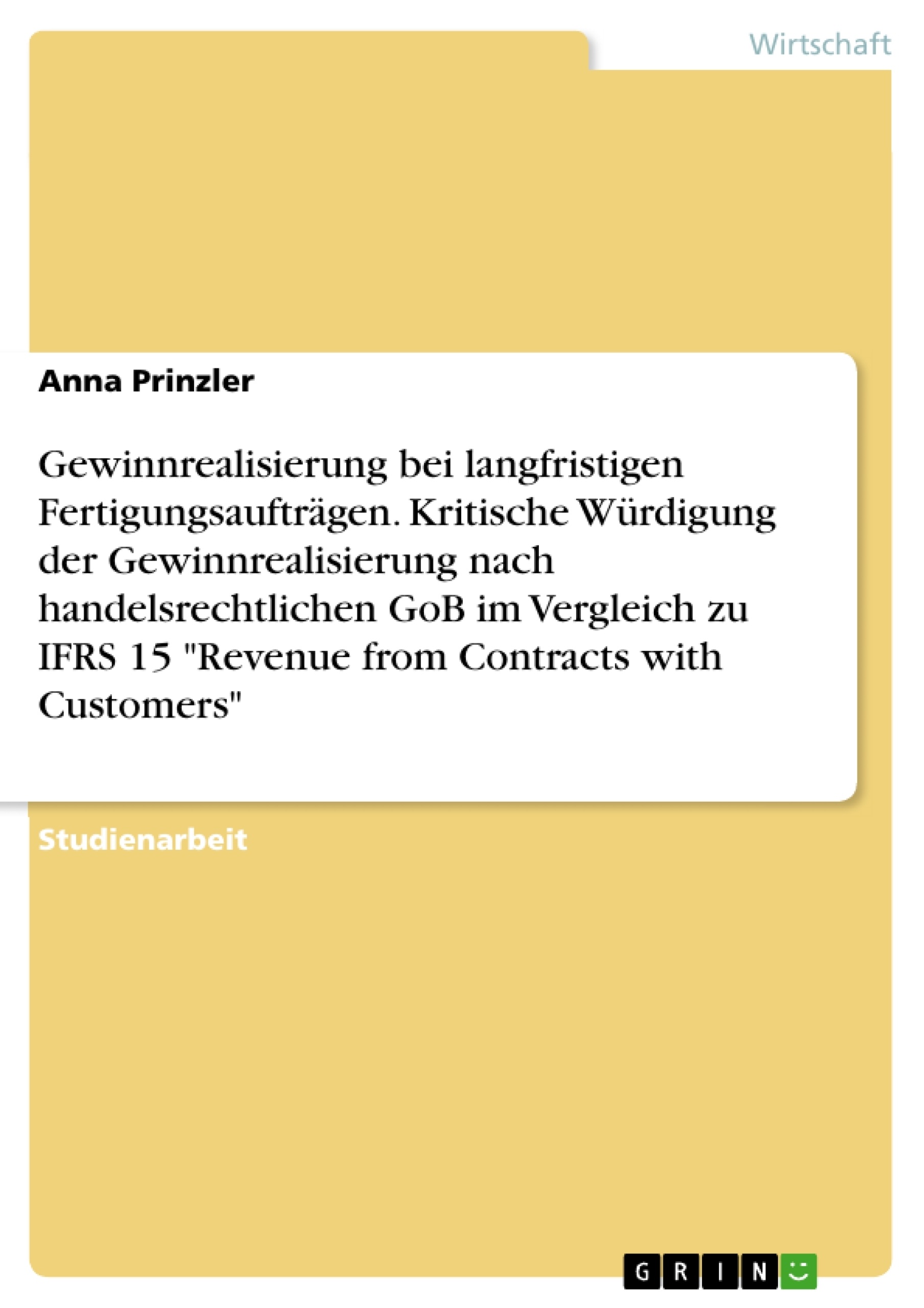Die Arbeit konzentriert sich auf eine kritische Würdigung der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen, insbesondere auf die Methoden der Gewinnrealisierung. Ziel dieser Arbeit ist, einen kritischen Literaturvergleich zwischen der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen nach handelsrechtlichen GoB und der Gewinnrealisierung nach IFRS 15 zu erarbeiten. Dabei wird vor allem auf den IFRS 15 eingegangen.
Um einen Vergleich zwischen Handelsrecht und IFRS erarbeiten zu können, ist es zunächst wichtig, den Begriff eines langfristigen Fertigungsauftrages zu erläutern. Im darauf folgenden Gliederungspunkt 3 wird die Gewinnrealisierung nach handelsrechtlichen GoB untersucht. In diesem Rahmen werden die Gewinnrealisierungskriterien nach der Rechtsprechung und die unterschiedlichen Bewertungsmethoden auf Zulässigkeit untersucht. Im Gliederungspunkt 4 wird die Gewinnrealisierung nach IFRS 15 dargestellt. Dazu wird erst die Entstehungsgeschichte des IFRS 15 erläutert, dann das neue Modell zur Erlöserfassung und anschließend die Percentage-of-Completion- Methode erarbeitet. Die Arbeit schließt mit einer thesenförmigen Zusammenfassung der Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung
- 2 Definition langfristige Fertigungsaufträge
- 3 Gewinnrealisierung nach handelsrechtlichen GoB
- 3.1 Gewinnrealisierungskriterien nach der Rechtsprechung
- 3.1.1 Prinzip des quasisicheren Anspruchs
- 3.1.2 Gewinnrealisierung der zugrundeliegenden Zivilrechtsstruktur
- 3.2 Methoden zur Realisierung von langfristigen Fertigungsaufträgen
- 3.2.1 Completed-Contract-Methode
- 3.2.3 Percentage-of-Completion-Methode
- 3.2.4 Möglichkeiten der echten Teilgewinnrealisierung
- 3.1 Gewinnrealisierungskriterien nach der Rechtsprechung
- 4 Gewinnrealisierung nach IFRS 15
- 4.1 Entstehungsgeschichte IFRS 15 und Umstellung
- 4.2 Das fünfstufige Modell der Erlöserfassung nach IFRS 15
- 4.3 Herausforderungen bei der Langfristfertigung nach der Percentage-of-Completion Methode
- 4.4 Aktivierung von Vertragskosten nach IFRS 15
- 5 Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen. Ziel ist ein kritischer Vergleich der handelsrechtlichen GoB mit IFRS 15. Die Arbeit untersucht die Unterschiede in den Methoden und Kriterien der Gewinnrealisierung unter beiden Regelwerken.
- Gewinnrealisierungskriterien nach handelsrechtlichen GoB
- Vergleichende Analyse der Methoden (Completed-Contract, Percentage-of-Completion)
- Das fünfstufige Modell der Erlöserfassung nach IFRS 15
- Herausforderungen bei der Anwendung von IFRS 15 auf langfristige Fertigungsaufträge
- Aktivierung von Vertragskosten nach IFRS 15
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Die Arbeit leitet mit einer Problemstellung ein, die den Fokus auf die unterschiedlichen Ansätze der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen nach Handelsrecht und IFRS 15 lenkt. Es wird die Notwendigkeit eines detaillierten Vergleichs der beiden Regelwerke hervorgehoben, um die jeweiligen Vor- und Nachteile aufzuzeigen und ein besseres Verständnis für die damit verbundenen Herausforderungen zu schaffen. Die Einleitung betont die Relevanz des Themas für Unternehmen, die langfristige Fertigungsaufträge abwickeln.
2 Definition langfristige Fertigungsaufträge: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition von langfristigen Fertigungsaufträgen, wobei die Abgrenzung zu kurzfristigen Aufträgen im Vordergrund steht. Es werden Kriterien definiert, die zur Einordnung eines Auftrags als langfristig relevant sind. Dies umfasst beispielsweise die Dauer des Auftrags, den Umfang des Projekts und die Komplexität der Fertigungsprozesse. Die Definition dient als Grundlage für die weiteren Analysen in der Arbeit.
3 Gewinnrealisierung nach handelsrechtlichen GoB: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Gewinnrealisierung nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Es werden die relevanten Gewinnrealisierungskriterien und -methoden detailliert erläutert, wobei insbesondere das Prinzip des quasisicheren Anspruchs und die Methoden der Completed-Contract-Methode und der Percentage-of-Completion-Methode im Detail beschrieben und verglichen werden. Der Fokus liegt auf den rechtlichen Aspekten und den praktischen Implikationen für die Bilanzierung.
4 Gewinnrealisierung nach IFRS 15: Dieses Kapitel analysiert die Gewinnrealisierung nach IFRS 15 „Revenue from Contracts with Customers“. Es wird die Entstehungsgeschichte des Standards erläutert und das fünfstufige Modell der Erlöserfassung im Detail dargestellt. Besondere Aufmerksamkeit wird den Herausforderungen gewidmet, die sich bei der Anwendung der Percentage-of-Completion-Methode auf langfristige Fertigungsaufträge ergeben. Weiterhin wird die Aktivierung von Vertragskosten nach IFRS 15 untersucht und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung erläutert.
Schlüsselwörter
Gewinnrealisierung, langfristige Fertigungsaufträge, handelsrechtliche GoB, IFRS 15, Completed-Contract-Methode, Percentage-of-Completion-Methode, quasisicherer Anspruch, Vertragskostenaktivierung, Erlöserfassung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen und vergleicht kritisch die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) mit IFRS 15.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Unterschiede in den Methoden und Kriterien der Gewinnrealisierung nach GoB und IFRS 15. Konkret werden die Gewinnrealisierungskriterien nach GoB, ein Vergleich der Methoden Completed-Contract und Percentage-of-Completion, das fünfstufige Modell der Erlöserfassung nach IFRS 15, die Herausforderungen bei der Anwendung von IFRS 15 auf langfristige Fertigungsaufträge und die Aktivierung von Vertragskosten nach IFRS 15 behandelt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Problemstellung, 2. Definition langfristiger Fertigungsaufträge, 3. Gewinnrealisierung nach handelsrechtlichen GoB, 4. Gewinnrealisierung nach IFRS 15 und 5. Thesenförmige Zusammenfassung. Jedes Kapitel wird durch eine kurze Zusammenfassung im Inhaltsverzeichnis und im Kapitel "Zusammenfassung der Kapitel" erläutert.
Was sind die wichtigsten Gewinnrealisierungskriterien nach GoB?
Nach GoB spielt das Prinzip des quasisicheren Anspruchs eine zentrale Rolle. Zusätzlich werden Methoden wie die Completed-Contract-Methode und die Percentage-of-Completion-Methode zur Gewinnrealisierung angewendet.
Wie funktioniert die Gewinnrealisierung nach IFRS 15?
IFRS 15 verwendet ein fünfstufiges Modell zur Erlöserfassung. Die Arbeit erläutert dieses Modell detailliert und beleuchtet die Herausforderungen bei der Anwendung der Percentage-of-Completion-Methode im Kontext langfristiger Fertigungsaufträge, sowie die Aktivierung von Vertragskosten.
Welche Methoden der Gewinnrealisierung werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Completed-Contract-Methode und die Percentage-of-Completion-Methode sowohl im Kontext von GoB als auch von IFRS 15.
Welche Herausforderungen werden bei der Anwendung von IFRS 15 auf langfristige Fertigungsaufträge diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die sich bei der Anwendung des fünfstufigen Modells von IFRS 15 und insbesondere der Percentage-of-Completion-Methode auf langfristige Fertigungsaufträge ergeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewinnrealisierung, langfristige Fertigungsaufträge, handelsrechtliche GoB, IFRS 15, Completed-Contract-Methode, Percentage-of-Completion-Methode, quasisicherer Anspruch, Vertragskostenaktivierung, Erlöserfassung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist ein kritischer Vergleich der handelsrechtlichen GoB mit IFRS 15 hinsichtlich der Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen, um die Unterschiede in den Methoden und Kriterien aufzuzeigen und ein besseres Verständnis für die damit verbundenen Herausforderungen zu schaffen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Unternehmen, die langfristige Fertigungsaufträge abwickeln, sowie für Personen, die sich mit der Rechnungslegung nach GoB und IFRS 15 auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Anna Prinzler (Auteur), 2018, Gewinnrealisierung bei langfristigen Fertigungsaufträgen. Kritische Würdigung der Gewinnrealisierung nach handelsrechtlichen GoB im Vergleich zu IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1142526