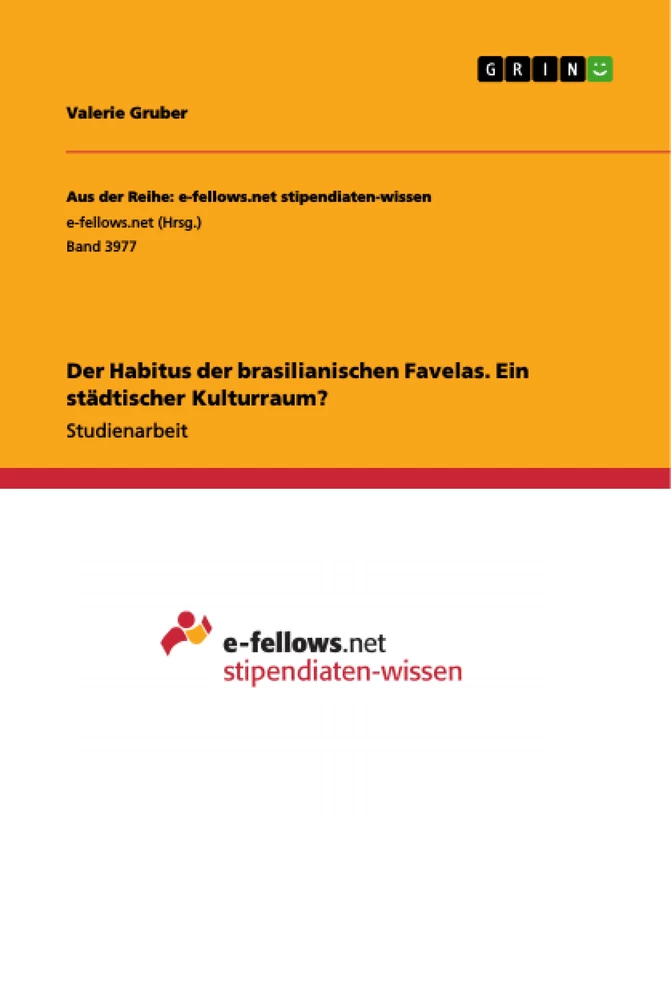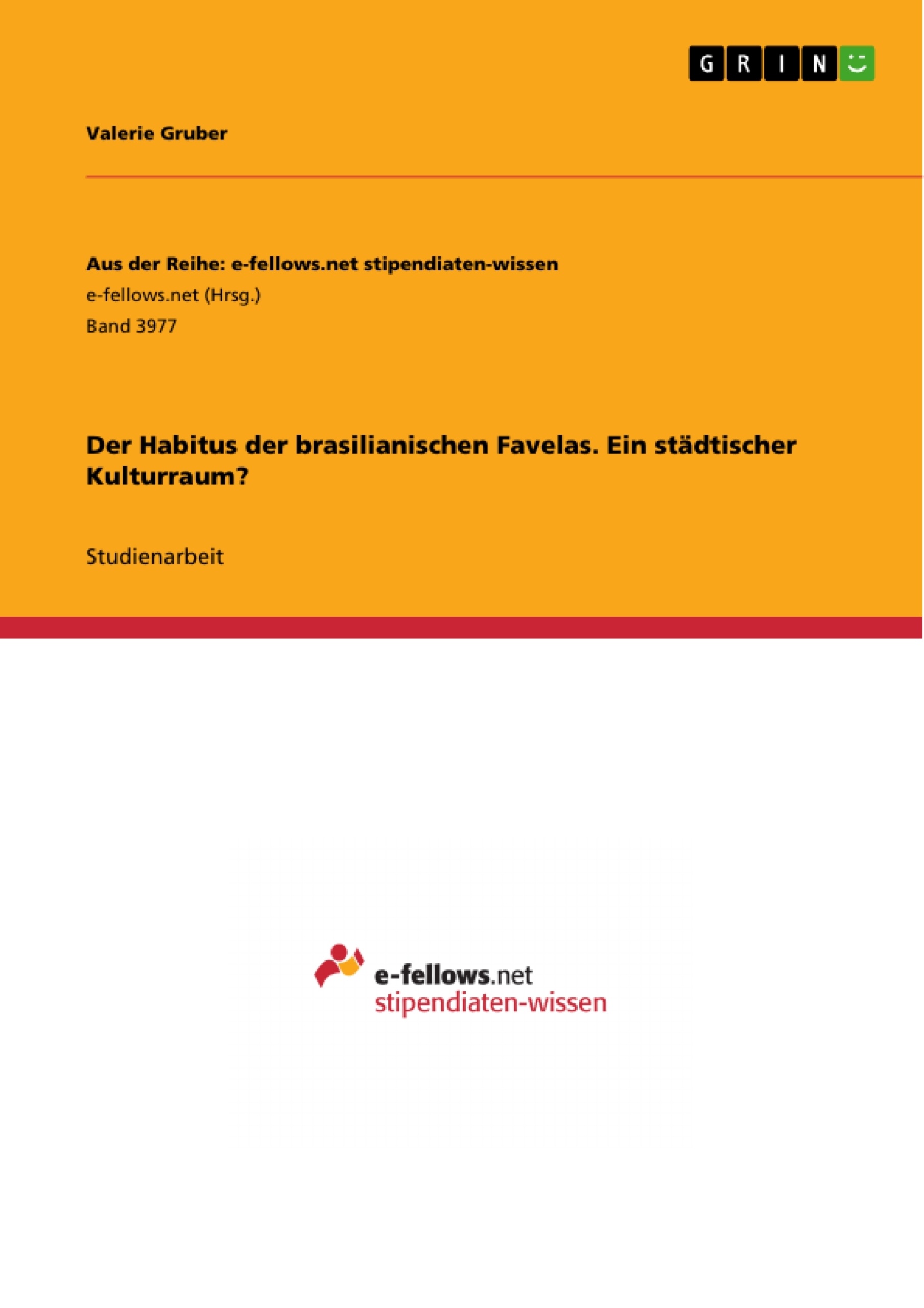Diese Arbeit geht der Frage nach, inwieweit die vielfältige Welt der brasilianischen Favelas einen städtischen Kulturraum bildet. Hierzu werden Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata systematisiert, die im Sinne des Bourdieuschen Habitus das Alltagsleben in Favelas prägen. Auf Basis einer fundierten internationalen Literaturrecherche synthetisiert die Arbeit qualitative Studien von Autor*innen aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen und fachlichen Kontexten, die die Sichtweisen und Erfahrungen der Bewohner*innen marginalisierter Stadtviertel in den Fokus rücken.
Dabei offenbart sich ein brüchiges Kulturraumkonstrukt, das durch Einheit und Vielfalt gleichermaßen gekennzeichnet ist. Die Betrachtung des Habitus zeigt, dass strukturelle Exklusionsmechanismen verinnerlicht und somit sowohl von privilegierten als auch von marginalisierten Akteuren reproduziert werden können. Dennoch legt die Analyse zahlreiche Ambivalenzen offen, die die Multiplizität der Lebenswelt Favela unterstreichen und somit das Habituskonzept an seine Grenzen stoßen lassen. Insgesamt fördert die Arbeit das Verständnis für die alltäglichen Überlebenskämpfe, die von Favela-Bewohner*innen angesichts von sozialer Ungleichheit und Rassismus bestritten werden. Zudem schafft sie durch die Reflexion des gegenwärtigen Forschungsstandes eine wichtige Grundlage für weiterführende empirische Studien.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen
2.1 Grundzüge des Habitus-Konzepts nach Pierre Bourdieu
2.2 Die historische Genese der Ungleichheit in der brasilianischen Gesellschaft
2.3 Eine Einführung in die vielschichtige Welt der brasilianischen Favelas
3. Zentrale Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata von Favela-Bewohner*innen
3.1 Alltagsleben unter dem Stigma der Kriminalität
3.2 Soziale Beziehungen zwischen Solidarität und Fragilität
3.3 Das Eigene und das Andere – von der gegenseitigen Abgrenzung bis hin zur sozialen und rassistischen Diskriminierung
3.4 Leben in einem System struktureller Ungleichheit
3.5 Alltagspraxis zwischen politischer Resignation und widerständiger Eigeninitiative
4. Favelas als vielschichtige Kulturraumkonstrukte
4.1 Der kollektive Identifikationsraum Favela zwischen Scham und Stolz
4.2 Der Kulturraum Favela als brüchiges Konstrukt der Einheitlichkeit
5. Fazit: Der Habitus der brasilianischen Favelas zwischen Einheit und Vielfalt
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Überwindung der Dichotomie zwischen Individuum und Gesellschaft durch das Habituskonzept
Abb. 2: Räumliche Nähe und soziale Distanz: Hochhäuser und Favelas in Salvador da Bahia
Abb. 3: Karikatur "Uma limpeza indispensável", Anfang 20. Jahrhundert
Abb. 4: Titelblatt des Wochenmagazins Veja vom 24.01.2001
Abb. 5: Capoeira in der Favela Santa Marta in Rio de Janeiro
Abb. 6: Bedingtheit unterschiedlicher Habitusformen und Lebensstile durch verschiedene Lebensbedingungen
1. Einleitung
"'Wir leben hier in der Favela unter schwierigen Bedingungen. Kämpfen jeden Tag um eine Existenz in Würde. Die Menschen außerhalb wissen nichts über uns und unser Leben hier. Es interessiert sie auch nicht. Das ist es, was uns traurig und ärgerlich macht.'"1
Die Ausgangsproblematik der vorliegenden Arbeit könnte von der zitierten Bewohnerin einer Favela2 aus der nordostbrasilianischen Metropole Salvador da Bahia nicht besser auf den Punkt gebracht werden. Sie lebt in einem der vielen marginalisierten Stadtviertel Brasiliens, die auf politischer, medialer und nicht zuletzt auf wissenschaftlicher Ebene häufig im Zentrum des Interesses externer Akteure stehen. Paradoxerweise werden die Sichtweisen der Bewohner*innen dabei regelmäßig außer Acht gelassen. Diese Tatsache wird durch die Ereignisse um die Fußballweltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016 verdeutlicht, bei denen der Staat versuchte, die Favelas als vermeintliche Machträume der Drogenkriminalität gewaltsam unter seine Kontrolle zu bringen – ohne zuvor die tatsächlichen Machtstrukturen innerhalb der Viertel zu analysieren. Darüber hinaus implementieren staatliche wie nichtstaatliche Akteure immer wieder Hilfsprogramme in den Favelas – ohne die Bewohner*innen vorab zu fragen, welche Problematiken sie in ihrer Alltagsbewältigung wirklich als dringlich wahrnehmen. Und selbst von wissenschaftlicher Seite gibt es unzählige Studien, welche die komplexe Realität der Favelas beleuchten – ohne dabei grundlegend vom herrschenden Diskurs der Außenstehenden abzuweichen.
Daran zeigt sich, dass es an der Zeit ist, die Innenperspektiven der Favela-Bewohner*innen in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Um diesem Ziel näher zu kommen, verschafft die vorliegende Arbeit einen Überblick über die zentralen Erkenntnisse aus empirischen Studien, die auf umfangreicher qualitativer Feldforschung basieren. Dabei wird der Frage nachgegangen, inwieweit Favelas als städtische Kulturräume betrachtet werden können. Hierzu erfolgt in Anlehnung an Pierre Bourdieu eine Analyse des Habitus der Bewohner*innen, welcher sich insbesondere in Form ihrer Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata zeigt. Indem sie den gegenwärtigen Forschungsstand reflektiert, legt die Arbeit ein wichtiges Fundament für weiterführende empirische Studien.
Im Bereich der deutschsprachigen Sozialgeographie können die Monographien „Habitus der Scham“ von Veronika Deffner (2010) und „Exklusion im Zentrum“ von Eberhard Rothfuß (2012) als hilfreiche Ausgangspunkte angesehen werden. Für die nachfolgenden Ausführungen wurden diese beiden europäischen Positionen jedoch um eine breite internationale und interdisziplinäre Literaturrecherche erweitert, um die zentralen Komponenten des Habitus herausarbeiten und zugleich einen Einblick in die Vielschichtigkeit gängiger Alltagspraktiken von Favela-Bewohner*innen geben zu können. Dabei wurde das Ziel verfolgt, empirische Studien aus möglichst vielen verschiedenen Favelas sowie die Perspektiven von Forschenden aus unterschiedlichen sozialen, geographischen, kulturellen und fachlichen Kontexten in die Analyse einzubeziehen. Darüber hinaus wird im Folgenden besonderer Wert auf Zitate von Favela-Bewohner*innen gelegt, um die intersubjektive Nachprüfbarkeit der Ausführungen zu gewährleisten, die Argumentation zu veranschaulichen und schließlich dem Diskurs der Betroffenen so nahe wie möglich zu kommen.
Zu Beginn der Arbeit erfolgt ein skizzenhafter Überblick über zentrale theoretische und geschichtliche Grundlagen (Kapitel 2). Neben dem von Bourdieu inspirierten konzeptionellen Rahmen wird in diesem Teil auch auf die historische Genese der Ungleichheit in Brasilien sowie auf einige Charakteristika von Favelas eingegangen. Der darauffolgende Hauptteil (Kapitel 3) widmet sich zentralen Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsmustern der Favela-Bewohner*innen. Dabei werden insbesondere ihre Sichtweisen bezüglich ihrer Stigmatisierung, ihrer sozialen Beziehungen, der Abgrenzung gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen und der strukturellen Ungleichheit dargestellt, ebenso wie die Handlungsstrategien, die sie angesichts ihrer Alltagsrealität entwickeln. Aus dieser Argumentation wird im abschließenden Teil gefolgert, inwieweit Favelas Konstrukte zwischen Einheit und Vielfalt darstellen und als städtische Kulturräume angesehen werden können.
2. Grundlagen
2.1 Grundzüge des Habitus-Konzepts nach Pierre Bourdieu
Als theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit dient das Habituskonzept des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, dessen wesentliche Grundzüge Gegenstand der nachfolgenden Darstellung sind. Der Habitus umfasst die Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata, die im Rahmen der Sozialisation erworben werden und daher jedem Individuum immanent sind. Als "Erzeugungs- und Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen"3 stellt er einen Praxissinn dar, der die Einstellungen, Präferenzen, Gewohnheiten, das Auftreten sowie die Handlungs- und Lebensweisen innerhalb einer sozialen Gruppe aufeinander abstimmt.4
Wichtig ist dabei, dass der Habitus aus den materiellen, sozialen und kulturellen, das heißt aus den objektiven Lebensbedingungen heraus entsteht und von den Individuen in Form von "Grenzen möglicher und unmöglicher Praktiken"5 internalisiert wird. Er ist also "ein strukturierender Mechanismus, der von innen heraus in den Akteuren wirkt, obwohl er genaugenommen weder strikt individuell ist noch an sich das Verhalten bereits völlig determiniert."6 Denn als Ergebnis der "Verinnerlichung der äußeren Strukturen"7 erzeugt er Praktiken, welche primär auf die Reproduktion dieser objektiven Gegebenheiten ausgerichtet sind, daneben aber auch an die Anforderungen der jeweils vorliegenden Situation angepasst werden können.8 Der Habitus ist damit "ein Produkt der Geschichte [...], das [...] dauerhaft, aber nicht unveränderlich"9 ist, da er auch durch rezente Erfahrungen beeinflusst werden kann.10
Gerade für den brasilianischen Kontext ist von zentraler Bedeutung, dass differente Lebensbedingungen verschiedene Formen des Habitus generieren.11 Somit können innerhalb derselben sozialen Klasse Alltagspraktiken entstehen, welche "konvergent und objektiv aufeinander abgestimmt sind, und zwar jenseits jeder kollektiven Absicht und jedes kollektiven Bewußtseins, geschweige denn irgendeiner Form von 'Verschwörung'".12 Dementsprechend überwindet Bourdieu mit seinem Habituskonzept die Dichotomie zwischen den objektiv in der Gesellschaft vorliegenden Existenzbedingungen und der subjektiv gelebten Alltagswelt des Individuums,13 wie Abbildung 1 veranschaulicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 : Überwindung der Dichotomie zwischen Individuum und Gesellschaft durch das Habituskonzept
Quelle: DEFFNER (2010a, S. 42).
Angesichts der bedeutenden Auswirkungen der äußeren Lebensbedingungen auf den Habitus erfordert dessen Analyse auch eine nähere Betrachtung des Habitats und seiner gesellschaftlichen Repräsentation. Schließlich stellt laut Bourdieu der "in bestimmter Weise von uns bewohnte und uns bekannte Raum [...] die Objektivierung vergangener wie gegenwärtiger sozialer Verhältnisse"14 dar.
In diesem Sinne spiegelt der Platz, den ein Individuum im physischen Raum einnimmt, dessen Position in der Gesellschaft wider – was im Falle des Wohnortes Favela von besonderer Relevanz ist, wie die vorliegende Arbeit zeigen wird. Dies hat zur Konsequenz, dass sozial konstruierte Klassifikationen und Rangordnungen insbesondere in Form einer Hierarchisierung des städtischen Raumes sichtbar in Erscheinung treten.15 Diese in Brasilien deutlich erkennbare visuelle Wahrnehmbarkeit gesellschaftlicher Distanzen bedingt einen "Naturalisierungseffekt",16 durch den die sozialen Unterschiede oft unhinterfragt akzeptiert werden, da sie den Eindruck natürlicher Abgrenzungen vermitteln. Wie diese sozialen Diskrepanzen, die sich augenfällig im Stadtraum niederschlagen und den Habitus der brasilianischen Favelas maßgeblich beeinflussen, historisch gewachsen sind, wird im nächsten Abschnitt überblickshaft skizziert.
2.2 Die historische Genese der Ungleichheit in der brasilianischen Gesellschaft
Den Ausgangspunkt für das folgende Kapitel bildet das Bourdieusche Verständnis, dass die "sozialen Akteure [...] das Produkt der Geschichte [...] des ganzen sozialen Feldes und der im Laufe eines bestimmten Lebenswegs in einem bestimmten Unterfeld akkumulierten Erfahrung"17 sind. Die für den Habitus der Favela relevante historische Erfahrung, die im Rahmen dieser Arbeit nur in ihren wichtigsten Grundzügen umrissen werden kann, geht bis in die Ära der portugiesischen Kolonisierung zurück. Diese war ab 1538 durch die Einfuhr afrikanischer Versklavter geprägt, welche die Plantagenwirtschaft und dabei vor allem den Zucker- sowie den späteren Gold- und Kaffeehandel ermöglichen sollten.18
In diesem Kontext bildete sich ein agrarisches Gesellschaftssystem heraus, das unter Bezug auf den brasilianischen Anthropologen Gilberto Freyre mit der Metapher "Casa-Grande e Senzala" ("Herrenhaus und Sklavenhütte")19 beschrieben werden kann. Das gesellschaftliche Zentrum stellte die Casa-Grande der Kolonialherren dar, welche über patriarchalische Strukturen mit den sie umgebenden Senzalas der Versklavten verbunden war.20 Dadurch bestand eine reziproke Abhängigkeit auf Basis gegenseitiger Rechte und Pflichten, die durch die gewaltsame Unterdrückung der Versklavten aus Afrika reproduziert wurde.21
Jene Grundzüge des ländlichen Gesellschaftssystems blieben auch angesichts der zunehmenden urbanen Entwicklung ab dem 19. Jahrhundert erhalten und setzten sich "in den Städten in Gestalt des sozialen Kontrastes von 'Herrenhaus und Armenhütte' fort."22 Seither wird der Status der afrikanischstämmigen Bevölkerung durch die soziale Stratifizierung der Kolonialgesellschaft beeinträchtigt, in der den Versklavten die unterste Hierarchieebene zukam. Ihnen wurde nur in den seltensten Fällen, und wenn dann in erster Linie durch Einheirat, die Möglichkeit zuteil, die für einen gesellschaftlichen Aufstieg erforderlichen Attribute Bildung und Besitz zu erlangen.23
Erst im Jahr 1888 schaffte das seit 1822 unabhängige Brasilien die Versklavung auf internationalen Druck hin ab. Dadurch entstand eine Überzahl an unbemittelt freigelassenen Arbeitssuchenden, welche allenfalls als billige abhängige Arbeitskräfte ohne soziale Absicherung Einzug in das kapitalistische System finden konnten. Im 20. Jahrhundert bedingten der staatlich geförderte ökonomische Fortschritt sowie die Agrarmodernisierung überdies eine massive Abwanderung arbeitsloser Landbevölkerung aus den ruralen, vornehmlich nordöstlichen Regionen in die vor allem im Südosten gelegenen urbanen Zentren Brasiliens. Dies führte zu einer massenhaften Verelendung in den explosionsartig anwachsenden Ballungsräumen, von der die Mehrheit der ehemaligen Versklavten betroffen war.24
Ideologisch wurde diese Entwicklung durch die bis heute in Form eines subtilen Rassismus wirkende "'Weißwerdungs-Ideologie'"25 untermauert, welche den Nachkommen der Versklavten aus Afrika eine untergeordnete Stellung zuweist und zu deren sozialer und symbolischer Aufwertung eine aufhellende Bevölkerungsmischung vorsieht. Ergänzend kam ein idealistischer "'Mythos der Rassendemokratie'"26 hinzu, der unter der "Deklaration des 'harmonischen Zusammenlebens der Rassen'"27 jegliche Machtdifferenzen verschleiert und damit die aus der Kolonialgesellschaft stammende rassistische Hierarchisierung unreflektiert als natürliche Gegebenheit hinnimmt.
Entscheidend ist in Bezug auf die aktuelle Situation, dass bis heute keine relevanten sozial- oder wirtschaftspolitischen Ansätze zu verzeichnen sind, die zu einer nennenswerten Änderung der Besitzverhältnisse und der strukturellen Ungleichverteilung des nationalen Reichtums geführt hätten.28 Vielmehr ist das gegenwärtige Brasilien "eine moderne Klassengesellschaft, deren Bevölkerungsmehrheit eine 'beherrschte' Unterklasse verkörpert, die von den Gütern und Dienstleistungen der Gesellschaft weitgehend ausgeschlossen ist."29 Aufgrund ihrer Benachteiligung durch schlechtere Verwirklichungschancen übernehmen die Marginalisierten nach wie vor diejenigen Aufgaben, die sich die Mittel- und Oberschicht seit der Zeit der Versklavung von Afrikaner*innen zu erfüllen weigert30 – zusätzlich zu den neuen Tätigkeiten und Repressionsformen, die im Rahmen der kapitalistischen Ordnung entstanden sind.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die privilegierten Klassen den ärmeren Bevölkerungsgruppen oft nicht explizit den Status der Inferiorität zuschreiben. Stattdessen ist auf der Ebene der Alltagspraktiken ein präreflexiver Konsens erkennbar, durch den letztere unbewusst als subalterne Bürger*innen klassifiziert werden. Dies äußert sich unter anderem in subtilen Formen der Stigmatisierung und Diskriminierung sowie in einer differenzierten Anwendung des Gesetzes, das offiziell für alle Brasilianer*innen gleichermaßen gelten sollte.31 Auf die alltagsweltlichen Konsequenzen dieses Phänomens wird in Kapitel 3 fundierter eingegangen.
Die historisch gewachsene gesellschaftliche Ungleichheit manifestiert sich nicht nur in Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata; in den multifragmentierten Städten Brasiliens ist sie anhand der unterschiedlichen Wohn- und Aktionsräume von Marginalisierten und Privilegierten auch visuell eindeutig erkennbar. Diese treten in den Worten Bourdieus "in Form räumlicher Gegensätze [...] als eine Art spontaner Metapher des sozialen Raumes"32 auf. Zum Abschluss dieses Kapitels und als Überleitung zur anschließenden Betrachtung des Favela-Konzeptes illustriert Abbildung 2 am Beispiel der nordostbrasilianischen Stadt Salvador da Bahia, welch zentrale Bedeutung der Architektur als Ausdrucksform symbolischer Macht und sozialer Distanz zukommt.33
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 : Räumliche Nähe und soziale Distanz: Hochhäuser und Favelas in Salvador da Bahia
Quelle: DEFFNER (2010b).
2.3 Eine Einführung in die vielschichtige Welt der brasilianischen Favelas
In Abbildung 2 ist deutlich zu erkennen, dass "Favelas [...] die Raum gewordene Geschichte der ungleichen Klassengesellschaft"34 Brasiliens sind. Denn sie stellen eine spezifische Art von Wohnsiedlungen gesellschaftlich marginalisierter Bevölkerungsschichten in den brasilianischen Städten dar, die – in Abgrenzung zu anderen Unterschichtsvierteln – ursprünglich durch die illegale Inbesitznahme von Gebieten aus öffentlichem oder privatem Eigentum entstanden sind. Diese Landbesetzungen erfolgten üblicherweise auf Flächen, die aufgrund von Gefahren wie Überschwemmungen oder Hangrutschungen nicht für eine legale Erschließung genutzt werden konnten. Nachträglich wurde der Großteil von ihnen jedoch rechtlich anerkannt und konsolidiert, sodass diese Viertel heutzutage nicht mehr pauschal als illegal klassifiziert werden können.35
Die ersten Favelas wurden Schätzungen zufolge um die Wende zum 20. Jahrhundert auf den als morros bezeichneten Granitfelsen von Rio de Janeiro errichtet. Auslöser dieser Invasionen war die durch die ökonomische Modernisierung dynamisierte Massenmigration arbeitsuchender Landarbeiter in die Städte. Die verarmte Bevölkerung, die angesichts ihrer geringen finanziellen Ressourcen ausschließlich mietfrei in selbst errichteten Behausungen überleben konnte, verlagerte ihren Wohnraum im Lauf der Zeit zunehmend von peripheren Hüttenvierteln in Richtung Innenstadt, um die kostspielige Distanz zu Arbeits- und Versorgungszentren zu verringern.36
Aufgrund ihrer irregulären Entwicklungsgeschichte werden Favelas häufig als sogenannte 'informelle' Siedlungen bezeichnet und damit gegenüber der 'formellen' Stadt, zu der sie sich meist in direkter räumlicher Nähe befinden, abgegrenzt sowie diskursiv abgewertet.37 Letztere repräsentiert neben dem Wohnraum der privilegierten Schichten vor allem Arbeitsplatzmöglichkeiten sowie den Zugang zu staatlichen Versorgungseinrichtungen. Im Gegensatz dazu sind die Favelas nach wie vor vielerorts – wenn auch nicht in allen Fällen – durch eine prekäre Anbindung an die städtische Infrastruktur gekennzeichnet, insbesondere im Bereich der Abfallentsorgung.38 Diese mangelnde Eingliederung wird von der Mittel- und Oberklasse jedoch häufig nicht als Konsequenz struktureller gesellschaftlicher Ungleichheit angesehen, sondern als Problem an sich und als Ursprung sämtlicher weiterer urbaner Problematiken, darunter der Kriminalität.39
Besonders deutlich wird dieses historisch entstandene, negative Perzeptionsschema anhand einer karikativen Darstellung aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts, in der die Favela-BewohnerInnen in Form von Parasiten die Hügel von Rio de Janeiro schädigen. Unter dem Titel "Uma limpeza indispensável" ("Eine unerlässliche Säuberung") werden sie von dem Arzt und Gesundheitsbeamten Dr. Oswaldo Cruz im Rahmen eines städtischen Hygieneprojektes entfernt.40
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Karikatur "Uma limpeza indispensável", Anfang 20. Jahrhundert
Quelle: FERNANDES (2014, S. 56).
Diese zum Teil bis heute erhaltene Repräsentation als Unheil bringende urbane Krankheit hat vielfach zur Zerstörung von Favelas und zur Vertreibung ihrer Bewohnerschaft geführt, wobei dieses Vorgehen meist mit der Illegalität der Landbesetzung gerechtfertigt wird.41 Ungeachtet derartiger Bekämpfungsmaßnahmen und der Lage in Risikogebieten hat das räumliche und zahlenmäßige Wachstum der als 'informell' stigmatisierten Viertel das der sogenannten 'formellen' Stadt seit den 1950er Jahren übertroffen. Dies gilt insbesondere für die größten Metropolen Brasiliens, in denen Schätzungen zufolge rund 20 bis 40 Prozent der Stadtbevölkerung in Favelas leben.42 Hinzu kommt, dass die privilegierten Klassen im Lauf der Zeit zunehmend die unerlässliche Bedeutung der Favela-Bewohner*innen als geringfügig bezahlte Arbeitskräfte für die brasilianische Ökonomie erkannt haben. So wurden vor allem in den vergangenen zwei Jahrzehnten verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen durchgeführt, durch welche die Favelas zumindest teilweise in das städtische Versorgungsnetz eingegliedert wurden.43
Insgesamt muss darauf hingewiesen werden, dass die unzähligen brasilianischen Favelas von Stadt zu Stadt und selbst innerhalb desselben Viertels sehr differenzierte Charakteristika aufweisen.44 So können "weder hinsichtlich der Lage im Stadtgebiet, der infrastrukturellen Ausstattung der Viertel, der Wohnverhältnisse, noch bezüglich sozio-ökonomischer Standards, Hautfarbe oder Herkunft der EinwohnerInnen [...] generalisierende Aussagen getroffen werden".45 Auch in ihrer Größe und der Dauer ihres Bestehens unterscheiden sich die Favelas maßgeblich. Ihre Bewohnerschaft umfasst inzwischen nicht mehr nur den ärmsten Teil der Bevölkerung, der seine Existenz mit wechselnden Tätigkeiten ohne soziale Grundversorgung zu sichern sucht, sondern auch Mitglieder der unteren Mittelschichten, die über ein geregeltes Einkommen im formalisierten Sektor verfügen und beispielsweise aufgrund ihrer sozialen Beziehungen dort wohnen.46
In Anbetracht dieser Heterogenität können Favelas nicht simplifizierend auf einzelne Teilaspekte struktureller Begriffsdefinitionen reduziert werden, ebenso wenig wie man sie homogenisierend als die einzige Wohnform brasilianischer Unterschichten auffassen darf. Nichtsdestotrotz wurden und werden ihre Bewohner*innen, wie die bisherigen Ausführungen zeigen, aus der historischen Erfahrung heraus deutlich von der restlichen Stadt abgegrenzt und vielfach mit einem negativen Stigma belegt, das ihre gesellschaftliche Marginalisierung verfestigt.47
Wie das anschließende Kapitel 3 verdeutlichen wird, wirkt sich diese gedankliche Repräsentation massiv auf den Habitus der Favela-Bewohner*innen aus, da sie von ihnen häufig internalisiert und reproduziert, aber auch umgedeutet und widerlegt wird. Neben den objektiven Lebensbedingungen stellt damit auch die Stigmatisierung des Wohnortes einen wesentlichen Ausgangspunkt für die nun erfolgende Analyse des Habitus dar.
3. Zentrale Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata von Favela-Bewohner*innen
3.1 Alltagsleben unter dem Stigma der Kriminalität
"Wenn heutzutage von ››problematischen Banlieues‹‹ oder von ››Ghettos‹‹ die Rede ist, so wird hierbei fast automatisch nicht etwa auf Wirklichkeiten Bezug genommen, die ja ohnehin jenen, die am eilfertigsten hierüber das Wort ergreifen, weitgehend unbekannt sind. Vielmehr sind hier Phantasmen angesprochen, die seitens Sensationspresse, Propaganda oder politischer Gerüchte mit emotionalen Eindrücken genährt werden, die mit mehr oder weniger unkontrollierten Begriffen und Bildern aufgeladen sind."48
Diese treffende Aussage von Pierre Bourdieu kann sehr gut auf die Stigmatisierung der Favelas als Räume der Angst und Gewalt übertragen werden. Denn seit ihrer Entstehung werden diese Viertel in der kollektiven Wahrnehmung mit Kriminalität in Verbindung gebracht, was durch die Massenmedien noch verstärkt wird. So verbreitet beispielsweise das in Abbildung 4 gezeigte Titelblatt des bedeutenden brasilianischen Nachrichtenmagazins Veja die Idee einer "Umzingelung" des sogenannten Zentrums durch die ihm entgegengestellte Peripherie ("O Cerco da Periferia"). Damit wird unmissverständlich die Furcht vor den sechsmal schneller wachsenden Marginalvierteln geschürt. Diese werden pauschal als "Gürtel aus Armut und Kriminalität" abgestempelt, welcher die Mittelklasseviertel "ausquetscht"("Os bairros de classe média estão sendo espremidos por um cinturão de pobreza e criminalidade que cresce seis vezes mais que a região central das metrópoles brasileiras").49
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4 : Titelblatt des Wochenmagazins Veja vom 24.01.2001
Quelle: FERNANDES (2014, S. 57).
Angesichts der Omnipräsenz von derart verallgemeinernden und Angst verbreitenden Pauschalurteilen verwundert es kaum, dass die Mittel- und Oberklasse harte Gewaltbekämpfungsmaßnahmen in den Favelas indifferent hinnimmt oder gar unterstützt.50 Darüber hinaus demonstrieren auch die staatlichen Akteure – insbesondere des polizeilichen und rechtlichen Apparates – eine tiefgreifende Verinnerlichung der Stigmatisierungspraktiken, indem sie gegenüber Favela-Bewohner*innen in aller Regel schnellere und härtere Sanktionen ergreifen. Gerade im Umgang mit schwarzen männlichen Jugendlichen, die auf der vorreflexiven Ebene als Personifikation der Delinquenz gelten, werden nicht selten die Grenzen von Menschen- und Bürgerrechten überschritten.51
[...]
1 Favela-Bewohnerin aus Salvador da Bahia, zit. nach ROTHFUSS (2012, S. 11).
2 Der Begriff der Favela beschreibt einen spezifischen, wenn auch sehr vielfältigen Typus brasilianischer Stadtviertel. Wie in Kapitel 2.3 näher erläutert wird, kann die Bezeichnung Favela ein Stigma implizieren; zugleich wird sie von den Bewohner*innen zum Teil auch affirmativ verwendet, um den Wert ihres Viertels zu bekräftigen. Unter kritischer Berücksichtigung dieser verschiedenen moralischen Konnotationen wird in dieser Arbeit am Begriff der Favela festgehalten, weil er das analysierte Phänomen am präzisesten beschreibt. Damit soll jedoch keinesfalls eine Stigmatisierung einhergehen.
3 BOURDIEU (1976, S. 165).
4 Vgl. ebd. (S. 178); BOURDIEU; WACQUANT (2006, S. 160); DEFFNER (2010a, S. 41ff.).
5 SCHWINGEL (2000, S. 67).
6 WACQUANT (2006, S. 39; Hervorh. im Orig.).
7 Ebd.
8 Vgl. BOURDIEU (1976, S. 170).
9 BOURDIEU; WACQUANT (2006, S. 167f.).
10 Vgl. ebd.
11 Vgl. BOURDIEU (1987, S. 278). Die Bedingtheit differenter Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata durch unterschiedliche Lebensbedingungen wird in Abb. 6 im Anhang grafisch illustriert.
12 BOURDIEU; WACQUANT (2006, S. 158f.).
13 Vgl. DEFFNER (2010a, S. 41ff.).
14 BOURDIEU (1991, S. 28).
15 Vgl. ebd. (S. 26f.); BOURDIEU (1998, S. 18f.).
16 BOURDIEU (1991, S. 27).
17 BOURDIEU; WACQUANT (2006, S. 170).
18 Vgl. DEFFNER (2010a, S. 58f.); ROTHFUSS (2008, S. 15).
19 Vgl. ausführlich FREYRE (1995).
20 Vgl. DEFFNER (2010a, S. 62); ROTHFUSS (2008, S. 15).
21 In diesem System standen die Versklavten unter einem patriarchalischen Schutz und verfügten über gewisse, wenn auch sehr beschränkte Rechte. So war es ihnen mitunter möglich, sich zu Bruderschaften zusammenzuschließen und (in begrenztem Umfang) ihre religiösen Praktiken fortzuführen, wodurch bis heute Elemente aus diversen afrikanischen Kulturen in Brasilien erhalten geblieben sind. Exemplarisch ist an dieser Stelle auf Formen des religiösen Synkretismus zu verweisen. Vgl. DEFFNER (2010a, S. 62f.).
22 Ebd. (S. 63).
23 Vgl. ebd.; ROTHFUSS (2008, S. 16f.).
24 Vgl. DEFFNER (2010a, S. 63f.); ROTHFUSS (2008, S. 17).
25 DEFFNER (2010a, S. 64).
26 Ebd.
27 Ebd. (S. 65).
28 Die konkreten Maßnahmen der einzelnen Regierungen können an dieser Stelle aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit nicht dargelegt werden. Für einen knapp skizzierten Überblick vgl. ROTHFUSS (2008, S. 17f.), für eine etwas detailliertere Darstellung vgl. DEFFNER (2010a, S. 67ff.).
29 DEFFNER (2010a, S. 73).
30 Vgl. FERNANDES (2012, S. 170).
31 Zur Veranschaulichung dieser Tatsache zieht der brasilianische Soziologe Jessé Souza einen eindringlichen Vergleich: Wird ein Armer Opfer einer Straftat, die durch einen Täter aus der Mittel- oder Oberschicht verübt wurde, wird letzterer aller Voraussicht nach kaum oder gar nicht vor dem Gesetz zur Rechenschaft gezogen. Denn dem marginalisierten Tatopfer wird Souza zufolge vorreflexiv der Wert eines Huhns zugeschrieben. Im umgekehrten Fall eines marginalisierten Täters ist hingegen davon auszugehen, dass dessen Bestrafung mit besonderer Härte vollzogen wird. Vgl. SOUZA (2007, S. 39f.).
32 BOURDIEU (1991, S. 26).
33 Vgl. ebd. (S. 27f.).
34 DEFFNER (2010a, S. 160).
35 Vgl. ebd. (S. 79f.); DEFFNER (2006, S. 23f.); DEFFNER (2008, S. 29).
36 Vgl. DEFFNER (2008, S. 29); DEFFNER (2010a, S. 79f.); HAPPE (2002, S. 9).
37 Die Dichotomie zwischen der 'formellen' und der 'informellen' Stadt ist zwar nach wie vor im brasilianischen Alltag verbreitet, weshalb auch an dieser Stelle darauf verwiesen wird; angesichts ihrer impliziten Wertung muss sie jedoch kritisch und mit Vorsicht verwendet werden.
38 Vgl. DEFFNER (2006, S. 24); DEFFNER (2008, S. 28ff.); DEFFNER (2010a, S. 80f.).
39 Vgl. FERNANDES (2014, S. 55).
40 Vgl. ebd. (S. 55f.); VALLADARES (2009, S. 27f.). Zu der unter der Leitung von Oswaldo Cruz durchgeführten Gesundheitsoffensive vgl. DOS SANTOS (2005).
41 Auch Großevents wie die Fußballweltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016 werden als Legitimationsbasis für die Zwangsumsiedlung von Favela-Bewohner*innen verwendet. Letztere erhalten für die Zerstörung ihrer Häuser allenfalls unzureichende Ausgleichszahlungen. Vgl. ROTH (2014).
42 Vgl. DEFFNER (2008, S. 30); DEFFNER (2010a, S. 79).
43 Vgl. DEFFNER (2008, S. 30); DEFFNER (2010a, S. 80). Ein prominentes Projekt zur Konsolidierung der Favelas von Rio de Janeiro ist das Programm "Favela-Bairro". Vgl. hierzu ausführlich RILEY et al. (2001).
44 Vgl. HAPPE (2002, S. 153); PÖHLER (1999, S. 73); ROTHFUSS (2012, S. 136).
45 HAPPE (2002, S. 10).
46 Vgl. ebd. (S. 9f.).
47 Vgl. ebd. (S. 10; 250).
48 BOURDIEU (1998, S. 17).
49 Vgl. FERNANDES (2014, S. 53; 56f.).
50 Vgl. FERNANDES (2012, S. 175).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Dokuments?
Das Dokument analysiert den Habitus (Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata) der Bewohner brasilianischer Favelas und untersucht, inwieweit Favelas als städtische Kulturräume betrachtet werden können.
Was sind die theoretischen Grundlagen der Analyse?
Die Analyse basiert hauptsächlich auf dem Habitus-Konzept des französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Es werden auch historische und soziale Kontexte berücksichtigt, die die Ungleichheit in der brasilianischen Gesellschaft geprägt haben.
Welche Themen werden in Bezug auf den Habitus der Favela-Bewohner behandelt?
Das Dokument untersucht das Alltagsleben unter dem Stigma der Kriminalität, soziale Beziehungen, Abgrenzung gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen, Leben in einem System struktureller Ungleichheit sowie Alltagspraktiken zwischen politischer Resignation und widerständiger Eigeninitiative.
Wie werden Favelas in dem Dokument charakterisiert?
Favelas werden als vielschichtige Kulturraumkonstrukte dargestellt, die zwischen Scham und Stolz, Einheitlichkeit und Vielfalt oszillieren. Ihre historische Entwicklung und ihre Rolle in der brasilianischen Klassengesellschaft werden beleuchtet.
Welche Rolle spielt die historische Genese der Ungleichheit in Brasilien für die Analyse?
Die historische Genese der Ungleichheit, beginnend mit der portugiesischen Kolonisierung und der Versklavung afrikanischer Bevölkerung, wird als prägender Faktor für die gegenwärtige Situation und den Habitus der Favela-Bewohner*innen betrachtet. Der Mythos der Rassendemokratie und die Weißwerdungs-Ideologie werden als verstärkende Faktoren benannt.
Wie wird die Stigmatisierung der Favelas durch die Medien dargestellt?
Das Dokument zeigt, wie Favelas in den Medien oft als Räume der Angst und Gewalt dargestellt werden, was zur Verfestigung von Vorurteilen und Diskriminierung führt. Beispiele aus den Medien illustrieren diese Stigmatisierung.
Welche Rolle spielen die sozialen Beziehungen in den Favelas?
Die sozialen Beziehungen werden als komplex und vielschichtig beschrieben, oszillierend zwischen Solidarität und Fragilität. Auch die gegenseitige Abgrenzung und die soziale/rassistische Diskriminierung sind Themen.
Welche Handlungsschemata werden von Favela-Bewohnern entwickelt?
Die Favela-Bewohner entwickeln Strategien im Spannungsfeld zwischen politischer Resignation und widerständiger Eigeninitiative, um mit ihrer schwierigen Alltagssituation umzugehen.
Welche Bedeutung hat der Stadtraum für die soziale Ungleichheit?
Der Stadtraum spiegelt die soziale Ungleichheit wider, wobei Favelas als räumliche Manifestationen dieser Ungleichheit betrachtet werden. Architektur und die Verteilung von Ressourcen im städtischen Raum verdeutlichen soziale Distanzen.
Wer ist Pierre Bourdieu?
Pierre Bourdieu war ein französischer Soziologe, Anthropologe, Philosoph und Publizist. Er gilt als einer der wichtigsten und meistrezipierten Soziologen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
- Arbeit zitieren
- Valerie Gruber (Autor:in), 2015, Der Habitus der brasilianischen Favelas. Ein städtischer Kulturraum?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1143426