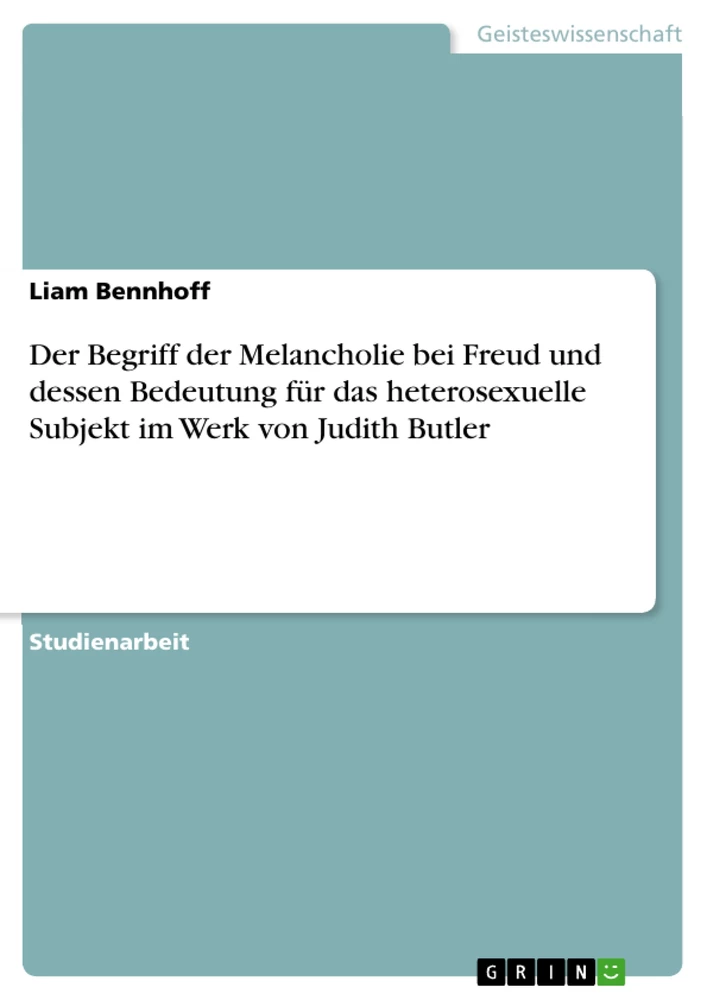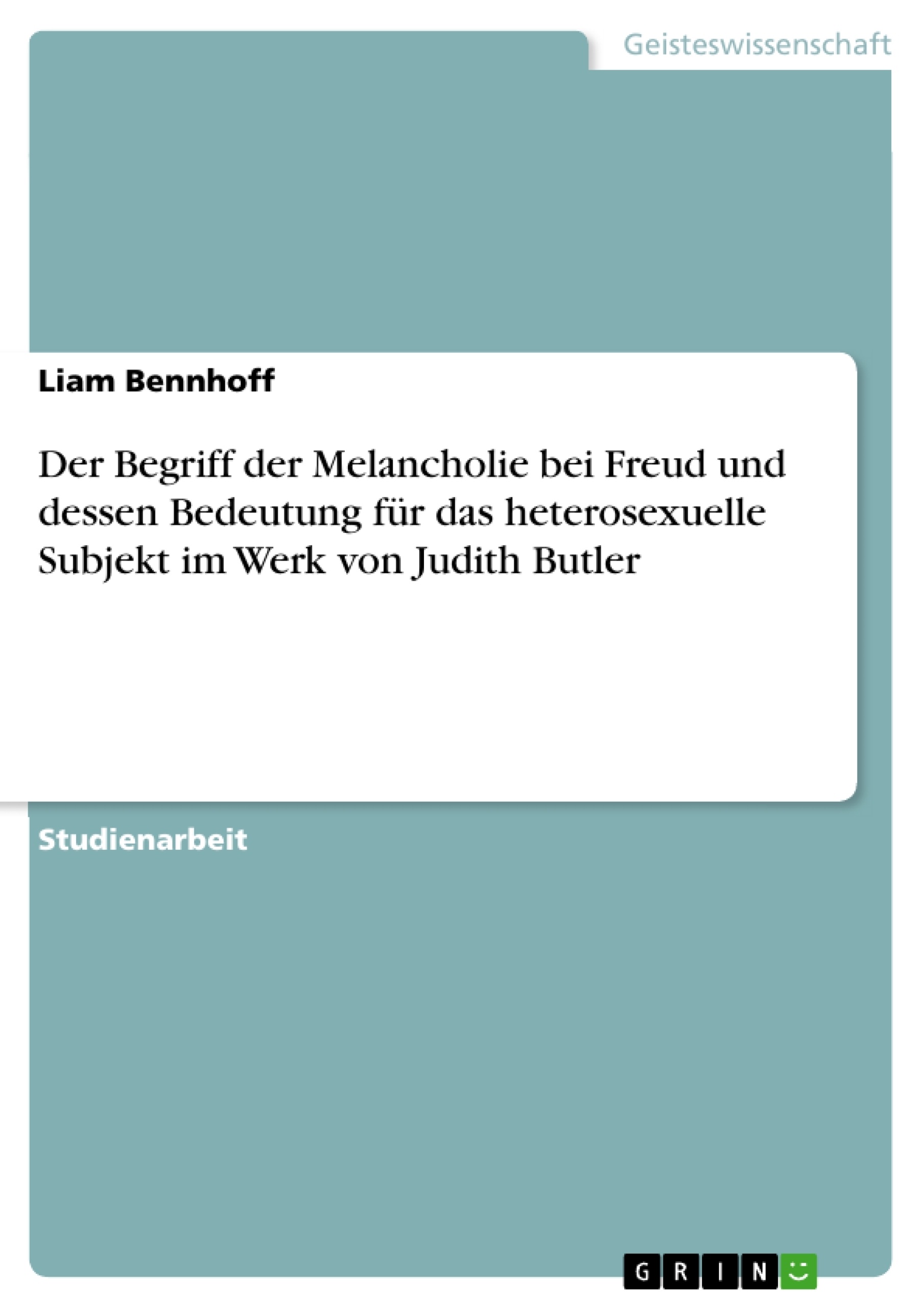Die vorliegende Seminararbeit widmet sich der psychoanalytischen Theorie zur melancholischen Verfasstheit. Zur grundlegenden Literatur auf diesem Gebiet gehört Sigmund Freuds Aufsatz "Trauer und Melancholie" aus dem Jahr 1917. Bis heute wird dieser Aufsatz vielfach rezipiert.
Die queerfeministische Philosophin Judith Butler greift Freuds Theorie für ihre dekonstruktivistischen Thesen zur normativen Regulierung der Geschlechtsidentität und des Begehrens über die heterosexuelle Matrix auf. Die Ausgangsfrage für diese Arbeit lautet, welchen Stellenwert Butler der Melancholie für die geschlechtliche Subjektwerdung in ihrem Werk einräumt. Es soll herausgearbeitet werden, weshalb sie sich in ihrer machtkritischen Haltung gegenüber dem heteronormativen Modell der Geschlechterbinarität auf das Konzept der Melancholie bezieht und in welcher Weise sie dieses für ihre eigene Theorie nutzbar macht.
Zunächst soll in Kapitel 2 das subjektkonstituierende Moment der Melancholie anhand einer theoretischen Einbettung von Freud nachgezeichnet werden. Hierzu wird der melancholische Modus im Verhältnis zum Prozess der Trauer definiert. Überdies werden sowohl die narzisstische Libido als auch das selbstkritische Gewissen als Instanzen der Melancholie beleuchtet.
In Kapitel 3 werden sodann die von Butler formulierten Implikationen für das heterosexuelle Subjekt herausgestellt. Es soll eingangs verdeutlicht werden, inwiefern das Verbot von Homosexualität als melancholische Verluststruktur zu verstehen ist. Zudem werden die heteronormativen Voraussetzungen ermittelt, die männliche und weibliche Identifizierungen als melancholische Ontologien hervorbringen. Abschließend wird evaluiert, ob und in welcher Weise die drag performance das melancholische Modell der Geschlechterbinarität subvertieren kann.
Diese Arbeit will die Aufmerksamkeit auf das unzureichende Maß des Betrauerns von gleichgeschlechtlicher Liebe lenken. In diesem Sinne möchte die Arbeit zu einer kritischen Selbstreflexion in Bezug auf die eigene Geschlechtsidentität anregen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Melancholische Subjektkonstitution bei Freud
- Inkorporation von nicht-betrauerten Liebesobjekten
- Ich-Spaltung durch Narzissmus und Gewissen
- Heterosexuelle Melancholie bei Butler
- Homosexuelles Begehren als nicht-betrauerter Verlust
- Männlichkeit und Weiblichkeit als melancholische Ontologien
- Aufführung der melancholischen Verluststruktur von Geschlecht in der drag performance
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die psychoanalytische Theorie der Melancholie nach Freud und deren Bedeutung für die Konstruktion des heterosexuellen Subjekts im Werk von Judith Butler. Ziel ist es, Butlers Bezugnahme auf das Konzept der Melancholie in ihrer Kritik am heteronormativen Modell der Geschlechterbinarität zu analysieren und deren Funktion in ihrer Theorie zu ergründen.
- Freuds Theorie der melancholischen Subjektkonstitution
- Unterscheidung zwischen Trauer und Melancholie
- Die Rolle von Narzissmus und Gewissen in der Melancholie
- Butlers Konzept der heterosexuellen Melancholie
- Die Bedeutung von drag performance als Subversion der melancholischen Geschlechterbinarität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie den alltagssprachlichen Gebrauch des Begriffs „Melancholie“ im Gegensatz zur psychoanalytischen Betrachtungsweise darstellt. Sie benennt die zentrale Forschungsfrage nach Butlers Verwendung des Melancholie-Konzepts im Kontext der Geschlechterkonstruktion und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Arbeit beabsichtigt eine kritische Reflexion der eigenen Geschlechtsidentität anzuregen.
Melancholische Subjektkonstitution bei Freud: Dieses Kapitel analysiert Freuds Unterscheidung von Trauer und Melancholie. Es untersucht den Prozess der Subjektivierung durch die Inkorporation verlorener Objekte und beleuchtet die Rolle von Narzissmus und Gewissen in der Entstehung melancholischer Ich-Spaltungen. Die zentrale These ist die Verlagerung der Affekte von der Außenwelt auf das Innenleben des Subjekts, was zu einem gestörten Selbstgefühl führt, das als zentrales Merkmal der Melancholie angesehen wird. Freuds Konzeption wird als Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit Butlers Theorie verwendet.
Schlüsselwörter
Melancholie, Trauer, Freud, Butler, heterosexuelles Subjekt, Geschlechtsidentität, Geschlechterbinarität, Narzissmus, Gewissen, Homosexualität, drag performance, queerfeministische Theorie, psychoanalytische Theorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Melancholie, Heterosexualität und Geschlechterkonstruktion bei Freud und Butler
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die psychoanalytische Theorie der Melancholie nach Freud und deren Bedeutung für die Konstruktion des heterosexuellen Subjekts im Werk von Judith Butler. Sie analysiert Butlers Bezugnahme auf das Konzept der Melancholie in ihrer Kritik am heteronormativen Modell der Geschlechterbinarität und ergründet dessen Funktion in ihrer Theorie.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Freuds Theorie der melancholischen Subjektkonstitution, die Unterscheidung zwischen Trauer und Melancholie, die Rolle von Narzissmus und Gewissen in der Melancholie, Butlers Konzept der heterosexuellen Melancholie und die Bedeutung von Drag Performance als Subversion der melancholischen Geschlechterbinarität.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die melancholische Subjektkonstitution bei Freud, ein Kapitel über die heterosexuelle Melancholie bei Butler und einen Schluss. Die Einleitung stellt den alltagssprachlichen Gebrauch des Begriffs „Melancholie“ der psychoanalytischen Betrachtungsweise gegenüber, formuliert die Forschungsfrage und skizziert den Aufbau. Das Kapitel zu Freud analysiert seine Unterscheidung von Trauer und Melancholie und den Prozess der Subjektivierung durch Inkorporation verlorener Objekte. Das Kapitel zu Butler untersucht Butlers Konzept der heterosexuellen Melancholie und die Rolle von Drag Performance.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselkonzepte sind Melancholie, Trauer, Freud, Butler, heterosexuelles Subjekt, Geschlechtsidentität, Geschlechterbinarität, Narzissmus, Gewissen, Homosexualität, Drag Performance, queerfeministische Theorie und psychoanalytische Theorie.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist die Untersuchung, wie Butlers Bezugnahme auf Freuds Melancholie-Konzept ihre Kritik am heteronormativen Geschlechtermodell stützt und wie dieses Konzept in ihrer Theorie funktioniert. Die Arbeit will auch eine kritische Reflexion der eigenen Geschlechtsidentität anregen.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Wie verwendet Judith Butler das Konzept der Melancholie, um das heteronormative Modell der Geschlechterbinarität zu kritisieren und ihre eigene Theorie zu konstruieren?
Wie wird Freuds Theorie der Melancholie in der Arbeit verwendet?
Freuds Theorie dient als Grundlage für das Verständnis von Butlers Ansatz. Die Arbeit analysiert Freuds Unterscheidung von Trauer und Melancholie, den Prozess der Subjektivierung und die Rolle von Narzissmus und Gewissen bei der Entstehung melancholischer Ich-Spaltungen. Diese Analyse bildet die Basis für den Vergleich und die Interpretation von Butlers Werk.
Welche Rolle spielt Drag Performance in der Arbeit?
Drag Performance wird als ein Beispiel für die Subversion der melancholischen Geschlechterbinarität betrachtet. Die Arbeit untersucht, wie Drag Performance die konstruierten Geschlechterrollen und die damit verbundenen Verluststrukturen hinterfragt und aufbricht.
- Quote paper
- Liam Bennhoff (Author), 2016, Der Begriff der Melancholie bei Freud und dessen Bedeutung für das heterosexuelle Subjekt im Werk von Judith Butler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1148658